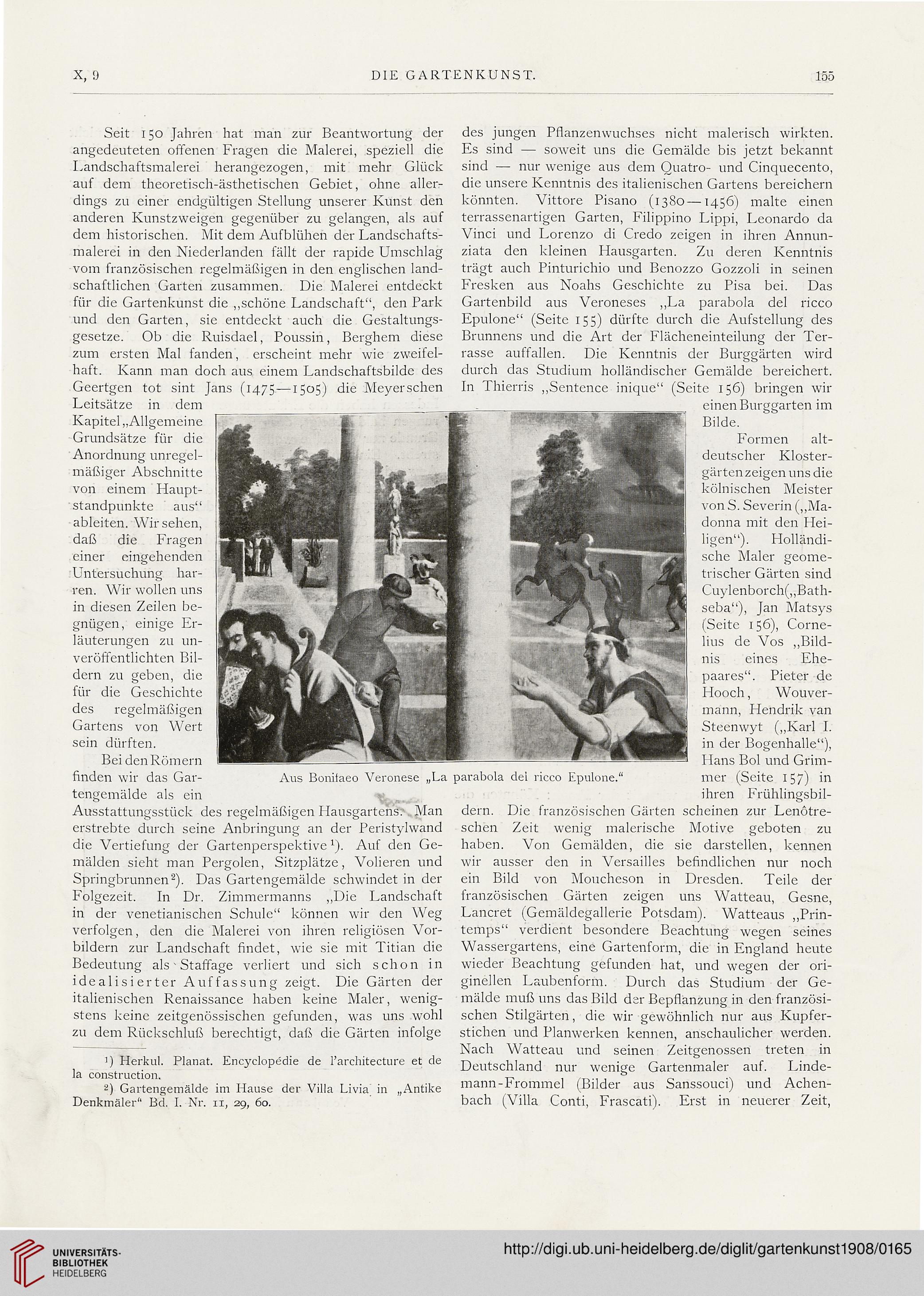X, 9
DIE GARTENKUNST.
155
Seit 150 Jahren hat man zur Beantwortung der
angedeuteten offenen Fragen die Malerei, speziell die
Landschaftsmalerei herangezogen, mit mehr Glück
auf dem theoretisch-ästhetischen Gebiet, ohne aller-
dings zu einer endgültigen Stellung unserer Kunst den
anderen Kunstzweigen gegenüber zu gelangen, als auf
dem historischen. Mit dem Aufblühen der Landschafts-
malerei in den Niederlanden fällt der rapide Umschlag
vom französischen regelmäßigen in den englischen land-
schaftlichen Garten zusammen. Die Malerei entdeckt
für die Gartenkunst die „schöne Landschaft“, den Park
und den Garten, sie entdeckt auch die Gestaltungs-
gesetze. Ob die Ruisdael, Poussin, Berghem diese
zum ersten Mal fanden, erscheint mehr wie zweifel-
haft. Kann man doch aus einem Landschaftsbilde des
Geertgen tot sint Jans (1475.—1505) die Meyerschen
Leitsätze in dem
Kapitel „Allgemeine
Grundsätze für die
Anordnung unregel-
mäßiger Abschnitte
von einem Haupt-
standpunkte aus“
ableiten. Wirsehen,
daß die Fragen
einer eingehenden
Untersuchung har-
ren. Wir wollen uns
in diesen Zeilen be-
gnügen , einige Er-
läuterungen zu un-
veröffentlichten Bil-
dern zu geben, die
für die Geschichte
des regelmäßigen
Gartens von Wert
sein dürften.
Bei den Römern
finden wir das Gar-
tengemälde als ein
Ausstattungsstück des regelmäßigen Hausgartehs. .Man
erstrebte durch seine Anbringung an der Peristylwand
die Vertiefung der Gartenperspektive1). Auf den Ge-
mälden sieht man Pergolen, Sitzplätze, Volieren und
Springbrunnen2). Das Gartengemälde schwindet in der
Folgezeit. In Dr. Zimmermanns „Die Landschaft
in der venetianischen Schule“ können wir den Weg
verfolgen, den die Malerei von ihren religiösen Vor-
bildern zur Landschaft findet, wie sie mit Titian die
Bedeutung als'Staffage verliert und sich schon in
idealisierter Auffassung zeigt. Die Gärten der
italienischen Renaissance haben keine Maler, wenig-
stens keine zeitgenössischen gefunden, was uns wohl
zu dem Rückschluß berechtigt, daß die Gärten infolge
1) Herkul. Planat. Encyclopedie de l’architecture et de
la construction.
2) Gartengemälde im Hause der Villa Livia in „Antike
Denkmäler“ Bd. I. Nr. 11, 29, 60.
des jungen Pflanzenwuchses nicht malerisch wirkten.
Es sind — soweit uns die Gemälde bis jetzt bekannt
sind — nur wenige aus dem Quatro- und Cinquecento,
die unsere Kenntnis des italienischen Gartens bereichern
könnten. Vittore Pisano (1380—1456) malte einen
terrassenartigen Garten, Filippino Lippi, Leonardo da
Vinci und Lorenzo di Credo zeigen in ihren Annun-
ziata den kleinen Hausgarten. Zu deren Kenntnis
trägt auch Pinturichio und Benozzo Gozzoli in seinen
Fresken aus Noahs Geschichte zu Pisa bei. Das
Gartenbild aus Veroneses „La parabola del ricco
Epulone“ (Seite 155) dürfte durch die Aufstellung des
Brunnens und die Art der Flächeneinteilung der Ter-
rasse auffallen. Die Kenntnis der Burggärten wird
durch das Studium holländischer Gemälde bereichert.
In Thierris „Sentence inique“ (Seite 156) bringen wir
einen Burggarten im
Bilde.
F'ormen alt-
deutscher Kloster-
gärten zeigen uns die
kölnischen Meister
von S. Severin („Ma-
donna mit den Hei-
ligen“). Holländi-
sche Maler geome-
trischer Gärten sind
Cuylenborch(,,Bath-
seba“), Jan Matsys
(Seite 156), Corne-
lius de Vos „Bild-
nis eines Ehe-
paares“. Pieter de
Hooch, Wouver-
mann, Hendrik van
Steenwyt („Karl I.
in der Bogenhalle“),
Hans Boi und Grim-
mer (Seite 157) in
ihren Frühlingsbil-
dern. Die französischen Gärten scheinen zur Lenötre-
schen Zeit wenig malerische Motive geboten zu
haben. Von Gemälden, die sie darstellen, kennen
wir äusser den in Versailles befindlichen nur noch
ein Bild von Moucheson in Dresden. Teile der
französischen Gärten zeigen uns Watteau, Gesne,
Lancret (Gemäldegallerie Potsdam). Watteaus „Prin-
temps“ verdient besondere Beachtung wegen seines
Wassergartens, eine Gartenform, die in England heute
wieder Beachtung gefunden hat, und wegen der ori-
ginellen Laubenform. Durch das Studium der Ge-
mälde muß uns das Bild der Bepflanzung in den französi-
schen Stilgärten, die wir gewöhnlich nur aus Kupfer-
stichen und Planwerken kennen, anschaulicher werden.
Nach Watteau und seinen Zeitgenossen treten in
Deutschland nur wenige Gartenmaler auf. Linde-
mann-Frommel (Bilder aus Sanssouci) und Achen-
bach (Villa Conti, Frascati). Erst in neuerer Zeit,
Aus Bonifaeo Veronese „La parabola del ricco Epulone.
DIE GARTENKUNST.
155
Seit 150 Jahren hat man zur Beantwortung der
angedeuteten offenen Fragen die Malerei, speziell die
Landschaftsmalerei herangezogen, mit mehr Glück
auf dem theoretisch-ästhetischen Gebiet, ohne aller-
dings zu einer endgültigen Stellung unserer Kunst den
anderen Kunstzweigen gegenüber zu gelangen, als auf
dem historischen. Mit dem Aufblühen der Landschafts-
malerei in den Niederlanden fällt der rapide Umschlag
vom französischen regelmäßigen in den englischen land-
schaftlichen Garten zusammen. Die Malerei entdeckt
für die Gartenkunst die „schöne Landschaft“, den Park
und den Garten, sie entdeckt auch die Gestaltungs-
gesetze. Ob die Ruisdael, Poussin, Berghem diese
zum ersten Mal fanden, erscheint mehr wie zweifel-
haft. Kann man doch aus einem Landschaftsbilde des
Geertgen tot sint Jans (1475.—1505) die Meyerschen
Leitsätze in dem
Kapitel „Allgemeine
Grundsätze für die
Anordnung unregel-
mäßiger Abschnitte
von einem Haupt-
standpunkte aus“
ableiten. Wirsehen,
daß die Fragen
einer eingehenden
Untersuchung har-
ren. Wir wollen uns
in diesen Zeilen be-
gnügen , einige Er-
läuterungen zu un-
veröffentlichten Bil-
dern zu geben, die
für die Geschichte
des regelmäßigen
Gartens von Wert
sein dürften.
Bei den Römern
finden wir das Gar-
tengemälde als ein
Ausstattungsstück des regelmäßigen Hausgartehs. .Man
erstrebte durch seine Anbringung an der Peristylwand
die Vertiefung der Gartenperspektive1). Auf den Ge-
mälden sieht man Pergolen, Sitzplätze, Volieren und
Springbrunnen2). Das Gartengemälde schwindet in der
Folgezeit. In Dr. Zimmermanns „Die Landschaft
in der venetianischen Schule“ können wir den Weg
verfolgen, den die Malerei von ihren religiösen Vor-
bildern zur Landschaft findet, wie sie mit Titian die
Bedeutung als'Staffage verliert und sich schon in
idealisierter Auffassung zeigt. Die Gärten der
italienischen Renaissance haben keine Maler, wenig-
stens keine zeitgenössischen gefunden, was uns wohl
zu dem Rückschluß berechtigt, daß die Gärten infolge
1) Herkul. Planat. Encyclopedie de l’architecture et de
la construction.
2) Gartengemälde im Hause der Villa Livia in „Antike
Denkmäler“ Bd. I. Nr. 11, 29, 60.
des jungen Pflanzenwuchses nicht malerisch wirkten.
Es sind — soweit uns die Gemälde bis jetzt bekannt
sind — nur wenige aus dem Quatro- und Cinquecento,
die unsere Kenntnis des italienischen Gartens bereichern
könnten. Vittore Pisano (1380—1456) malte einen
terrassenartigen Garten, Filippino Lippi, Leonardo da
Vinci und Lorenzo di Credo zeigen in ihren Annun-
ziata den kleinen Hausgarten. Zu deren Kenntnis
trägt auch Pinturichio und Benozzo Gozzoli in seinen
Fresken aus Noahs Geschichte zu Pisa bei. Das
Gartenbild aus Veroneses „La parabola del ricco
Epulone“ (Seite 155) dürfte durch die Aufstellung des
Brunnens und die Art der Flächeneinteilung der Ter-
rasse auffallen. Die Kenntnis der Burggärten wird
durch das Studium holländischer Gemälde bereichert.
In Thierris „Sentence inique“ (Seite 156) bringen wir
einen Burggarten im
Bilde.
F'ormen alt-
deutscher Kloster-
gärten zeigen uns die
kölnischen Meister
von S. Severin („Ma-
donna mit den Hei-
ligen“). Holländi-
sche Maler geome-
trischer Gärten sind
Cuylenborch(,,Bath-
seba“), Jan Matsys
(Seite 156), Corne-
lius de Vos „Bild-
nis eines Ehe-
paares“. Pieter de
Hooch, Wouver-
mann, Hendrik van
Steenwyt („Karl I.
in der Bogenhalle“),
Hans Boi und Grim-
mer (Seite 157) in
ihren Frühlingsbil-
dern. Die französischen Gärten scheinen zur Lenötre-
schen Zeit wenig malerische Motive geboten zu
haben. Von Gemälden, die sie darstellen, kennen
wir äusser den in Versailles befindlichen nur noch
ein Bild von Moucheson in Dresden. Teile der
französischen Gärten zeigen uns Watteau, Gesne,
Lancret (Gemäldegallerie Potsdam). Watteaus „Prin-
temps“ verdient besondere Beachtung wegen seines
Wassergartens, eine Gartenform, die in England heute
wieder Beachtung gefunden hat, und wegen der ori-
ginellen Laubenform. Durch das Studium der Ge-
mälde muß uns das Bild der Bepflanzung in den französi-
schen Stilgärten, die wir gewöhnlich nur aus Kupfer-
stichen und Planwerken kennen, anschaulicher werden.
Nach Watteau und seinen Zeitgenossen treten in
Deutschland nur wenige Gartenmaler auf. Linde-
mann-Frommel (Bilder aus Sanssouci) und Achen-
bach (Villa Conti, Frascati). Erst in neuerer Zeit,
Aus Bonifaeo Veronese „La parabola del ricco Epulone.