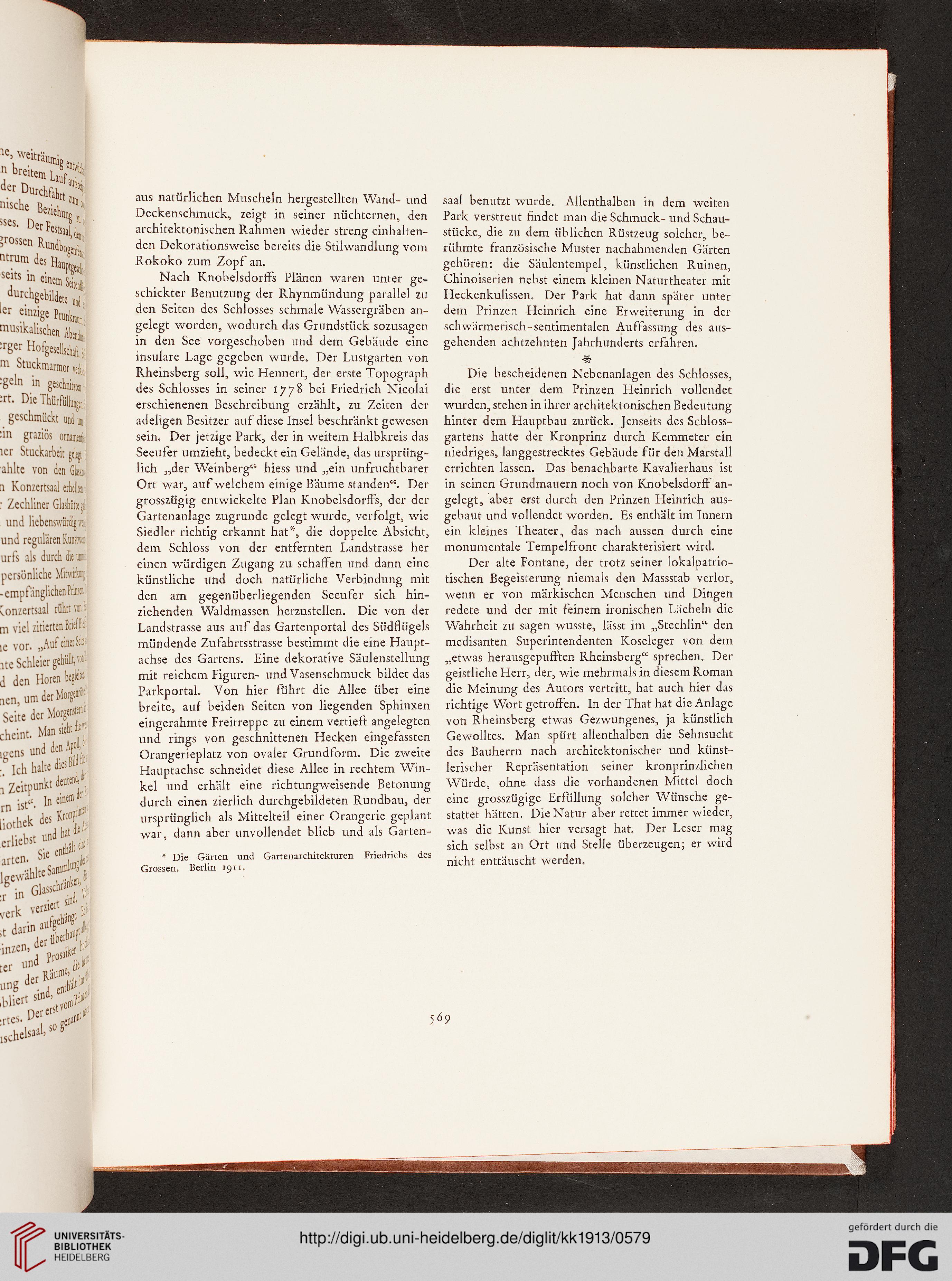5Ses- DerFe4:
ntnim des p, S *
seits in ^
dureHgebildcte mJ
musikalischen Abende
;rg" Hofgesellsduti
m Stuckmarmor Kit-
:geln in geseknidta
»• Die Thürfüüunget
_ geschmückt und t
:in graziös ornamtt
ler Stuckarbeit gelegt
ahlte von den Ghst
n Konzertsaal erhelltet.
• Zechliner Glashütte ^
und liebenswürdige
und regulärenKunsmer
urfs als durch die iE
persönliche Mitwirkf
- empfanglichen Primea
Konzertsaal rührt von;.
m viel zitierten BriefB:;:
te vor. „Auf einetfc
ite Schleier geholt,«
d den Hören
^en, um
Seite der M«pf
cheint. Man siehtj«;
Lgens und den f
? Ich halte dies Bild tu
.Zeitpunkt ta j
rnist". m^fc:
nothck des m
;rg in Glasschrankt
die A-
m
„k verzicrt -
J in aufg«'
rer «nd . dt1''
ibücrt tfA V
■rtes. D<[e*V
aus natürlichen Muscheln hergestellten Wand- und
Deckenschmuck, zeigt in seiner nüchternen, den
architektonischen Rahmen wieder streng einhalten-
den Dekorationsweise bereits die Stilwandlung vom
Rokoko zum Zopf an.
Nach KnobelsdorfFs Plänen waren unter ge-
schickter Benutzung der Rhynmündung parallel zu
den Seiten des Schlosses schmale Wassergräben an-
gelegt worden, wodurch das Grundstück sozusagen
in den See vorgeschoben und dem Gebäude eine
insulare Lage gegeben wurde. Der Lustgarten von
Rheinsberg soll, wie Hennert, der erste Topograph
des Schlosses in seiner 1778 bei Friedrich Nicolai
erschienenen Beschreibung erzählt, zu Zeiten der
adeligen Besitzer auf diese Insel beschränkt gewesen
sein. Der jetzige Park, der in weitem Halbkreis das
Seeufer umzieht, bedeckt ein Gelände, das ursprüng-
lich „der Weinberg" hiess und „ein unfruchtbarer
Ort war, auf welchem einige Bäume standen". Der
grosszügig entwickelte Plan KnobelsdorfFs, der der
Gartenanlage zugrunde gelegt wurde, verfolgt, wie
Siedler richtig erkannt hat*, die doppelte Absicht,
dem Schloss von der entfernten Landstrasse her
einen würdigen Zugang zu schaffen und dann eine
künstliche und doch natürliche Verbindung mit
den am gegenüberliegenden Seeufer sich hin-
ziehenden Waldmassen herzustellen. Die von der
Landstrasse aus auf das Gartenportal des Südflügels
mündende Zufahrtsstrasse bestimmt die eine Haupt-
achse des Gartens. Eine dekorative Säulenstellung
mit reichem Figuren- und Vasenschmuck bildet das
Parkportal. Von hier führt die Allee über eine
breite, auf beiden Seiten von liegenden Sphinxen
eingerahmte Freitreppe zu einem vertieft angelegten
und rings von geschnittenen Hecken eingefassten
Orangerieplatz von ovaler Grundform. Die zweite
Hauptachse schneidet diese Allee in rechtem Win-
kel und erhält eine richtungweisende Betonung
durch einen zierlich durchgebildeten Rundbau, der
ursprünglich als Mittelteil einer Orangerie geplant
war, dann aber unvollendet blieb und als Garten-
* Die Gärten und Gartenarchitekturen Friedrichs des
Grossen. Berlin 1911.
saal benutzt wurde. Allenthalben in dem weiten
Park verstreut findet man die Schmuck- und Schau-
stücke, die zu dem üblichen Rüstzeug solcher, be-
rühmte französische Muster nachahmenden Gärten
gehören: die Säulentempel, künstlichen Ruinen,
Chinoiserien nebst einem kleinen Naturtheater mit
Heckenkulissen. Der Park hat dann später unter
dem Prinzen Heinrich eine Erweiterung in der
schwärmerisch-sentimentalen Auffassung des aus-
gehenden achtzehnten Jahrhunderts erfahren.
*
Die bescheidenen Nebenanlagen des Schlosses,
die erst unter dem Prinzen Heinrich vollendet
wurden, stehen in ihrer architektonischen Bedeutung
hinter dem Hauptbau zurück. Jenseits des Schloss-
gartens hatte der Kronprinz durch Kemmeter ein
niedriges, langgestrecktes Gebäude für den Marstall
errichten lassen. Das benachbarte Kavalierhaus ist
in seinen Grundmauern noch von Knobelsdorff an-
gelegt, aber erst durch den Prinzen Heinrich aus-
gebaut und vollendet worden. Es enthält im Innern
ein kleines Theater, das nach aussen durch eine
monumentale Tempelfront charakterisiert wird.
Der alte Fontane, der trotz seiner lokalpatrio-
tischen Begeisterung niemals den Massstab verlor,
wenn er von märkischen Menschen und Dingen
redete und der mit feinem ironischen Lächeln die
Wahrheit zu sagen wusste, lässt im „Stechlin" den
medisanten Superintendenten Koseleger von dem
„etwas herausgepufften Rheinsberg" sprechen. Der
geistliche Herr, der, wie mehrmals in diesem Roman
die Meinung des Autors vertritt, hat auch hier das
richtige Wort getroffen. In der That hat die Anlage
von Rheinsberg etwas Gezwungenes, ja künstlich
Gewolltes. Man spürt allenthalben die Sehnsucht
des Bauherrn nach architektonischer und künst-
lerischer Repräsentation seiner kronprinzlichen
Würde, ohne dass die vorhandenen Mittel doch
eine grosszügige Erfüllung solcher Wünsche ge-
stattet hätten. Die Natur aber rettet immer wieder,
was die Kunst hier versagt hat. Der Leser mag
sich selbst an Ort und Stelle überzeugen; er wird
nicht enttäuscht werden.
LSC
-helsaal, so
569
ntnim des p, S *
seits in ^
dureHgebildcte mJ
musikalischen Abende
;rg" Hofgesellsduti
m Stuckmarmor Kit-
:geln in geseknidta
»• Die Thürfüüunget
_ geschmückt und t
:in graziös ornamtt
ler Stuckarbeit gelegt
ahlte von den Ghst
n Konzertsaal erhelltet.
• Zechliner Glashütte ^
und liebenswürdige
und regulärenKunsmer
urfs als durch die iE
persönliche Mitwirkf
- empfanglichen Primea
Konzertsaal rührt von;.
m viel zitierten BriefB:;:
te vor. „Auf einetfc
ite Schleier geholt,«
d den Hören
^en, um
Seite der M«pf
cheint. Man siehtj«;
Lgens und den f
? Ich halte dies Bild tu
.Zeitpunkt ta j
rnist". m^fc:
nothck des m
;rg in Glasschrankt
die A-
m
„k verzicrt -
J in aufg«'
rer «nd . dt1''
ibücrt tfA V
■rtes. D<[e*V
aus natürlichen Muscheln hergestellten Wand- und
Deckenschmuck, zeigt in seiner nüchternen, den
architektonischen Rahmen wieder streng einhalten-
den Dekorationsweise bereits die Stilwandlung vom
Rokoko zum Zopf an.
Nach KnobelsdorfFs Plänen waren unter ge-
schickter Benutzung der Rhynmündung parallel zu
den Seiten des Schlosses schmale Wassergräben an-
gelegt worden, wodurch das Grundstück sozusagen
in den See vorgeschoben und dem Gebäude eine
insulare Lage gegeben wurde. Der Lustgarten von
Rheinsberg soll, wie Hennert, der erste Topograph
des Schlosses in seiner 1778 bei Friedrich Nicolai
erschienenen Beschreibung erzählt, zu Zeiten der
adeligen Besitzer auf diese Insel beschränkt gewesen
sein. Der jetzige Park, der in weitem Halbkreis das
Seeufer umzieht, bedeckt ein Gelände, das ursprüng-
lich „der Weinberg" hiess und „ein unfruchtbarer
Ort war, auf welchem einige Bäume standen". Der
grosszügig entwickelte Plan KnobelsdorfFs, der der
Gartenanlage zugrunde gelegt wurde, verfolgt, wie
Siedler richtig erkannt hat*, die doppelte Absicht,
dem Schloss von der entfernten Landstrasse her
einen würdigen Zugang zu schaffen und dann eine
künstliche und doch natürliche Verbindung mit
den am gegenüberliegenden Seeufer sich hin-
ziehenden Waldmassen herzustellen. Die von der
Landstrasse aus auf das Gartenportal des Südflügels
mündende Zufahrtsstrasse bestimmt die eine Haupt-
achse des Gartens. Eine dekorative Säulenstellung
mit reichem Figuren- und Vasenschmuck bildet das
Parkportal. Von hier führt die Allee über eine
breite, auf beiden Seiten von liegenden Sphinxen
eingerahmte Freitreppe zu einem vertieft angelegten
und rings von geschnittenen Hecken eingefassten
Orangerieplatz von ovaler Grundform. Die zweite
Hauptachse schneidet diese Allee in rechtem Win-
kel und erhält eine richtungweisende Betonung
durch einen zierlich durchgebildeten Rundbau, der
ursprünglich als Mittelteil einer Orangerie geplant
war, dann aber unvollendet blieb und als Garten-
* Die Gärten und Gartenarchitekturen Friedrichs des
Grossen. Berlin 1911.
saal benutzt wurde. Allenthalben in dem weiten
Park verstreut findet man die Schmuck- und Schau-
stücke, die zu dem üblichen Rüstzeug solcher, be-
rühmte französische Muster nachahmenden Gärten
gehören: die Säulentempel, künstlichen Ruinen,
Chinoiserien nebst einem kleinen Naturtheater mit
Heckenkulissen. Der Park hat dann später unter
dem Prinzen Heinrich eine Erweiterung in der
schwärmerisch-sentimentalen Auffassung des aus-
gehenden achtzehnten Jahrhunderts erfahren.
*
Die bescheidenen Nebenanlagen des Schlosses,
die erst unter dem Prinzen Heinrich vollendet
wurden, stehen in ihrer architektonischen Bedeutung
hinter dem Hauptbau zurück. Jenseits des Schloss-
gartens hatte der Kronprinz durch Kemmeter ein
niedriges, langgestrecktes Gebäude für den Marstall
errichten lassen. Das benachbarte Kavalierhaus ist
in seinen Grundmauern noch von Knobelsdorff an-
gelegt, aber erst durch den Prinzen Heinrich aus-
gebaut und vollendet worden. Es enthält im Innern
ein kleines Theater, das nach aussen durch eine
monumentale Tempelfront charakterisiert wird.
Der alte Fontane, der trotz seiner lokalpatrio-
tischen Begeisterung niemals den Massstab verlor,
wenn er von märkischen Menschen und Dingen
redete und der mit feinem ironischen Lächeln die
Wahrheit zu sagen wusste, lässt im „Stechlin" den
medisanten Superintendenten Koseleger von dem
„etwas herausgepufften Rheinsberg" sprechen. Der
geistliche Herr, der, wie mehrmals in diesem Roman
die Meinung des Autors vertritt, hat auch hier das
richtige Wort getroffen. In der That hat die Anlage
von Rheinsberg etwas Gezwungenes, ja künstlich
Gewolltes. Man spürt allenthalben die Sehnsucht
des Bauherrn nach architektonischer und künst-
lerischer Repräsentation seiner kronprinzlichen
Würde, ohne dass die vorhandenen Mittel doch
eine grosszügige Erfüllung solcher Wünsche ge-
stattet hätten. Die Natur aber rettet immer wieder,
was die Kunst hier versagt hat. Der Leser mag
sich selbst an Ort und Stelle überzeugen; er wird
nicht enttäuscht werden.
LSC
-helsaal, so
569