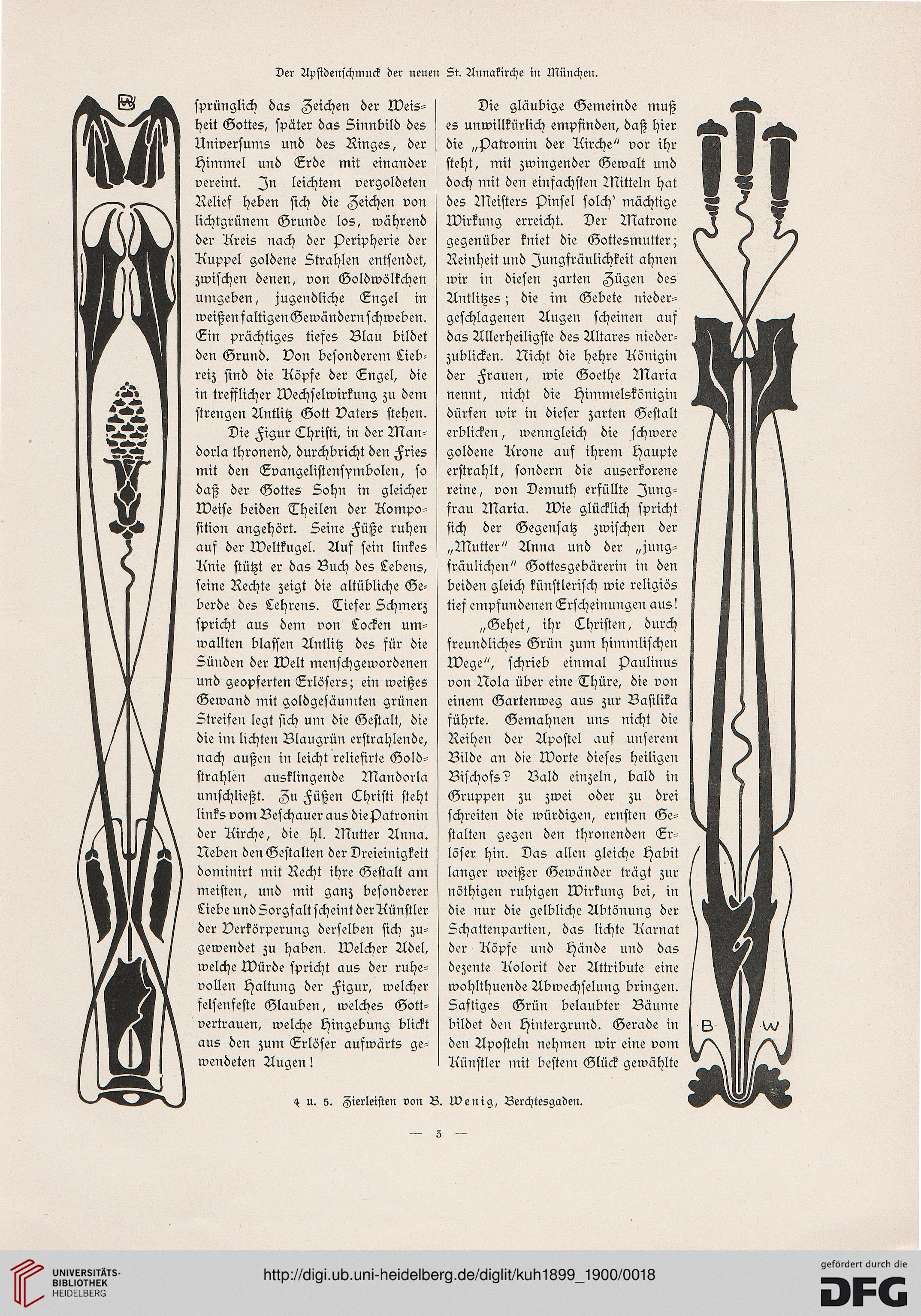Der Axfidenschmuck der neuen St. Annakirche in München.
sprünglich das Zeichen der Weis-
heit Gottes, später das Sinnbild des
Universums und des Ringes, der
Fimmel und Erde mit einander
vereint. Zn leichtein vergoldeten
Relief heben sich die Zeichen von
lichtgrünent Grunde los, während
der Ureis nach der Peripherie der
Kuppel goldene Strahlen entsendet,
zwischen denen, von Goldwölkchen
umgeben, jugendliche Engel in
weißen faltigen Gewändern schweben.
Ein prächtiges tiefes Blau bildet
den Grund. Von besonderem Lieb-
reiz sind die Köpfe der Engel, die
in trefflicher Wechselwirkung zu dem
strengen Antlitz Gott Vaters stehen.
Die Figur Ehristi, in der Man-
dorla thronend, durchbricht deu Fries
mit den Evangelistensymbolen, so
daß der Gottes Sohn in gleicher
Weife beiden Theilen der Kompo-
sition angehört. Seine Füße ruhen
auf der Weltkugel. Auf fein linkes
Knie stützt er das Buch des Lebens,
seine Rechte zeigt die altübliche Ge-
berde des Lehrens. Tiefer Schmerz
spricht aus dem von Locken um-
wallten blaffen Antlitz des für die
Sünden der Welt menschgewordenen
und geopferten Erlösers; ein weißes
Gewand mit goldgesäumten grünen
Streifen legt sich uni die Gestalt, die
die im lichten Blaugrün erstrahlende,
nach außen in leicht reliefirte Gold-
strahlen ausklingende Mandorla
umschließt. Zu Füßen Ehristi steht
links vom Beschauer aus die Patronin
der Kirche, die hl. Mutter Anna.
Neben den Gestaltet: der Dreieinigkeit
dominirt mit Recht ihre Gestalt an:
meisten, und mit ganz besonderer
Liebe und Sorgfalt scheint derKünstler
der Verkörperung derselben sich zu-
gewendet zu haben. Welcher Adel,
welche Würde spricht aus der ruhe-
vollen paltuug der Figur, welcher
felsenfeste Glauben, welches Gott-
vertrauen, welche Hingebung blickt
aus den zum Erlöser aufwärts ge-
wendeten Augen!
u. 5. Zierleisten von B
Die gläubige Gemeinde inuß
es unwillkürlich empfinden, daß hier
die „Patronin der Kirche" vor ihr
steht, mit zwingender Gewalt und
doch init den einfachsten Mitteln hat
des Meisters Pinsel solch' mächtige
Wirkung erreicht. Der Matrone
gegenüber kniet die Gottesnmtter;
Reinheit und Jungfräulichkeit ahnen
wir in diesen zarten Zügen des
Antlitzes; die im Gebete nieder-
geschlagenen Augen scheinen auf
das Allerheiligste des Altares nieder-
zublicken. Nicht die hehre Königin
der Frauen, wie Goethe Maria
nennt, nicht die Himmelskönigin
dürfen wir in dieser zarten Gestalt
erblicken, wenngleich die schwere
goldene Krone auf ihren: Haupte
erstrahlt, sondern die auserkorene
reine, von Demuth erfüllte Jung-
frau Maria. Wie glücklich spricht
sich der Gegensatz zwischen der
„Mutter" Anna und der „jung-
fräuliche»" Gottesgebäreriu in den
beiden gleich künstlerisch wie religiös
tief empfundenen Erscheinungen aus!
„Gehet, ihr Lhristen, durch
freundliches Grün zum himmlischen
Wege", schrieb einmal Paulinus
von Nola über eine Thüre, die von
einen: Gartenweg aus zur Basilika
führte. Gemahnen uns nicht die
Reihen der Apostel auf unserem
Bilde an die Worte dieses heiligen
Bischofs? Bald einzeln, bald in
Gruppen zu zwei oder zu drei
schreiten die würdigen, ernsten Ge-
stalten gegen den thronenden Er-
löser hin. Das allen gleiche Habit
langer weißer Gewänder trägt zur
nöthigen ruhigen Wirkung bei, in
die nur die gelbliche Abtönung der
Schattenpartien, das lichte Karnat
der Köpfe und Hände und das
dezente Kolorit der Attribute eine
wohlthuende Abwechselung bringen.
Saftiges Grün belaubter Bäume
bildet den Hintergrund. Gerade in
den Aposteln nehmen wir eine von:
Künstler mit bestem Glück gewählte
’. wenig, Berchtesgaden.
3
sprünglich das Zeichen der Weis-
heit Gottes, später das Sinnbild des
Universums und des Ringes, der
Fimmel und Erde mit einander
vereint. Zn leichtein vergoldeten
Relief heben sich die Zeichen von
lichtgrünent Grunde los, während
der Ureis nach der Peripherie der
Kuppel goldene Strahlen entsendet,
zwischen denen, von Goldwölkchen
umgeben, jugendliche Engel in
weißen faltigen Gewändern schweben.
Ein prächtiges tiefes Blau bildet
den Grund. Von besonderem Lieb-
reiz sind die Köpfe der Engel, die
in trefflicher Wechselwirkung zu dem
strengen Antlitz Gott Vaters stehen.
Die Figur Ehristi, in der Man-
dorla thronend, durchbricht deu Fries
mit den Evangelistensymbolen, so
daß der Gottes Sohn in gleicher
Weife beiden Theilen der Kompo-
sition angehört. Seine Füße ruhen
auf der Weltkugel. Auf fein linkes
Knie stützt er das Buch des Lebens,
seine Rechte zeigt die altübliche Ge-
berde des Lehrens. Tiefer Schmerz
spricht aus dem von Locken um-
wallten blaffen Antlitz des für die
Sünden der Welt menschgewordenen
und geopferten Erlösers; ein weißes
Gewand mit goldgesäumten grünen
Streifen legt sich uni die Gestalt, die
die im lichten Blaugrün erstrahlende,
nach außen in leicht reliefirte Gold-
strahlen ausklingende Mandorla
umschließt. Zu Füßen Ehristi steht
links vom Beschauer aus die Patronin
der Kirche, die hl. Mutter Anna.
Neben den Gestaltet: der Dreieinigkeit
dominirt mit Recht ihre Gestalt an:
meisten, und mit ganz besonderer
Liebe und Sorgfalt scheint derKünstler
der Verkörperung derselben sich zu-
gewendet zu haben. Welcher Adel,
welche Würde spricht aus der ruhe-
vollen paltuug der Figur, welcher
felsenfeste Glauben, welches Gott-
vertrauen, welche Hingebung blickt
aus den zum Erlöser aufwärts ge-
wendeten Augen!
u. 5. Zierleisten von B
Die gläubige Gemeinde inuß
es unwillkürlich empfinden, daß hier
die „Patronin der Kirche" vor ihr
steht, mit zwingender Gewalt und
doch init den einfachsten Mitteln hat
des Meisters Pinsel solch' mächtige
Wirkung erreicht. Der Matrone
gegenüber kniet die Gottesnmtter;
Reinheit und Jungfräulichkeit ahnen
wir in diesen zarten Zügen des
Antlitzes; die im Gebete nieder-
geschlagenen Augen scheinen auf
das Allerheiligste des Altares nieder-
zublicken. Nicht die hehre Königin
der Frauen, wie Goethe Maria
nennt, nicht die Himmelskönigin
dürfen wir in dieser zarten Gestalt
erblicken, wenngleich die schwere
goldene Krone auf ihren: Haupte
erstrahlt, sondern die auserkorene
reine, von Demuth erfüllte Jung-
frau Maria. Wie glücklich spricht
sich der Gegensatz zwischen der
„Mutter" Anna und der „jung-
fräuliche»" Gottesgebäreriu in den
beiden gleich künstlerisch wie religiös
tief empfundenen Erscheinungen aus!
„Gehet, ihr Lhristen, durch
freundliches Grün zum himmlischen
Wege", schrieb einmal Paulinus
von Nola über eine Thüre, die von
einen: Gartenweg aus zur Basilika
führte. Gemahnen uns nicht die
Reihen der Apostel auf unserem
Bilde an die Worte dieses heiligen
Bischofs? Bald einzeln, bald in
Gruppen zu zwei oder zu drei
schreiten die würdigen, ernsten Ge-
stalten gegen den thronenden Er-
löser hin. Das allen gleiche Habit
langer weißer Gewänder trägt zur
nöthigen ruhigen Wirkung bei, in
die nur die gelbliche Abtönung der
Schattenpartien, das lichte Karnat
der Köpfe und Hände und das
dezente Kolorit der Attribute eine
wohlthuende Abwechselung bringen.
Saftiges Grün belaubter Bäume
bildet den Hintergrund. Gerade in
den Aposteln nehmen wir eine von:
Künstler mit bestem Glück gewählte
’. wenig, Berchtesgaden.
3