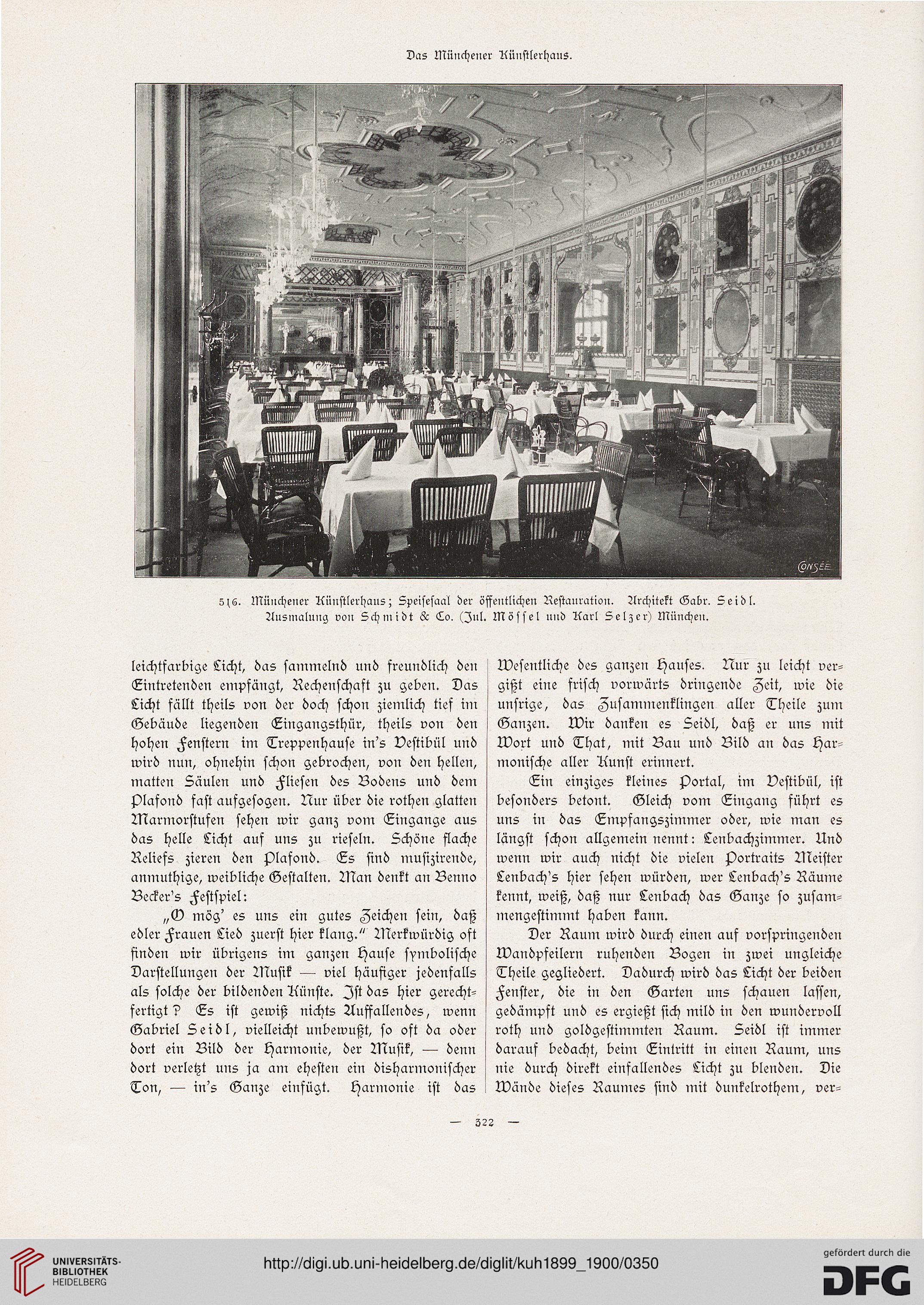Das Münchener Aünstlerhaus.
5^6. Münchener Ullnstlerhaus; Sxeisesaal der öffentlichen Restauration. Architekt Gabr. 5eidl.
Ausmalung von Schmidt 6c Lo. (Jul. Mössel und Karl Selz er) München.
leichtfarbige Licht, das sammelnd und freundlich den
Eintretenden empfängt, Rechenschaft zu geben. Das
Licht fällt theils von der doch schon ziemlich tief in:
Gebäude liegenden Eingangsthür, theils von den
hohen Fenstern im Treppenhaufe in's Vestibül und
wird nun, ohnehin schon gebrochen, von den Hellen,
matten Säulen und Fliesen des Bodens und dem
Plafond fast aufgesogen. Nur über die rothen glatten
Marmorstufen sehen wir ganz vom Eingänge aus
das Helle Licht auf uns zu rieseln. Schöne flache
Reliefs zieren den Plafond. Es find musizirende,
anmuthige, weibliche Gestalten. Man denkt an Benno J
Becker's Festspiel:
„CD mög' es uns ein gutes Zeichen fein, daß
edler Frauen Lied zuerst hier klang." Merkwürdig oft
finden wir übrigens im ganzen Pause symbolische
Darstellungen der Musik — viel häufiger jedenfalls
als solche der bildenden Aünste. Zst das hier gerecht-
fertigt ? Es ist gewiß nichts Auffallendes, wenn
Gabriel Seidl, vielleicht unbewußt, so oft da oder |
dort ein Bild der parmonie, der Musik, •— denn
dort verletzt uns ja am ehesten ein disharmonischer
Ton, — in's Ganze einfügt, parmonie ist das
Wesentliche des ganzen paufes. Nur zu leicht ver-
gißt eine frisch vorwärts dringende Zeit, wie die
unfrige, das Zusammenklingen aller Theile zum
Ganzen. Wir danken es Seidl, daß er uns mit
Wort und That, mit Bau und Bild an das par-
monifche aller Aunst erinnert.
Ein einziges kleines Portal, im Vestibül, ist
besonders betont. Gleich vom Eingang führt es
uns in das Empfangszimmer oder, wie man es
längst schon allgemein nennt: Lenbachzimmer. And
wenn wir auch nicht die vielen portraits Meister
Lenbach's hier sehen würden, wer Lenbach's Räume
kennt, weiß, daß nur Lenbach das Ganze so zusam-
mengestimmt haben kann.
Der Raum wird durch einen auf vorspringenden
Wandpfeilern ruhenden Bogen in zwei ungleiche
Theile gegliedert. Dadurch wird das Licht der beiden
Fenster, die in den Garten uns schauen lassen,
gedämpft und es ergießt sich mild in den wundervoll
roth und goldgestinnnten Raum. Seidl ist immer
darauf bedacht, beim Eintritt in einen Raum, uns
nie durch direkt einfallendes Licht zu blenden. Die
Wände dieses Raumes sind mit dunkelrothem, ver-
322
5^6. Münchener Ullnstlerhaus; Sxeisesaal der öffentlichen Restauration. Architekt Gabr. 5eidl.
Ausmalung von Schmidt 6c Lo. (Jul. Mössel und Karl Selz er) München.
leichtfarbige Licht, das sammelnd und freundlich den
Eintretenden empfängt, Rechenschaft zu geben. Das
Licht fällt theils von der doch schon ziemlich tief in:
Gebäude liegenden Eingangsthür, theils von den
hohen Fenstern im Treppenhaufe in's Vestibül und
wird nun, ohnehin schon gebrochen, von den Hellen,
matten Säulen und Fliesen des Bodens und dem
Plafond fast aufgesogen. Nur über die rothen glatten
Marmorstufen sehen wir ganz vom Eingänge aus
das Helle Licht auf uns zu rieseln. Schöne flache
Reliefs zieren den Plafond. Es find musizirende,
anmuthige, weibliche Gestalten. Man denkt an Benno J
Becker's Festspiel:
„CD mög' es uns ein gutes Zeichen fein, daß
edler Frauen Lied zuerst hier klang." Merkwürdig oft
finden wir übrigens im ganzen Pause symbolische
Darstellungen der Musik — viel häufiger jedenfalls
als solche der bildenden Aünste. Zst das hier gerecht-
fertigt ? Es ist gewiß nichts Auffallendes, wenn
Gabriel Seidl, vielleicht unbewußt, so oft da oder |
dort ein Bild der parmonie, der Musik, •— denn
dort verletzt uns ja am ehesten ein disharmonischer
Ton, — in's Ganze einfügt, parmonie ist das
Wesentliche des ganzen paufes. Nur zu leicht ver-
gißt eine frisch vorwärts dringende Zeit, wie die
unfrige, das Zusammenklingen aller Theile zum
Ganzen. Wir danken es Seidl, daß er uns mit
Wort und That, mit Bau und Bild an das par-
monifche aller Aunst erinnert.
Ein einziges kleines Portal, im Vestibül, ist
besonders betont. Gleich vom Eingang führt es
uns in das Empfangszimmer oder, wie man es
längst schon allgemein nennt: Lenbachzimmer. And
wenn wir auch nicht die vielen portraits Meister
Lenbach's hier sehen würden, wer Lenbach's Räume
kennt, weiß, daß nur Lenbach das Ganze so zusam-
mengestimmt haben kann.
Der Raum wird durch einen auf vorspringenden
Wandpfeilern ruhenden Bogen in zwei ungleiche
Theile gegliedert. Dadurch wird das Licht der beiden
Fenster, die in den Garten uns schauen lassen,
gedämpft und es ergießt sich mild in den wundervoll
roth und goldgestinnnten Raum. Seidl ist immer
darauf bedacht, beim Eintritt in einen Raum, uns
nie durch direkt einfallendes Licht zu blenden. Die
Wände dieses Raumes sind mit dunkelrothem, ver-
322