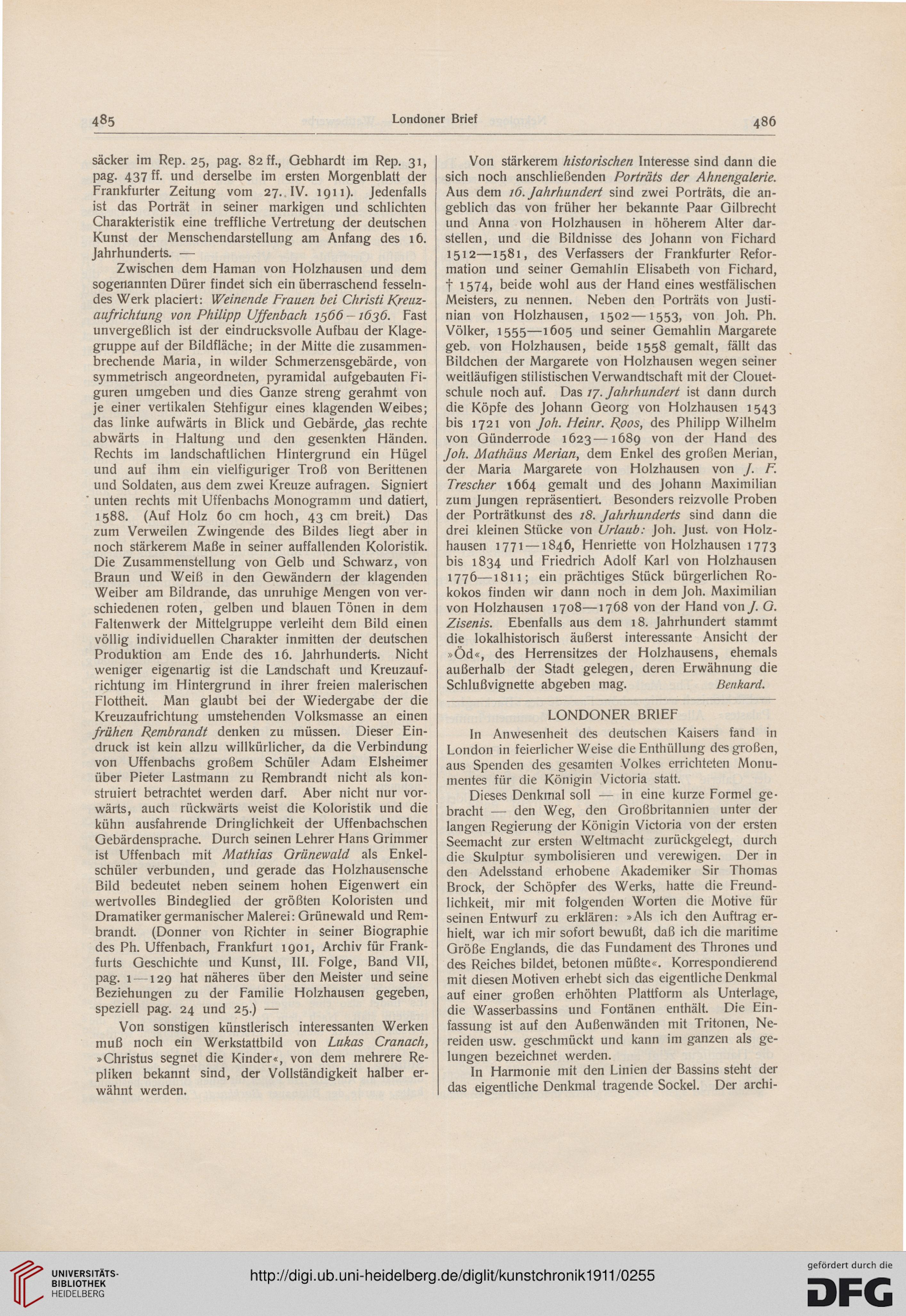485
Londoner Brief
486
säcker im Rep. 25, pag. 82 ff., Gebhardt im Rep. 31,
pag. 437 ff- und derselbe im ersten Morgenblatt der
Frankfurter Zeitung vom 27.. IV. 1911). Jedenfalls
ist das Porträt in seiner markigen und schlichten
Charakteristik eine treffliche Vertretung der deutschen
Kunst der Menschendarstellung am Anfang des 16.
Jahrhunderts. —
Zwischen dem Haman von Holzhausen und dem
sogenannten Dürer findet sich ein überraschend fesseln-
des Werk placiert: Weinende Frauen bei Christi Kreuz-
aufrichtung von Philipp Uffenbach 1566-1636. Fast
unvergeßlich ist der eindrucksvolle Aufbau der Klage-
gruppe auf der Bildfläche; in der Mitte die zusammen-
brechende Maria, in wilder Schmerzensgebärde, von
symmetrisch angeordneten, pyramidal aufgebauten Fi-
guren umgeben und dies Ganze streng gerahmt von
je einer vertikalen Stehfigur eines klagenden Weibes;
das linke aufwärts in Blick und Gebärde, _das rechte
abwärts in Haltung und den gesenkten Händen.
Rechts im landschaftlichen Hintergrund ein Hügel
und auf ihm ein vielfiguriger Troß von Berittenen
und Soldaten, aus dem zwei Kreuze aufragen. Signiert
unten rechts mit Uffenbachs Monogramm und datiert,
1588. (Auf Holz 60 cm hoch, 43 cm breit.) Das
zum Verweilen Zwingende des Bildes liegt aber in
noch stärkerem Maße in seiner auffallenden Koloristik.
Die Zusammenstellung von Gelb und Schwarz, von
Braun und Weiß in den Gewändern der klagenden
Weiber am Bildrande, das unruhige Mengen von ver-
schiedenen roten, gelben und blauen Tönen in dem
Faltenwerk der Mittelgruppe verleiht dem Bild einen
völlig individuellen Charakter inmitten der deutschen
Produktion am Ende des 16. Jahrhunderts. Nicht
weniger eigenartig ist die Landschaft und Kreuzauf-
richtung im Hintergrund in ihrer freien malerischen
Flottheit. Man glaubt bei der Wiedergabe der die
Kreuzaufrichtung umstehenden Volksmasse an einen
frühen Rembrandt denken zu müssen. Dieser Ein-
druck ist kein allzu willkürlicher, da die Verbindung
von Uffenbachs großem Schüler Adam Elsheimer
über Pieter Lastmann zu Rembrandt nicht als kon-
struiert betrachtet werden darf. Aber nicht nur vor-
wärts, auch rückwärts weist die Koloristik und die
kühn ausfahrende Dringlichkeit der Uffenbachschen
Gebärdensprache. Durch seinen Lehrer Hans Grimmer
ist Uffenbach mit Mathias Grunewald als Enkel-
schüler verbunden, und gerade das Holzhausensche
Bild bedeutet neben seinem hohen Eigenwert ein
wertvolles Bindeglied der größten Koloristen und
Dramatiker germanischer Malerei: Grünewald und Rem-
brandt. (Donner von Richter in Seiner Biographie
des Ph. Uffenbach, Frankfurt 1901, Archiv für Frank-
furts Geschichte und Kunst, III. Folge, Band VII,
pag. 1 —129 hat näheres über den Meister und seine
Beziehungen zu der Familie Holzhausen gegeben,
speziell pag. 24 und 25.) —
Von sonstigen künstlerisch interessanten Werken
muß noch ein Werkstattbild von Lukas Cranach,
»Christus segnet die Kinder«, von dem mehrere Re-
pliken bekannt sind, der Vollständigkeit halber er-
wähnt werden.
Von stärkerem historischen Interesse sind dann die
sich noch anschließenden Porträts der Ahnengalerie.
Aus dem 16. Jahrhundert sind zwei Porträts, die an-
geblich das von früher her bekannte Paar Gilbrecht
und Anna von Holzhausen in höherem Alter dar-
stellen, und die Bildnisse des Johann von Fichard
1512—1581, des Verfassers der Frankfurter Refor-
mation und seiner Gemahlin Elisabeth von Fichard,
t 1574, beide wohl aus der Hand eines westfälischen
Meisters, zu nennen. Neben den Porträts von Justi-
nian von Holzhausen, 1502—1553, von Joh. Ph.
Völker, 1555—1605 und seiner Gemahlin Margarete
geb. von Holzhausen, beide 1558 gemalt, fällt das
Bildchen der Margarete von Holzhausen wegen seiner
weitläufigen stilistischen Verwandtschaft mit der Clouet-
schule noch auf. Das 17. Jahrhundert ist dann durch
die Köpfe des Johann Georg von Holzhausen 1543
bis 1721 von Joh. Heinr. Roos, des Philipp Wilhelm
von Günderrode 1623—1689 von der Hand des
Joh. Mathäus Merlan, dem Enkel des großen Merian,
der Maria Margarete von Holzhausen von J. F.
Trescher 1664 gemalt und des Johann Maximilian
zum Jungen repräsentiert. Besonders reizvolle Proben
der Porträtkunst des 18. Jahrhunderts sind dann die
drei kleinen Stücke von Urlaub: Joh. Just, von Holz-
hausen 1771 —1846, Henriette von Holzhausen 1773
bis 1834 und Friedrich Adolf Karl von Holzhausen
1776—1811; ein prächtiges Stück bürgerlichen Ro-
kokos finden wir dann noch in dem Joh. Maximilian
von Holzhausen 1708—1768 von der Hand von J. G.
Zisenis. Ebenfalls aus dem 18. Jahrhundert stammt
die lokalhistorisch äußerst interessante Ansicht der
»Öd«, des Herrensitzes der Holzhausens, ehemals
außerhalb der Stadt gelegen, deren Erwähnung die
Schlußvignette abgeben mag. Benkard.
LONDONER BRIEF
In Anwesenheit des deutschen Kaisers fand in
London in feierlicher Weise die Enthüllung des großen,
aus Spenden des gesamten Volkes errichteten Monu-
mentes für die Königin Victoria statt.
Dieses Denkmal soll — in eine kurze Formel ge-
bracht — den Weg, den Großbritannien unter der
langen Regierung der Königin Victoria von der ersten
Seemacht zur ersten Weltmacht zurückgelegt, durch
die Skulptur symbolisieren und verewigen. Der in
den Adelsstand erhobene Akademiker Sir Thomas
Brock, der Schöpfer des Werks, hatte die Freund-
lichkeit, mir mit folgenden Worten die Motive für
seinen Entwurf zu erklären: »Als ich den Auftrag er-
hielt, war ich mir sofort bewußt, daß ich die maritime
Größe Englands, die das Fundament des Thrones und
des Reiches bildet, betonen müßte«. Korrespondierend
mit diesen Motiven erhebt sich das eigentliche Denkmal
auf einer großen erhöhten Plattform als Unterlage,
die Wasserbassins und Fontänen enthält. Die Ein-
fassung ist auf den Außenwänden mit Tritonen, Ne-
reiden usw. geschmückt und kann im ganzen als ge-
lungen bezeichnet werden.
In Harmonie mit den Linien der Bassins steht der
das eigentliche Denkmal tragende Sockel. Der archi-
Londoner Brief
486
säcker im Rep. 25, pag. 82 ff., Gebhardt im Rep. 31,
pag. 437 ff- und derselbe im ersten Morgenblatt der
Frankfurter Zeitung vom 27.. IV. 1911). Jedenfalls
ist das Porträt in seiner markigen und schlichten
Charakteristik eine treffliche Vertretung der deutschen
Kunst der Menschendarstellung am Anfang des 16.
Jahrhunderts. —
Zwischen dem Haman von Holzhausen und dem
sogenannten Dürer findet sich ein überraschend fesseln-
des Werk placiert: Weinende Frauen bei Christi Kreuz-
aufrichtung von Philipp Uffenbach 1566-1636. Fast
unvergeßlich ist der eindrucksvolle Aufbau der Klage-
gruppe auf der Bildfläche; in der Mitte die zusammen-
brechende Maria, in wilder Schmerzensgebärde, von
symmetrisch angeordneten, pyramidal aufgebauten Fi-
guren umgeben und dies Ganze streng gerahmt von
je einer vertikalen Stehfigur eines klagenden Weibes;
das linke aufwärts in Blick und Gebärde, _das rechte
abwärts in Haltung und den gesenkten Händen.
Rechts im landschaftlichen Hintergrund ein Hügel
und auf ihm ein vielfiguriger Troß von Berittenen
und Soldaten, aus dem zwei Kreuze aufragen. Signiert
unten rechts mit Uffenbachs Monogramm und datiert,
1588. (Auf Holz 60 cm hoch, 43 cm breit.) Das
zum Verweilen Zwingende des Bildes liegt aber in
noch stärkerem Maße in seiner auffallenden Koloristik.
Die Zusammenstellung von Gelb und Schwarz, von
Braun und Weiß in den Gewändern der klagenden
Weiber am Bildrande, das unruhige Mengen von ver-
schiedenen roten, gelben und blauen Tönen in dem
Faltenwerk der Mittelgruppe verleiht dem Bild einen
völlig individuellen Charakter inmitten der deutschen
Produktion am Ende des 16. Jahrhunderts. Nicht
weniger eigenartig ist die Landschaft und Kreuzauf-
richtung im Hintergrund in ihrer freien malerischen
Flottheit. Man glaubt bei der Wiedergabe der die
Kreuzaufrichtung umstehenden Volksmasse an einen
frühen Rembrandt denken zu müssen. Dieser Ein-
druck ist kein allzu willkürlicher, da die Verbindung
von Uffenbachs großem Schüler Adam Elsheimer
über Pieter Lastmann zu Rembrandt nicht als kon-
struiert betrachtet werden darf. Aber nicht nur vor-
wärts, auch rückwärts weist die Koloristik und die
kühn ausfahrende Dringlichkeit der Uffenbachschen
Gebärdensprache. Durch seinen Lehrer Hans Grimmer
ist Uffenbach mit Mathias Grunewald als Enkel-
schüler verbunden, und gerade das Holzhausensche
Bild bedeutet neben seinem hohen Eigenwert ein
wertvolles Bindeglied der größten Koloristen und
Dramatiker germanischer Malerei: Grünewald und Rem-
brandt. (Donner von Richter in Seiner Biographie
des Ph. Uffenbach, Frankfurt 1901, Archiv für Frank-
furts Geschichte und Kunst, III. Folge, Band VII,
pag. 1 —129 hat näheres über den Meister und seine
Beziehungen zu der Familie Holzhausen gegeben,
speziell pag. 24 und 25.) —
Von sonstigen künstlerisch interessanten Werken
muß noch ein Werkstattbild von Lukas Cranach,
»Christus segnet die Kinder«, von dem mehrere Re-
pliken bekannt sind, der Vollständigkeit halber er-
wähnt werden.
Von stärkerem historischen Interesse sind dann die
sich noch anschließenden Porträts der Ahnengalerie.
Aus dem 16. Jahrhundert sind zwei Porträts, die an-
geblich das von früher her bekannte Paar Gilbrecht
und Anna von Holzhausen in höherem Alter dar-
stellen, und die Bildnisse des Johann von Fichard
1512—1581, des Verfassers der Frankfurter Refor-
mation und seiner Gemahlin Elisabeth von Fichard,
t 1574, beide wohl aus der Hand eines westfälischen
Meisters, zu nennen. Neben den Porträts von Justi-
nian von Holzhausen, 1502—1553, von Joh. Ph.
Völker, 1555—1605 und seiner Gemahlin Margarete
geb. von Holzhausen, beide 1558 gemalt, fällt das
Bildchen der Margarete von Holzhausen wegen seiner
weitläufigen stilistischen Verwandtschaft mit der Clouet-
schule noch auf. Das 17. Jahrhundert ist dann durch
die Köpfe des Johann Georg von Holzhausen 1543
bis 1721 von Joh. Heinr. Roos, des Philipp Wilhelm
von Günderrode 1623—1689 von der Hand des
Joh. Mathäus Merlan, dem Enkel des großen Merian,
der Maria Margarete von Holzhausen von J. F.
Trescher 1664 gemalt und des Johann Maximilian
zum Jungen repräsentiert. Besonders reizvolle Proben
der Porträtkunst des 18. Jahrhunderts sind dann die
drei kleinen Stücke von Urlaub: Joh. Just, von Holz-
hausen 1771 —1846, Henriette von Holzhausen 1773
bis 1834 und Friedrich Adolf Karl von Holzhausen
1776—1811; ein prächtiges Stück bürgerlichen Ro-
kokos finden wir dann noch in dem Joh. Maximilian
von Holzhausen 1708—1768 von der Hand von J. G.
Zisenis. Ebenfalls aus dem 18. Jahrhundert stammt
die lokalhistorisch äußerst interessante Ansicht der
»Öd«, des Herrensitzes der Holzhausens, ehemals
außerhalb der Stadt gelegen, deren Erwähnung die
Schlußvignette abgeben mag. Benkard.
LONDONER BRIEF
In Anwesenheit des deutschen Kaisers fand in
London in feierlicher Weise die Enthüllung des großen,
aus Spenden des gesamten Volkes errichteten Monu-
mentes für die Königin Victoria statt.
Dieses Denkmal soll — in eine kurze Formel ge-
bracht — den Weg, den Großbritannien unter der
langen Regierung der Königin Victoria von der ersten
Seemacht zur ersten Weltmacht zurückgelegt, durch
die Skulptur symbolisieren und verewigen. Der in
den Adelsstand erhobene Akademiker Sir Thomas
Brock, der Schöpfer des Werks, hatte die Freund-
lichkeit, mir mit folgenden Worten die Motive für
seinen Entwurf zu erklären: »Als ich den Auftrag er-
hielt, war ich mir sofort bewußt, daß ich die maritime
Größe Englands, die das Fundament des Thrones und
des Reiches bildet, betonen müßte«. Korrespondierend
mit diesen Motiven erhebt sich das eigentliche Denkmal
auf einer großen erhöhten Plattform als Unterlage,
die Wasserbassins und Fontänen enthält. Die Ein-
fassung ist auf den Außenwänden mit Tritonen, Ne-
reiden usw. geschmückt und kann im ganzen als ge-
lungen bezeichnet werden.
In Harmonie mit den Linien der Bassins steht der
das eigentliche Denkmal tragende Sockel. Der archi-