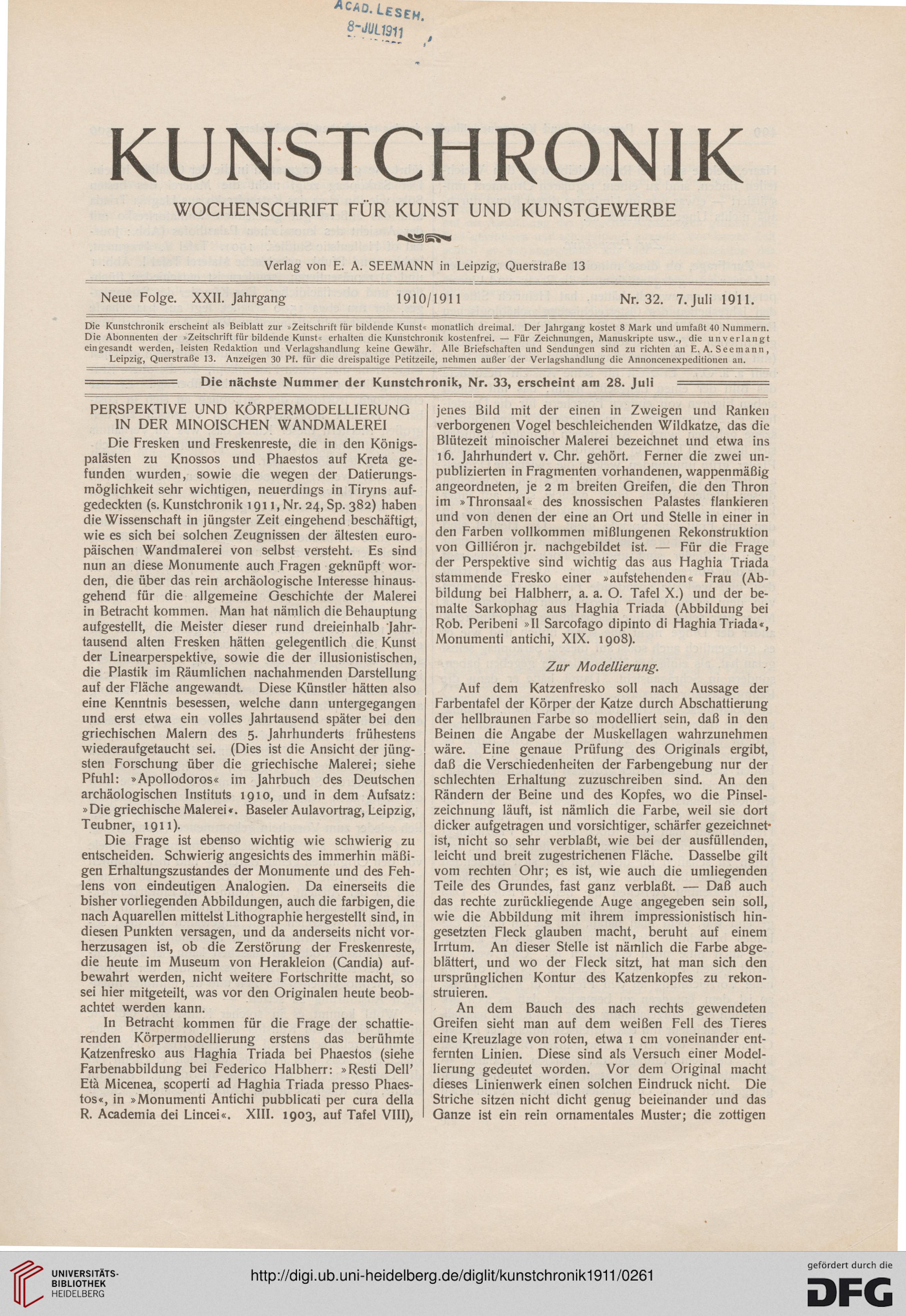8-JUU91J ,
KUNSTCHRONIK
WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE
Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig, Querstraße 13
Neue Folge. XXII. Jahrgang 1910/1911 Nr. 32. 7. Juli 1911.
Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur »Zeitschrift für bildende Kunst« monatlich dreimal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfaßt 40 Nummern.
Die Abonnenten der »Zeitschrift für bildende Kunst« erhalten die Kunstchronik kostenfrei. — Für Zeichnungen, Manuskripte usw., die unverlangt
eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E.A.Seemann,
Leipzig, Querstraße 13. Anzeigen 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen an.
Die nächste Nummer der Kunstchronik, Nr. 33, erscheint am 28. Juli
PERSPEKTIVE UND KÖRPERMODELLIERUNG
IN DER MINOISCHEN WANDMALEREI
Die Fresken und Freskenreste, die in den Königs-
palästen zu Knossos und Phaestos auf Kreta ge-
funden wurden, sowie die wegen der Datierungs-
möglichkeit sehr wichtigen, neuerdings in Tiryns auf-
gedeckten (s. Kunstchronik 191t, Nr. 24, Sp. 382) haben
die Wissenschaft in jüngster Zeit eingehend beschäftigt,
wie es sich bei solchen Zeugnissen der ältesten euro-
päischen Wandmalerei von selbst versteht. Es sind
nun an diese Monumente auch Fragen geknüpft wor-
den, die über das rein archäologische Interesse hinaus-
gehend für die allgemeine Geschichte der Malerei
in Betracht kommen. Man hat nämlich die Behauptung
aufgestellt, die Meister dieser rund dreieinhalb Jahr-
tausend alten Fresken hätten gelegentlich die Kunst
der Linearperspektive, sowie die der illusionistischen,
die Plastik im Räumlichen nachahmenden Darstellung
auf der Fläche angewandt. Diese Künstler hätten also
eine Kenntnis besessen, welche dann untergegangen
und erst etwa ein volles Jahrtausend später bei den
griechischen Malern des 5. Jahrhunderts frühestens
wiederaufgetaucht sei. (Dies ist die Ansicht der jüng-
sten Forschung über die griechische Malerei; siehe
Pfuhl: »Apollodoros« im Jahrbuch des Deutschen
archäologischen Instituts 1910, und in dem Aufsatz:
»Die griechische Malerei«. Baseler Aulavortrag, Leipzig,
Teubner, 1911).
Die Frage ist ebenso wichtig wie schwierig zu
entscheiden. Schwierig angesichts des immerhin mäßi-
gen Erhaltungszustandes der Monumente und des Feh-
lens von eindeutigen Analogien. Da einerseits die
bisher vorliegenden Abbildungen, auch die farbigen, die
nach Aquarellen mittelst Lithographie hergestellt sind, in
diesen Punkten versagen, und da anderseits nicht vor-
herzusagen ist, ob die Zerstörung der Freskenreste,
die heute im Museum von Herakleion (Candia) auf-
bewahrt werden, nicht weitere Fortschritte macht, so
sei hier mitgeteilt, was vor den Originalen heute beob-
achtet werden kann.
In Betracht kommen für die Frage der schattie-
renden Körpermodellierung erstens das berühmte
Katzenfresko aus Haghia Triada bei Phaestos (siehe
Farbenabbildung bei Federico Halbherr: »Resti Dell'
Etä Micenea, scoperti ad Haghia Triada presso Phaes-
tos«, in »Monumenti Antichi pubblicati per cura della
R. Academia dei Lincei«. XIII. 1903, auf Tafel VIII),
jenes Bild mit der einen in Zweigen und Ranken
verborgenen Vogel beschleichenden Wildkatze, das die
Blütezeit minoischer Malerei bezeichnet und etwa ins
16. Jahrhundert v. Chr. gehört. Ferner die zwei un-
publizierten in Fragmenten vorhandenen, wappenmäßig
angeordneten, je 2 m breiten Greifen, die den Thron
im »Thronsaal« des knossischen Palastes flankieren
und von denen der eine an Ort und Stelle in einer in
den Farben vollkommen mißlungenen Rekonstruktion
von Gillieron jr. nachgebildet ist. — Für die Frage
der Perspektive sind wichtig das aus Haghia Triada
stammende Fresko einer »aufstehenden« Frau (Ab-
bildung bei Halbherr, a. a. O. Tafel X.) und der be-
malte Sarkophag aus Haghia Triada (Abbildung bei
Rob. Peribeni »II Sarcofago dipinto di Haghia Triada«,
Monumenti antichi, XIX. 1908).
Zur Modellierung.
Auf dem Katzenfresko soll nach Aussage der
Farbentafel der Körper der Katze durch Abschattierung
der hellbraunen Farbe so modelliert sein, daß in den
Beinen die Angabe der Muskellagen wahrzunehmen
wäre. Eine genaue Prüfung des Originals ergibt,
daß die Verschiedenheiten der Farbengebung nur der
schlechten Erhaltung zuzuschreiben sind. An den
Rändern der Beine und des Kopfes, wo die Pinsel-
zeichnung läuft, ist nämlich die Farbe, weil sie dort
dicker aufgetragen und vorsichtiger, schärfer gezeichnet-
ist, nicht so sehr verblaßt, wie bei der ausfüllenden,
leicht und breit zugestrichenen Fläche. Dasselbe gilt
vom rechten Ohr; es ist, wie auch die umliegenden
Teile des Grundes, fast ganz verblaßt. — Daß auch
das rechte zurückliegende Auge angegeben sein soll,
wie die Abbildung mit ihrem impressionistisch hin-
gesetzten Fleck glauben macht, beruht auf einem
Irrtum. An dieser Stelle ist nämlich die Farbe abge-
blättert, und wo der Fleck sitzt, hat man sich den
ursprünglichen Kontur des Katzenkopfes zu rekon-
struieren.
An dem Bauch des nach rechts gewendeten
Greifen sieht man auf dem weißen Fell des Tieres
eine Kreuzlage von roten, etwa 1 cm voneinander ent-
fernten Linien. Diese sind als Versuch einer Model-
lierung gedeutet worden. Vor dem Original macht
dieses Linienwerk einen solchen Eindruck nicht. Die
Striche sitzen nicht dicht genug beieinander und das
Ganze ist ein rein ornamentales Muster; die zottigen
KUNSTCHRONIK
WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE
Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig, Querstraße 13
Neue Folge. XXII. Jahrgang 1910/1911 Nr. 32. 7. Juli 1911.
Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur »Zeitschrift für bildende Kunst« monatlich dreimal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfaßt 40 Nummern.
Die Abonnenten der »Zeitschrift für bildende Kunst« erhalten die Kunstchronik kostenfrei. — Für Zeichnungen, Manuskripte usw., die unverlangt
eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E.A.Seemann,
Leipzig, Querstraße 13. Anzeigen 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen an.
Die nächste Nummer der Kunstchronik, Nr. 33, erscheint am 28. Juli
PERSPEKTIVE UND KÖRPERMODELLIERUNG
IN DER MINOISCHEN WANDMALEREI
Die Fresken und Freskenreste, die in den Königs-
palästen zu Knossos und Phaestos auf Kreta ge-
funden wurden, sowie die wegen der Datierungs-
möglichkeit sehr wichtigen, neuerdings in Tiryns auf-
gedeckten (s. Kunstchronik 191t, Nr. 24, Sp. 382) haben
die Wissenschaft in jüngster Zeit eingehend beschäftigt,
wie es sich bei solchen Zeugnissen der ältesten euro-
päischen Wandmalerei von selbst versteht. Es sind
nun an diese Monumente auch Fragen geknüpft wor-
den, die über das rein archäologische Interesse hinaus-
gehend für die allgemeine Geschichte der Malerei
in Betracht kommen. Man hat nämlich die Behauptung
aufgestellt, die Meister dieser rund dreieinhalb Jahr-
tausend alten Fresken hätten gelegentlich die Kunst
der Linearperspektive, sowie die der illusionistischen,
die Plastik im Räumlichen nachahmenden Darstellung
auf der Fläche angewandt. Diese Künstler hätten also
eine Kenntnis besessen, welche dann untergegangen
und erst etwa ein volles Jahrtausend später bei den
griechischen Malern des 5. Jahrhunderts frühestens
wiederaufgetaucht sei. (Dies ist die Ansicht der jüng-
sten Forschung über die griechische Malerei; siehe
Pfuhl: »Apollodoros« im Jahrbuch des Deutschen
archäologischen Instituts 1910, und in dem Aufsatz:
»Die griechische Malerei«. Baseler Aulavortrag, Leipzig,
Teubner, 1911).
Die Frage ist ebenso wichtig wie schwierig zu
entscheiden. Schwierig angesichts des immerhin mäßi-
gen Erhaltungszustandes der Monumente und des Feh-
lens von eindeutigen Analogien. Da einerseits die
bisher vorliegenden Abbildungen, auch die farbigen, die
nach Aquarellen mittelst Lithographie hergestellt sind, in
diesen Punkten versagen, und da anderseits nicht vor-
herzusagen ist, ob die Zerstörung der Freskenreste,
die heute im Museum von Herakleion (Candia) auf-
bewahrt werden, nicht weitere Fortschritte macht, so
sei hier mitgeteilt, was vor den Originalen heute beob-
achtet werden kann.
In Betracht kommen für die Frage der schattie-
renden Körpermodellierung erstens das berühmte
Katzenfresko aus Haghia Triada bei Phaestos (siehe
Farbenabbildung bei Federico Halbherr: »Resti Dell'
Etä Micenea, scoperti ad Haghia Triada presso Phaes-
tos«, in »Monumenti Antichi pubblicati per cura della
R. Academia dei Lincei«. XIII. 1903, auf Tafel VIII),
jenes Bild mit der einen in Zweigen und Ranken
verborgenen Vogel beschleichenden Wildkatze, das die
Blütezeit minoischer Malerei bezeichnet und etwa ins
16. Jahrhundert v. Chr. gehört. Ferner die zwei un-
publizierten in Fragmenten vorhandenen, wappenmäßig
angeordneten, je 2 m breiten Greifen, die den Thron
im »Thronsaal« des knossischen Palastes flankieren
und von denen der eine an Ort und Stelle in einer in
den Farben vollkommen mißlungenen Rekonstruktion
von Gillieron jr. nachgebildet ist. — Für die Frage
der Perspektive sind wichtig das aus Haghia Triada
stammende Fresko einer »aufstehenden« Frau (Ab-
bildung bei Halbherr, a. a. O. Tafel X.) und der be-
malte Sarkophag aus Haghia Triada (Abbildung bei
Rob. Peribeni »II Sarcofago dipinto di Haghia Triada«,
Monumenti antichi, XIX. 1908).
Zur Modellierung.
Auf dem Katzenfresko soll nach Aussage der
Farbentafel der Körper der Katze durch Abschattierung
der hellbraunen Farbe so modelliert sein, daß in den
Beinen die Angabe der Muskellagen wahrzunehmen
wäre. Eine genaue Prüfung des Originals ergibt,
daß die Verschiedenheiten der Farbengebung nur der
schlechten Erhaltung zuzuschreiben sind. An den
Rändern der Beine und des Kopfes, wo die Pinsel-
zeichnung läuft, ist nämlich die Farbe, weil sie dort
dicker aufgetragen und vorsichtiger, schärfer gezeichnet-
ist, nicht so sehr verblaßt, wie bei der ausfüllenden,
leicht und breit zugestrichenen Fläche. Dasselbe gilt
vom rechten Ohr; es ist, wie auch die umliegenden
Teile des Grundes, fast ganz verblaßt. — Daß auch
das rechte zurückliegende Auge angegeben sein soll,
wie die Abbildung mit ihrem impressionistisch hin-
gesetzten Fleck glauben macht, beruht auf einem
Irrtum. An dieser Stelle ist nämlich die Farbe abge-
blättert, und wo der Fleck sitzt, hat man sich den
ursprünglichen Kontur des Katzenkopfes zu rekon-
struieren.
An dem Bauch des nach rechts gewendeten
Greifen sieht man auf dem weißen Fell des Tieres
eine Kreuzlage von roten, etwa 1 cm voneinander ent-
fernten Linien. Diese sind als Versuch einer Model-
lierung gedeutet worden. Vor dem Original macht
dieses Linienwerk einen solchen Eindruck nicht. Die
Striche sitzen nicht dicht genug beieinander und das
Ganze ist ein rein ornamentales Muster; die zottigen