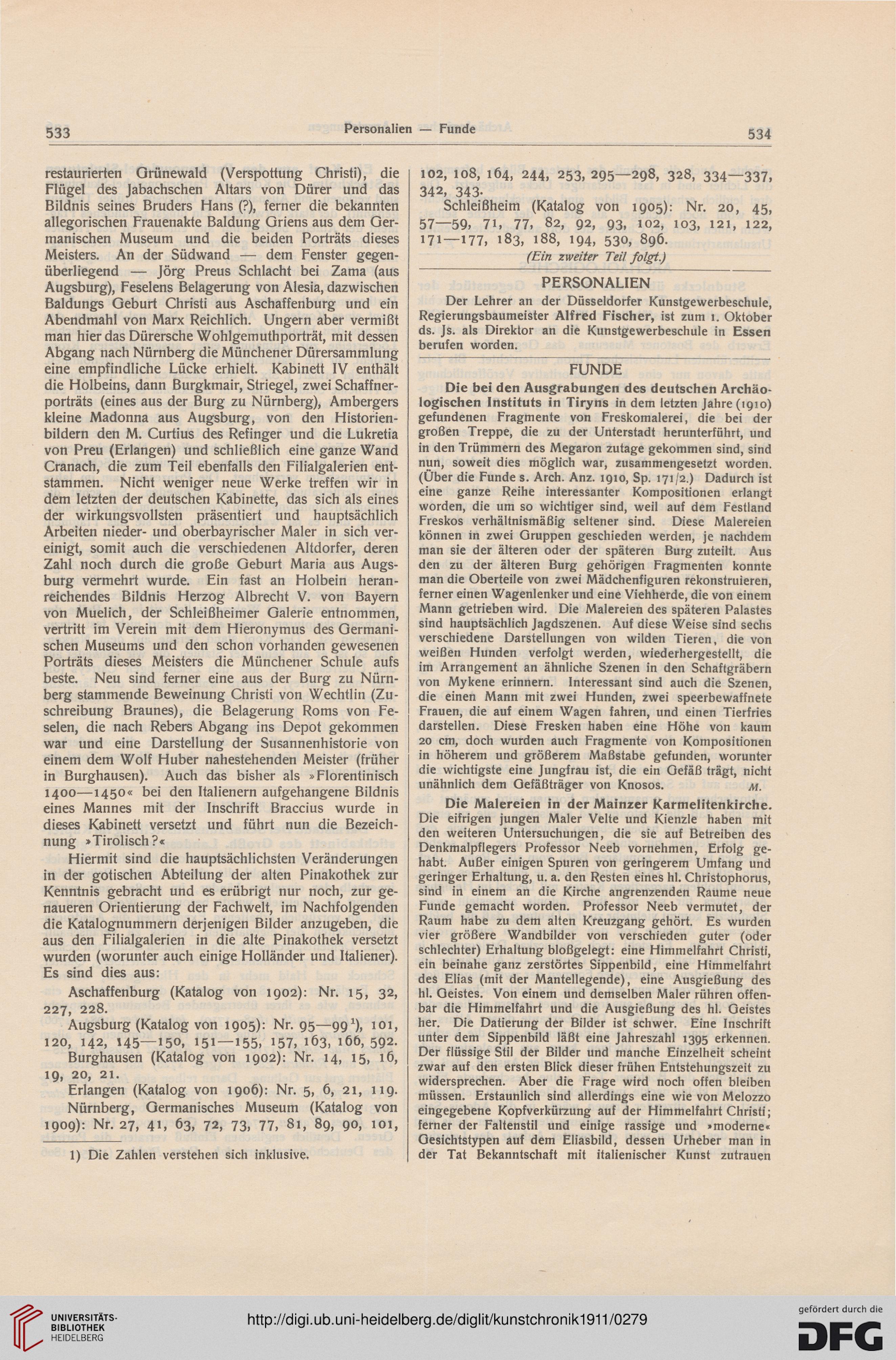533
Personalien — Funde
534
restaurierten Grünewald (Verspottung Christi), die
Flügel des Jabachschen Altars von Dürer und das
Bildnis seines Bruders Hans (?), ferner die bekannten
allegorischen Frauenakte Baidung Griens aus dem Ger-
manischen Museum und die beiden Porträts dieses
Meisters. An der Südwand — dem Fenster gegen-
überliegend — Jörg Preus Schlacht bei Zama (aus
Augsburg), Feselens Belagerung von Alesia, dazwischen
Baidungs Geburt Christi aus Aschaffenburg und ein
Abendmahl von Marx Reichlich. Ungern aber vermißt
man hier das Dürersche Wohlgemuthporträt, mit dessen
Abgang nach Nürnberg die Münchener Dürersammlung
eine empfindliche Lücke erhielt. Kabinett IV enthält
die Holbeins, dann Burgkmair, Striegel, zwei Schaffner-
porträts (eines aus der Burg zu Nürnberg), Ambergers
kleine Madonna aus Augsburg, von den Historien-
bildern den M. Curtius des Refinger und die Lukretia
von Preu (Erlangen) und schließlich eine ganze Wand
Cranach, die zum Teil ebenfalls den Filialgalerien ent-
stammen. Nicht weniger neue Werke treffen wir in
dem letzten der deutschen Kabinette, das sich als eines
der wirkungsvollsten präsentiert und hauptsächlich
Arbeiten nieder- und oberbayrischer Maler in sich ver-
einigt, somit auch die verschiedenen Altdorfer, deren
Zahl noch durch die große Geburt Maria aus Augs-
burg vermehrt wurde. Ein fast an Holbein heran-
reichendes Bildnis Herzog Albrecht V. von Bayern
von Muelich, der Schleißheimer Galerie entnommen,
vertritt im Verein mit dem Hieronymus des Germani-
schen Museums und den schon vorhanden gewesenen
Porträts dieses Meisters die Münchener Schule aufs
beste. Neu sind ferner eine aus der Burg zu Nürn-
berg stammende Beweinung Christi von Wechtlin (Zu-
schreibung Braunes), die Belagerung Roms von Fe-
selen, die nach Rebers Abgang ins Depot gekommen
war und eine Darstellung der Susannenhistorie von
einem dem Wolf Huber nahestehenden Meister (früher
in Burghausen). Auch das bisher als »Florentinisch
1400—1450« bei den Italienern aufgehangene Bildnis
eines Mannes mit der Inschrift Braccius wurde in
dieses Kabinett versetzt und führt nun die Bezeich-
nung »Tirolisch?«
Hiermit sind die hauptsächlichsten Veränderungen
in der gotischen Abteilung der alten Pinakothek zur
Kenntnis gebracht und es erübrigt nur noch, zur ge-
naueren Orientierung der Fachwelt, im Nachfolgenden
die Katalognummern derjenigen Bilder anzugeben, die
aus den Filialgalerien in die alte Pinakothek versetzt
wurden (worunter auch einige Holländer und Italiener).
Es sind dies aus:
Aschaffenburg (Katalog von 1902): Nr. 15, 32,
227, 228.
Augsburg (Katalog von 1905): Nr. 95—991), 101.
120, 142, 145—150, 151—155. 157, 163, 166, 592.
Burghausen (Katalog von 1902): Nr. 14, 15, 16,
19, 20, 21.
Erlangen (Katalog von 1906): Nr. 5, 6, 21, 119.
Nürnberg, Germanisches Museum (Katalog von
1909): Nr. 27, 41, 63, 72, 73. 77, 81, 89, 90, 101,
1) Die Zahlen verstehen sich inklusive.
102, 108, 164, 244, 253, 295—298, 328, 334—337,
342, 343-
Schleißheim (Katalog von 1905): Nr. 20, 45,
57—59, 71, 77, 82, 92, 93, 102, 103, 121, 122,
171—177, 183, 188, 194, 530, 896.
(Ein zweiter Teil folgt.)
PERSONALIEN
Der Lehrer an der Düsseldorfer Kunstgewerbeschule,
Regierungsbaumeister Alfred Fischer, ist zum r. Oktober
ds. Js. als Direktor an die Kunstgewerbeschule in Essen
berufen worden.
FUNDE
Die bei den Ausgrabungen des deutschen Archäo-
logischen Instituts in Tiryns in dem letzten Jahre (1910)
gefundenen Fragmente von Freskomalerei, die bei der
großen Treppe, die zu der Unterstadt herunterführt, und
in den Trümmern des Megaron zutage gekommen sind, sind
nun, soweit dies möglich war, zusammengesetzt worden.
(Über die Funde s. Arch. Anz. 1910, Sp. 171/2.) Dadurch ist
eine ganze Reihe interessanter Kompositionen erlangt
worden, die um so wichtiger sind, weil auf dem Festland
Freskos verhältnismäßig seltener sind. Diese Malereien
können in zwei Gruppen geschieden werden, je nachdem
man sie der älteren oder der späteren Burg zuteilt. Aus
den zu der älteren Burg gehörigen Fragmenten konnte
man die Oberteile von zwei Mädchenfiguren rekonstruieren,
ferner einen Wagenlenker und eine Viehherde, die von einem
Mann getrieben wird. Die Malereien des späteren Palastes
sind hauptsächlich Jagdszenen. Auf diese Weise sind sechs
verschiedene Darstellungen von wilden Tieren, die von
weißen Hunden verfolgt werden, wiederhergestellt, die
im Arrangement an ähnliche Szenen in den Schaftgräbern
von Mykene erinnern. Interessant sind auch die Szenen,
die einen Mann mit zwei Hunden, zwei speerbewaffnete
Frauen, die auf einem Wagen fahren, und einen Tierfries
darstellen. Diese Fresken haben eine Höhe von kaum
20 cm, doch wurden auch Fragmente von Kompositionen
in höherem und größerem Maßstabe gefunden, worunter
die wichtigste eine Jungfrau ist, die ein Oefäß trägt, nicht
unähnlich dem Oefäßträger von Knosos. m.
Die Malereien in der Mainzer Karmelitenkirche.
Die eifrigen jungen Maler Veite und Kienzle haben mit
den weiteren Untersuchungen, die sie auf Betreiben des
Denkmalpflegers Professor Neeb vornehmen, Erfolg ge-
habt. Außer einigen Spuren von geringerem Umfang und
geringer Erhaltung, u. a. den Resten eines hl. Christopherus,
sind in einem an die Kirche angrenzenden Räume neue
Funde gemacht worden. Professor Neeb vermutet, der
Raum habe zu dem alten Kreuzgang gehört. Es wurden
vier größere Wandbilder von verschieden guter (oder
schlechter) Erhaltung bloßgelegt: eine Himmelfahrt Christi,
ein beinahe ganz zerstörtes Sippenbild, eine Himmelfahrt
des Elias (mit der Mantellegende), eine Ausgießung des
hl. Oeistes. Von einem und demselben Maler rühren offen-
bar die Himmelfahrt und die Ausgießung des hl. Oeistes
her. Die Datierung der Bilder ist schwer. Eine Inschrift
unter dem Sippenbild läßt eine Jahreszahl 1395 erkennen.
Der flüssige Stil der Bilder und manche Einzelheit scheint
zwar auf den ersten Blick dieser frühen Entstehungszeit zu
widersprechen. Aber die Frage wird noch offen bleiben
müssen. Erstaunlich sind allerdings eine wie von Melozzo
eingegebene Kopfverkürzung auf der Himmelfahrt Christi;
ferner der Faltenstil und einige rassige und »moderne«
Oesichtstypen auf dem Eliasbild, dessen Urheber man in
der Tat Bekanntschaft mit italienischer Kunst zutrauen
Personalien — Funde
534
restaurierten Grünewald (Verspottung Christi), die
Flügel des Jabachschen Altars von Dürer und das
Bildnis seines Bruders Hans (?), ferner die bekannten
allegorischen Frauenakte Baidung Griens aus dem Ger-
manischen Museum und die beiden Porträts dieses
Meisters. An der Südwand — dem Fenster gegen-
überliegend — Jörg Preus Schlacht bei Zama (aus
Augsburg), Feselens Belagerung von Alesia, dazwischen
Baidungs Geburt Christi aus Aschaffenburg und ein
Abendmahl von Marx Reichlich. Ungern aber vermißt
man hier das Dürersche Wohlgemuthporträt, mit dessen
Abgang nach Nürnberg die Münchener Dürersammlung
eine empfindliche Lücke erhielt. Kabinett IV enthält
die Holbeins, dann Burgkmair, Striegel, zwei Schaffner-
porträts (eines aus der Burg zu Nürnberg), Ambergers
kleine Madonna aus Augsburg, von den Historien-
bildern den M. Curtius des Refinger und die Lukretia
von Preu (Erlangen) und schließlich eine ganze Wand
Cranach, die zum Teil ebenfalls den Filialgalerien ent-
stammen. Nicht weniger neue Werke treffen wir in
dem letzten der deutschen Kabinette, das sich als eines
der wirkungsvollsten präsentiert und hauptsächlich
Arbeiten nieder- und oberbayrischer Maler in sich ver-
einigt, somit auch die verschiedenen Altdorfer, deren
Zahl noch durch die große Geburt Maria aus Augs-
burg vermehrt wurde. Ein fast an Holbein heran-
reichendes Bildnis Herzog Albrecht V. von Bayern
von Muelich, der Schleißheimer Galerie entnommen,
vertritt im Verein mit dem Hieronymus des Germani-
schen Museums und den schon vorhanden gewesenen
Porträts dieses Meisters die Münchener Schule aufs
beste. Neu sind ferner eine aus der Burg zu Nürn-
berg stammende Beweinung Christi von Wechtlin (Zu-
schreibung Braunes), die Belagerung Roms von Fe-
selen, die nach Rebers Abgang ins Depot gekommen
war und eine Darstellung der Susannenhistorie von
einem dem Wolf Huber nahestehenden Meister (früher
in Burghausen). Auch das bisher als »Florentinisch
1400—1450« bei den Italienern aufgehangene Bildnis
eines Mannes mit der Inschrift Braccius wurde in
dieses Kabinett versetzt und führt nun die Bezeich-
nung »Tirolisch?«
Hiermit sind die hauptsächlichsten Veränderungen
in der gotischen Abteilung der alten Pinakothek zur
Kenntnis gebracht und es erübrigt nur noch, zur ge-
naueren Orientierung der Fachwelt, im Nachfolgenden
die Katalognummern derjenigen Bilder anzugeben, die
aus den Filialgalerien in die alte Pinakothek versetzt
wurden (worunter auch einige Holländer und Italiener).
Es sind dies aus:
Aschaffenburg (Katalog von 1902): Nr. 15, 32,
227, 228.
Augsburg (Katalog von 1905): Nr. 95—991), 101.
120, 142, 145—150, 151—155. 157, 163, 166, 592.
Burghausen (Katalog von 1902): Nr. 14, 15, 16,
19, 20, 21.
Erlangen (Katalog von 1906): Nr. 5, 6, 21, 119.
Nürnberg, Germanisches Museum (Katalog von
1909): Nr. 27, 41, 63, 72, 73. 77, 81, 89, 90, 101,
1) Die Zahlen verstehen sich inklusive.
102, 108, 164, 244, 253, 295—298, 328, 334—337,
342, 343-
Schleißheim (Katalog von 1905): Nr. 20, 45,
57—59, 71, 77, 82, 92, 93, 102, 103, 121, 122,
171—177, 183, 188, 194, 530, 896.
(Ein zweiter Teil folgt.)
PERSONALIEN
Der Lehrer an der Düsseldorfer Kunstgewerbeschule,
Regierungsbaumeister Alfred Fischer, ist zum r. Oktober
ds. Js. als Direktor an die Kunstgewerbeschule in Essen
berufen worden.
FUNDE
Die bei den Ausgrabungen des deutschen Archäo-
logischen Instituts in Tiryns in dem letzten Jahre (1910)
gefundenen Fragmente von Freskomalerei, die bei der
großen Treppe, die zu der Unterstadt herunterführt, und
in den Trümmern des Megaron zutage gekommen sind, sind
nun, soweit dies möglich war, zusammengesetzt worden.
(Über die Funde s. Arch. Anz. 1910, Sp. 171/2.) Dadurch ist
eine ganze Reihe interessanter Kompositionen erlangt
worden, die um so wichtiger sind, weil auf dem Festland
Freskos verhältnismäßig seltener sind. Diese Malereien
können in zwei Gruppen geschieden werden, je nachdem
man sie der älteren oder der späteren Burg zuteilt. Aus
den zu der älteren Burg gehörigen Fragmenten konnte
man die Oberteile von zwei Mädchenfiguren rekonstruieren,
ferner einen Wagenlenker und eine Viehherde, die von einem
Mann getrieben wird. Die Malereien des späteren Palastes
sind hauptsächlich Jagdszenen. Auf diese Weise sind sechs
verschiedene Darstellungen von wilden Tieren, die von
weißen Hunden verfolgt werden, wiederhergestellt, die
im Arrangement an ähnliche Szenen in den Schaftgräbern
von Mykene erinnern. Interessant sind auch die Szenen,
die einen Mann mit zwei Hunden, zwei speerbewaffnete
Frauen, die auf einem Wagen fahren, und einen Tierfries
darstellen. Diese Fresken haben eine Höhe von kaum
20 cm, doch wurden auch Fragmente von Kompositionen
in höherem und größerem Maßstabe gefunden, worunter
die wichtigste eine Jungfrau ist, die ein Oefäß trägt, nicht
unähnlich dem Oefäßträger von Knosos. m.
Die Malereien in der Mainzer Karmelitenkirche.
Die eifrigen jungen Maler Veite und Kienzle haben mit
den weiteren Untersuchungen, die sie auf Betreiben des
Denkmalpflegers Professor Neeb vornehmen, Erfolg ge-
habt. Außer einigen Spuren von geringerem Umfang und
geringer Erhaltung, u. a. den Resten eines hl. Christopherus,
sind in einem an die Kirche angrenzenden Räume neue
Funde gemacht worden. Professor Neeb vermutet, der
Raum habe zu dem alten Kreuzgang gehört. Es wurden
vier größere Wandbilder von verschieden guter (oder
schlechter) Erhaltung bloßgelegt: eine Himmelfahrt Christi,
ein beinahe ganz zerstörtes Sippenbild, eine Himmelfahrt
des Elias (mit der Mantellegende), eine Ausgießung des
hl. Oeistes. Von einem und demselben Maler rühren offen-
bar die Himmelfahrt und die Ausgießung des hl. Oeistes
her. Die Datierung der Bilder ist schwer. Eine Inschrift
unter dem Sippenbild läßt eine Jahreszahl 1395 erkennen.
Der flüssige Stil der Bilder und manche Einzelheit scheint
zwar auf den ersten Blick dieser frühen Entstehungszeit zu
widersprechen. Aber die Frage wird noch offen bleiben
müssen. Erstaunlich sind allerdings eine wie von Melozzo
eingegebene Kopfverkürzung auf der Himmelfahrt Christi;
ferner der Faltenstil und einige rassige und »moderne«
Oesichtstypen auf dem Eliasbild, dessen Urheber man in
der Tat Bekanntschaft mit italienischer Kunst zutrauen