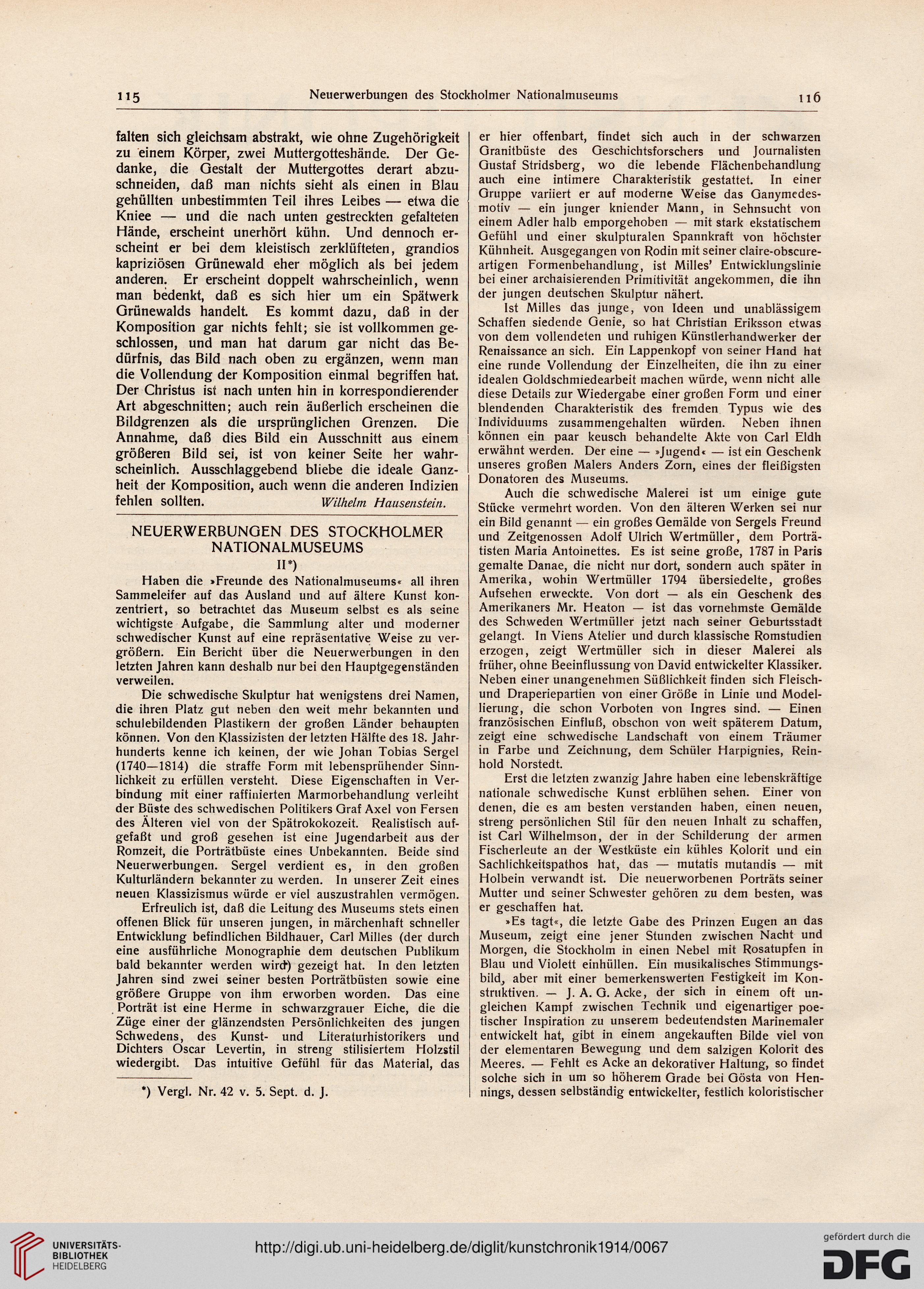1'5
Neuerwerbungen des Stockholmer Nationalmuseunis
116
falten sich gleichsam abstrakt, wie ohne Zugehörigkeit
zu einem Körper, zwei Muttergotteshände. Der Ge-
danke, die Gestalt der Muttergottes derart abzu-
schneiden, daß man nichts sieht als einen in Blau
gehüllten unbestimmten Teil ihres Leibes — etwa die
Kniee — und die nach unten gestreckten gefalteten
Hände, erscheint unerhört kühn. Und dennoch er-
scheint er bei dem kleistisch zerklüfteten, grandios
kapriziösen Grünewald eher möglich als bei jedem
anderen. Er erscheint doppelt wahrscheinlich, wenn
man bedenkt, daß es sich hier um ein Spätwerk
Grünewalds handelt. Es kommt dazu, daß in der
Komposition gar nichts fehlt; sie ist vollkommen ge-
schlossen, und man hat darum gar nicht das Be-
dürfnis, das Bild nach oben zu ergänzen, wenn man
die Vollendung der Komposition einmal begriffen hat.
Der Christus ist nach unten hin in korrespondierender
Art abgeschnitten; auch rein äußerlich erscheinen die
Bildgrenzen als die ursprünglichen Grenzen. Die
Annahme, daß dies Bild ein Ausschnitt aus einem
größeren Bild sei, ist von keiner Seite her wahr-
scheinlich. Ausschlaggebend bliebe die ideale Ganz-
heit der Komposition, auch wenn die anderen Indizien
fehlen sollten. Wilhelm Hausenstein.
NEUERWERBUNGEN DES STOCKHOLMER
NATIONALMUSEUMS
II*)
Haben die »Freunde des Nationalmuseums« all ihren
Sammeleifer auf das Ausland und auf ältere Kunst kon-
zentriert, so betrachtet das Museum selbst es als seine
wichtigste Aufgabe, die Sammlung alter und moderner
schwedischer Kunst auf eine repräsentative Weise zu ver-
größern. Ein Bericht über die Neuerwerbungen in den
letzten Jahren kann deshalb nur bei den Hauptgegenständen
verweilen.
Die schwedische Skulptur hat wenigstens drei Namen,
die ihren Platz gut neben den weit mehr bekannten und
schulebildenden Plastikern der großen Länder behaupten
können. Von den Klassizisten der letzten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts kenne ich keinen, der wie Johan Tobias Sergel
(1740—1814) die straffe Form mit lebensprühender Sinn-
lichkeit zu erfüllen versteht. Diese Eigenschaften in Ver-
bindung mit einer raffinierten Marmorbehandlung verleiht
der Büste des schwedischen Politikers Graf Axel von Fersen
des Älteren viel von der Spätrokokozeit. Realistisch auf-
gefaßt und groß gesehen ist eine Jugendarbeit aus der
Romzeit, die Porträtbüste eines Unbekannten. Beide sind
Neuerwerbungen. Sergel verdient es, in den großen
Kulturländern bekannter zu werden. In unserer Zeit eines
neuen Klassizismus würde er viel auszustrahlen vermögen.
Erfreulich ist, daß die Leitung des Museums stets einen
offenen Blick für unseren jungen, in märchenhaft schneller
Entwicklung befindlichen Bildhauer, Carl Milles (der durch
eine ausführliche Monographie dem deutschen Publikum
bald bekannter werden wird") gezeigt hat. In den letzten
Jahren sind zwei seiner besten Porträtbüsten sowie eine
größere Gruppe von ihm erworben worden. Das eine
Porträt ist eine Herme in schwarzgrauer Eiche, die die
Züge einer der glänzendsten Persönlichkeiten des jungen
Schwedens, des Kunst- und Literaturhistorikers und
Dichters Oscar Levertin, in streng stilisiertem Holzstil
wiedergibt. Das intuitive Gefühl für das Material, das
*) Vergl. Nr. 42 v. 5. Sept. d. J.
er hier offenbart, findet sich auch in der schwarzen
Granitbüste des Geschichtsforschers und Journalisten
Gustaf Stridsberg, wo die lebende Flächenbehandlung
auch eine intimere Charakteristik gestattet. In einer
Gruppe variiert er auf moderne Weise das Ganymedes-
motiv — ein junger kniender Mann, in Sehnsucht von
einem Adler halb emporgehoben — mit stark ekstatischem
Gefühl und einer skulpturalen Spannkraft von höchster
Kühnheit. Ausgegangen von Rodin mit seiner claire-obscure-
artigen Formenbehandlung, ist Milles' Entwicklungslinie
bei einer archaisierenden Primitivität angekommen, die ihn
der jungen deutschen Skulptur nähert.
Ist Milles das junge, von Ideen und unablässigem
Schaffen siedende Genie, so hat Christian Eriksson etwas
von dem vollendeten und ruhigen Künstlerhandwerker der
Renaissance an sich. Ein Lappenkopf von seiner Hand hat
eine runde Vollendung der Einzelheiten, die ihn zu einer
idealen Goldschmiedearbeit machen würde, wenn nicht alle
diese Details zur Wiedergabe einer großen Form und einer
blendenden Charakteristik des fremden Typus wie des
Individuums zusammengehalten würden. Neben ihnen
können ein paar keusch behandelte Akte von Carl Eldh
erwähnt werden. Der eine — »Jugend« — ist ein Geschenk
unseres großen Malers Anders Zorn, eines der fleißigsten
Donatoren des Museums.
Auch die schwedische Malerei ist um einige gute
Stücke vermehrt worden. Von den älteren Werken sei nur
ein Bild genannt — ein großes Gemälde von Sergels Freund
und Zeitgenossen Adolf Ulrich Wertmüller, dem Porträ-
tisten Maria Antoinettes. Es ist seine große, 1787 in Paris
gemalte Danae, die nicht nur dort, sondern auch später in
Amerika, wohin Wertmüller 1794 übersiedelte, großes
Aufsehen erweckte. Von dort — als ein Geschenk des
Amerikaners Mr. Heaton — ist das vornehmste Gemälde
des Schweden Wertmüller jetzt nach seiner Geburtsstadt
gelangt. In Viens Atelier und durch klassische Romstudien
erzogen, zeigt Wertmüller sich in dieser Malerei als
früher, ohne Beeinflussung von David entwickelter Klassiker.
Neben einer unangenehmen Süßlichkeit finden sich Fleisch-
und Draperiepartien von einer Größe in Linie und Model-
lierung, die schon Vorboten von Ingres sind. — Einen
französischen Einfluß, obschon von weit späterem Datum,
zeigt eine schwedische Landschaft von einem Träumer
in Farbe und Zeichnung, dem Schüler Harpignies, Rein-
hold Norstedt.
Erst die letzten zwanzig Jahre haben eine lebenskräftige
nationale schwedische Kunst erblühen sehen. Einer von
denen, die es am besten verstanden haben, einen neuen,
streng persönlichen Stil für den neuen Inhalt zu schaffen,
ist Carl Wilhelmson, der in der Schilderung der armen
Fischerleute an der Westküste ein kühles Kolorit und ein
Sachlichkeitspathos hat, das — mutatis mutandis — mit
Holbein verwandt ist. Die neuerworbenen Porträts seiner
Mutter und seiner Schwester gehören zu dem besten, was
er geschaffen hat.
»Es tagt«, die letzte Gabe des Prinzen Eugen an das
Museum, zeigt eine jener Stunden zwischen Nacht und
Morgen, die Stockholm in einen Nebel mit Rosatupfen in
Blau und Violett einhüllen. Ein musikalisches Stimmungs-
bild, aber mit einer bemerkenswerten Festigkeit im Kon-
struktiven. — J.A. G. Acke, der sich in einem oft un-
gleichen Kampf zwischen Technik und eigenartiger poe-
tischer Inspiration zu unserem bedeutendsten Marinemaler
entwickelt hat, gibt in einem angekauften Bilde viel von
der elementaren Bewegung und dem salzigen Kolorit des
Meeres. — Fehlt es Acke an dekorativer Haltung, so findet
solche sich in um so höherem Grade bei Gösta von Hen-
nings, dessen selbständig entwickelter, festlich koloristischer
Neuerwerbungen des Stockholmer Nationalmuseunis
116
falten sich gleichsam abstrakt, wie ohne Zugehörigkeit
zu einem Körper, zwei Muttergotteshände. Der Ge-
danke, die Gestalt der Muttergottes derart abzu-
schneiden, daß man nichts sieht als einen in Blau
gehüllten unbestimmten Teil ihres Leibes — etwa die
Kniee — und die nach unten gestreckten gefalteten
Hände, erscheint unerhört kühn. Und dennoch er-
scheint er bei dem kleistisch zerklüfteten, grandios
kapriziösen Grünewald eher möglich als bei jedem
anderen. Er erscheint doppelt wahrscheinlich, wenn
man bedenkt, daß es sich hier um ein Spätwerk
Grünewalds handelt. Es kommt dazu, daß in der
Komposition gar nichts fehlt; sie ist vollkommen ge-
schlossen, und man hat darum gar nicht das Be-
dürfnis, das Bild nach oben zu ergänzen, wenn man
die Vollendung der Komposition einmal begriffen hat.
Der Christus ist nach unten hin in korrespondierender
Art abgeschnitten; auch rein äußerlich erscheinen die
Bildgrenzen als die ursprünglichen Grenzen. Die
Annahme, daß dies Bild ein Ausschnitt aus einem
größeren Bild sei, ist von keiner Seite her wahr-
scheinlich. Ausschlaggebend bliebe die ideale Ganz-
heit der Komposition, auch wenn die anderen Indizien
fehlen sollten. Wilhelm Hausenstein.
NEUERWERBUNGEN DES STOCKHOLMER
NATIONALMUSEUMS
II*)
Haben die »Freunde des Nationalmuseums« all ihren
Sammeleifer auf das Ausland und auf ältere Kunst kon-
zentriert, so betrachtet das Museum selbst es als seine
wichtigste Aufgabe, die Sammlung alter und moderner
schwedischer Kunst auf eine repräsentative Weise zu ver-
größern. Ein Bericht über die Neuerwerbungen in den
letzten Jahren kann deshalb nur bei den Hauptgegenständen
verweilen.
Die schwedische Skulptur hat wenigstens drei Namen,
die ihren Platz gut neben den weit mehr bekannten und
schulebildenden Plastikern der großen Länder behaupten
können. Von den Klassizisten der letzten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts kenne ich keinen, der wie Johan Tobias Sergel
(1740—1814) die straffe Form mit lebensprühender Sinn-
lichkeit zu erfüllen versteht. Diese Eigenschaften in Ver-
bindung mit einer raffinierten Marmorbehandlung verleiht
der Büste des schwedischen Politikers Graf Axel von Fersen
des Älteren viel von der Spätrokokozeit. Realistisch auf-
gefaßt und groß gesehen ist eine Jugendarbeit aus der
Romzeit, die Porträtbüste eines Unbekannten. Beide sind
Neuerwerbungen. Sergel verdient es, in den großen
Kulturländern bekannter zu werden. In unserer Zeit eines
neuen Klassizismus würde er viel auszustrahlen vermögen.
Erfreulich ist, daß die Leitung des Museums stets einen
offenen Blick für unseren jungen, in märchenhaft schneller
Entwicklung befindlichen Bildhauer, Carl Milles (der durch
eine ausführliche Monographie dem deutschen Publikum
bald bekannter werden wird") gezeigt hat. In den letzten
Jahren sind zwei seiner besten Porträtbüsten sowie eine
größere Gruppe von ihm erworben worden. Das eine
Porträt ist eine Herme in schwarzgrauer Eiche, die die
Züge einer der glänzendsten Persönlichkeiten des jungen
Schwedens, des Kunst- und Literaturhistorikers und
Dichters Oscar Levertin, in streng stilisiertem Holzstil
wiedergibt. Das intuitive Gefühl für das Material, das
*) Vergl. Nr. 42 v. 5. Sept. d. J.
er hier offenbart, findet sich auch in der schwarzen
Granitbüste des Geschichtsforschers und Journalisten
Gustaf Stridsberg, wo die lebende Flächenbehandlung
auch eine intimere Charakteristik gestattet. In einer
Gruppe variiert er auf moderne Weise das Ganymedes-
motiv — ein junger kniender Mann, in Sehnsucht von
einem Adler halb emporgehoben — mit stark ekstatischem
Gefühl und einer skulpturalen Spannkraft von höchster
Kühnheit. Ausgegangen von Rodin mit seiner claire-obscure-
artigen Formenbehandlung, ist Milles' Entwicklungslinie
bei einer archaisierenden Primitivität angekommen, die ihn
der jungen deutschen Skulptur nähert.
Ist Milles das junge, von Ideen und unablässigem
Schaffen siedende Genie, so hat Christian Eriksson etwas
von dem vollendeten und ruhigen Künstlerhandwerker der
Renaissance an sich. Ein Lappenkopf von seiner Hand hat
eine runde Vollendung der Einzelheiten, die ihn zu einer
idealen Goldschmiedearbeit machen würde, wenn nicht alle
diese Details zur Wiedergabe einer großen Form und einer
blendenden Charakteristik des fremden Typus wie des
Individuums zusammengehalten würden. Neben ihnen
können ein paar keusch behandelte Akte von Carl Eldh
erwähnt werden. Der eine — »Jugend« — ist ein Geschenk
unseres großen Malers Anders Zorn, eines der fleißigsten
Donatoren des Museums.
Auch die schwedische Malerei ist um einige gute
Stücke vermehrt worden. Von den älteren Werken sei nur
ein Bild genannt — ein großes Gemälde von Sergels Freund
und Zeitgenossen Adolf Ulrich Wertmüller, dem Porträ-
tisten Maria Antoinettes. Es ist seine große, 1787 in Paris
gemalte Danae, die nicht nur dort, sondern auch später in
Amerika, wohin Wertmüller 1794 übersiedelte, großes
Aufsehen erweckte. Von dort — als ein Geschenk des
Amerikaners Mr. Heaton — ist das vornehmste Gemälde
des Schweden Wertmüller jetzt nach seiner Geburtsstadt
gelangt. In Viens Atelier und durch klassische Romstudien
erzogen, zeigt Wertmüller sich in dieser Malerei als
früher, ohne Beeinflussung von David entwickelter Klassiker.
Neben einer unangenehmen Süßlichkeit finden sich Fleisch-
und Draperiepartien von einer Größe in Linie und Model-
lierung, die schon Vorboten von Ingres sind. — Einen
französischen Einfluß, obschon von weit späterem Datum,
zeigt eine schwedische Landschaft von einem Träumer
in Farbe und Zeichnung, dem Schüler Harpignies, Rein-
hold Norstedt.
Erst die letzten zwanzig Jahre haben eine lebenskräftige
nationale schwedische Kunst erblühen sehen. Einer von
denen, die es am besten verstanden haben, einen neuen,
streng persönlichen Stil für den neuen Inhalt zu schaffen,
ist Carl Wilhelmson, der in der Schilderung der armen
Fischerleute an der Westküste ein kühles Kolorit und ein
Sachlichkeitspathos hat, das — mutatis mutandis — mit
Holbein verwandt ist. Die neuerworbenen Porträts seiner
Mutter und seiner Schwester gehören zu dem besten, was
er geschaffen hat.
»Es tagt«, die letzte Gabe des Prinzen Eugen an das
Museum, zeigt eine jener Stunden zwischen Nacht und
Morgen, die Stockholm in einen Nebel mit Rosatupfen in
Blau und Violett einhüllen. Ein musikalisches Stimmungs-
bild, aber mit einer bemerkenswerten Festigkeit im Kon-
struktiven. — J.A. G. Acke, der sich in einem oft un-
gleichen Kampf zwischen Technik und eigenartiger poe-
tischer Inspiration zu unserem bedeutendsten Marinemaler
entwickelt hat, gibt in einem angekauften Bilde viel von
der elementaren Bewegung und dem salzigen Kolorit des
Meeres. — Fehlt es Acke an dekorativer Haltung, so findet
solche sich in um so höherem Grade bei Gösta von Hen-
nings, dessen selbständig entwickelter, festlich koloristischer