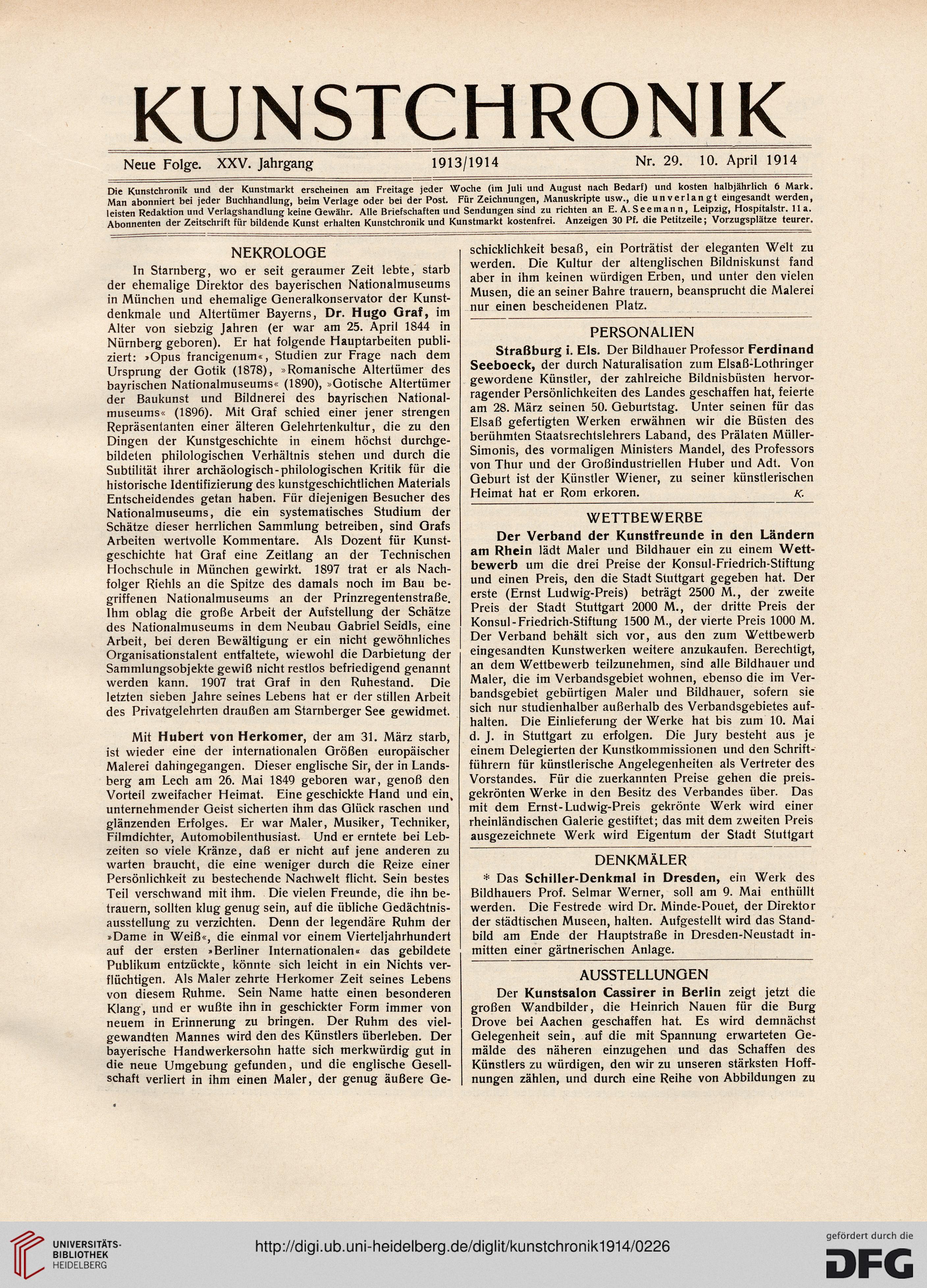KUNSTCHRONIK
Neue Folge. XXV. Jahrgang 1913/1914 Nr. 29. 10. April 1914
Die Kunstchronik und der Kunstmarkt erscheinen am Freitage jeder Woche (im Juli und August nach Bedarf) und kosten halbjährlich 6 Mark.
Man abonniert bei jeder Buchhandlung, beim Verlage oder bei der Post. Für Zeichnungen, Manuskripte usw., die unverlangt eingesandt werden,
leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Qewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E. A.Seemann, Leipzig, Hospitalstr. IIa.
Abonnenten der Zeitschrift für bildende Kunst erhalten Kunstchronik und Kunstmarkt kostenfrei. Anzeigen 30 Pf. die Petitzeile; Vorzugsplätze teurer.
NEKROLOGE
In Starnberg, wo er seit geraumer Zeit lebte, starb
der ehemalige Direktor des bayerischen Nationalmuseums
in München und ehemalige Oeneralkonservator der Kunst-
denkmale und Altertümer Bayerns, Dr. Hugo Graf, im
Alter von siebzig Jahren (er war am 25. April 1844 in
Nürnberg geboren). Er hat folgende Hauptarbeiten publi-
ziert: »Opus francigenum«, Studien zur Frage nach dem
Ursprung der Gotik (1878), »Romanische Altertümer des
bayrischen Nationalmuseums« (1890), »Gotische Altertümer
der Baukunst und Bildnerei des bayrischen National-
museums« (1896). Mit Graf schied einer jener strengen
Repräsentanten einer älteren Gelehrtenkultur, die zu den
Dingen der Kunstgeschichte in einem höchst durchge-
bildeten philologischen Verhältnis stehen und durch die
Subtilität ihrer archäologisch-philologischen Kritik für die
historische Identifizierung des kunstgeschichtlichen Materials
Entscheidendes getan haben. Für diejenigen Besucher des
Nationalmuseums, die ein systematisches Studium der
Schätze dieser herrlichen Sammlung betreiben, sind Grafs
Arbeiten wertvolle Kommentare. Als Dozent für Kunst-
geschichte hat Graf eine Zeitlang an der Technischen
Hochschule in München gewirkt. 1897 trat er als Nach-
folger Riehls an die Spitze des damals noch im Bau be-
griffenen Nationalmuseums an der Prinzregentenstraße.
Ihm oblag die große Arbeit der Aufstellung der Schätze
des Nationalmuseums in dem Neubau Gabriel Seidls, eine
Arbeit, bei deren Bewältigung er ein nicht gewöhnliches
Organisationstalent entfaltete, wiewohl die Darbietung der
Sammlungsobjekte gewiß nicht restlos befriedigend genannt
werden kann. 1907 trat Graf in den Ruhestand. Die
letzten sieben Jahre seines Lebens hat er der stillen Arbeit
des Privatgelehrten draußen am Starnberger See gewidmet.
Mit Hubert von Herkomer, der am 31. März starb,
ist wieder eine der internationalen Größen europäischer
Malerei dahingegangen. Dieser englische Sir, der in Lands-
berg am Lech am 26. Mai 1849 geboren war, genoß den
Vorteil zweifacher Heimat. Eine geschickte Hand und ein,
unternehmender Geist sicherten ihm das Glück raschen und
glänzenden Erfolges. Er war Maler, Musiker, Techniker,
Filmdichter, Automobilenthusiast. Und er erntete bei Leb-
zeiten so viele Kränze, daß er nicht auf jene anderen zu
warten braucht, die eine weniger durch die Reize einer
Persönlichkeit zu bestechende Nachwelt flicht. Sein bestes
Teil verschwand mit ihm. Die vielen Freunde, die ihn be-
trauern, sollten klug genug sein, auf die übliche Gedächtnis-
ausstellung zu verzichten. Denn der legendäre Ruhm der
»Dame in Weiß«, die einmal vor einem Vierteljahrhundert
auf der ersten »Berliner Internationalen« das gebildete
Publikum entzückte, könnte sich leicht in ein Nichts ver-
flüchtigen. Als Maler zehrte Herkomer Zeit seines Lebens
von diesem Ruhme. Sein Name hatte einen besonderen
Klang, und er wußte ihn in geschickter Form immer von
neuem in Erinnerung zu bringen. Der Ruhm des viel-
gewandten Mannes wird den des Künstlers überleben. Der
bayerische Handwerkersohn hatte sich merkwürdig gut in
die neue Umgebung gefunden, und die englische Gesell-
schaft verliert in ihm einen Maler, der genug äußere Ge-
schicklichkeit besaß, ein Porträtist der eleganten Welt zu
werden. Die Kultur der altenglischen Bildniskunst fand
aber in ihm keinen würdigen Erben, und unter den vielen
Musen, die an seiner Bahre trauern, beansprucht die Malerei
nur einen bescheidenen Platz.
PERSONALIEN
Straßburg i. Eis. Der Bildhauer Professor Ferdinand
Seeboeck, der durch Naturalisation zum Elsaß-Lothringer
gewordene Künstler, der zahlreiche Bildnisbüsten hervor-
ragender Persönlichkeiten des Landes geschaffen hat, feierte
am 28. März seinen 50. Geburtstag. Unter seinen für das
Elsaß gefertigten Werken erwähnen wir die Büsten des
berühmten Staatsrechtslehrers Laband, des Prälaten Müller-
Simonis, des vormaligen Ministers Mandel, des Professors
von Thür und der Großindustriellen Huber und Adt. Von
Geburt ist der Künstler Wiener, zu seiner künstlerischen
Heimat hat er Rom erkoren. k.
WETTBEWERBE
Der Verband der Kunstfreunde in den Ländern
am Rhein lädt Maler und Bildhauer ein zu einem Wett-
bewerb um die drei Preise der Konsul-Friedrich-Stiftung
und einen Preis, den die Stadt Stuttgart gegeben hat. Der
erste (Ernst Ludwig-Preis) beträgt 2500 M., der zweite
Preis der Stadt Stuttgart 2000 M., der dritte Preis der
Konsul-Friedrich-Stiftung 1500 M., der vierte Preis 1000 M.
Der Verband behält sich vor, aus den zum Wettbewerb
eingesandten Kunstwerken weitere anzukaufen. Berechtigt,
an dem Wettbewerb teilzunehmen, sind alle Bildhauer und
Maler, die im Verbandsgebiet wohnen, ebenso die im Ver-
bandsgebiet gebürtigen Maler und Bildhauer, sofern sie
sich nur studienhalber außerhalb des Verbandsgebietes auf-
halten. Die Einlieferung der Werke hat bis zum 10. Mai
d. J. in Stuttgart zu erfolgen. Die Jury besteht aus je
einem Delegierten der Kunstkommissionen und den Schrift-
führern für künstlerische Angelegenheiten als Vertreter des
Vorstandes. Für die zuerkannten Preise gehen die preis-
gekrönten Werke in den Besitz des Verbandes über. Das
mit dem Ernst-Ludwig-Preis gekrönte Werk wird einer
rheinländischen Galerie gestiftet; das mit dem zweiten Preis
ausgezeichnete Werk wird Eigentum der Stadt Stuttgart
DENKMÄLER
* Das Schiller-Denkmal in Dresden, ein Werk des
Bildhauers Prof. Selmar Werner, soll am 9. Mai enthüllt
werden. Die Festrede wird Dr. Minde-Pouet, der Direktor
der städtischen Museen, halten. Aufgestellt wird das Stand-
bild am Ende der Hauptstraße in Dresden-Neustadt in-
mitten einer gärtnerischen Anlage.
AUSSTELLUNGEN
Der Kunstsalon Cassirer in Berlin zeigt jetzt die
großen Wandbilder, die Heinrich Nauen für die Burg
Drove bei Aachen geschaffen hat. Es wird demnächst
Gelegenheit sein, auf die mit Spannung erwarteten Ge-
mälde des näheren einzugehen und das Schaffen des
Künstlers zu würdigen, den wir zu unseren stärksten Hoff-
nungen zählen, und durch eine Reihe von Abbildungen zu
Neue Folge. XXV. Jahrgang 1913/1914 Nr. 29. 10. April 1914
Die Kunstchronik und der Kunstmarkt erscheinen am Freitage jeder Woche (im Juli und August nach Bedarf) und kosten halbjährlich 6 Mark.
Man abonniert bei jeder Buchhandlung, beim Verlage oder bei der Post. Für Zeichnungen, Manuskripte usw., die unverlangt eingesandt werden,
leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Qewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E. A.Seemann, Leipzig, Hospitalstr. IIa.
Abonnenten der Zeitschrift für bildende Kunst erhalten Kunstchronik und Kunstmarkt kostenfrei. Anzeigen 30 Pf. die Petitzeile; Vorzugsplätze teurer.
NEKROLOGE
In Starnberg, wo er seit geraumer Zeit lebte, starb
der ehemalige Direktor des bayerischen Nationalmuseums
in München und ehemalige Oeneralkonservator der Kunst-
denkmale und Altertümer Bayerns, Dr. Hugo Graf, im
Alter von siebzig Jahren (er war am 25. April 1844 in
Nürnberg geboren). Er hat folgende Hauptarbeiten publi-
ziert: »Opus francigenum«, Studien zur Frage nach dem
Ursprung der Gotik (1878), »Romanische Altertümer des
bayrischen Nationalmuseums« (1890), »Gotische Altertümer
der Baukunst und Bildnerei des bayrischen National-
museums« (1896). Mit Graf schied einer jener strengen
Repräsentanten einer älteren Gelehrtenkultur, die zu den
Dingen der Kunstgeschichte in einem höchst durchge-
bildeten philologischen Verhältnis stehen und durch die
Subtilität ihrer archäologisch-philologischen Kritik für die
historische Identifizierung des kunstgeschichtlichen Materials
Entscheidendes getan haben. Für diejenigen Besucher des
Nationalmuseums, die ein systematisches Studium der
Schätze dieser herrlichen Sammlung betreiben, sind Grafs
Arbeiten wertvolle Kommentare. Als Dozent für Kunst-
geschichte hat Graf eine Zeitlang an der Technischen
Hochschule in München gewirkt. 1897 trat er als Nach-
folger Riehls an die Spitze des damals noch im Bau be-
griffenen Nationalmuseums an der Prinzregentenstraße.
Ihm oblag die große Arbeit der Aufstellung der Schätze
des Nationalmuseums in dem Neubau Gabriel Seidls, eine
Arbeit, bei deren Bewältigung er ein nicht gewöhnliches
Organisationstalent entfaltete, wiewohl die Darbietung der
Sammlungsobjekte gewiß nicht restlos befriedigend genannt
werden kann. 1907 trat Graf in den Ruhestand. Die
letzten sieben Jahre seines Lebens hat er der stillen Arbeit
des Privatgelehrten draußen am Starnberger See gewidmet.
Mit Hubert von Herkomer, der am 31. März starb,
ist wieder eine der internationalen Größen europäischer
Malerei dahingegangen. Dieser englische Sir, der in Lands-
berg am Lech am 26. Mai 1849 geboren war, genoß den
Vorteil zweifacher Heimat. Eine geschickte Hand und ein,
unternehmender Geist sicherten ihm das Glück raschen und
glänzenden Erfolges. Er war Maler, Musiker, Techniker,
Filmdichter, Automobilenthusiast. Und er erntete bei Leb-
zeiten so viele Kränze, daß er nicht auf jene anderen zu
warten braucht, die eine weniger durch die Reize einer
Persönlichkeit zu bestechende Nachwelt flicht. Sein bestes
Teil verschwand mit ihm. Die vielen Freunde, die ihn be-
trauern, sollten klug genug sein, auf die übliche Gedächtnis-
ausstellung zu verzichten. Denn der legendäre Ruhm der
»Dame in Weiß«, die einmal vor einem Vierteljahrhundert
auf der ersten »Berliner Internationalen« das gebildete
Publikum entzückte, könnte sich leicht in ein Nichts ver-
flüchtigen. Als Maler zehrte Herkomer Zeit seines Lebens
von diesem Ruhme. Sein Name hatte einen besonderen
Klang, und er wußte ihn in geschickter Form immer von
neuem in Erinnerung zu bringen. Der Ruhm des viel-
gewandten Mannes wird den des Künstlers überleben. Der
bayerische Handwerkersohn hatte sich merkwürdig gut in
die neue Umgebung gefunden, und die englische Gesell-
schaft verliert in ihm einen Maler, der genug äußere Ge-
schicklichkeit besaß, ein Porträtist der eleganten Welt zu
werden. Die Kultur der altenglischen Bildniskunst fand
aber in ihm keinen würdigen Erben, und unter den vielen
Musen, die an seiner Bahre trauern, beansprucht die Malerei
nur einen bescheidenen Platz.
PERSONALIEN
Straßburg i. Eis. Der Bildhauer Professor Ferdinand
Seeboeck, der durch Naturalisation zum Elsaß-Lothringer
gewordene Künstler, der zahlreiche Bildnisbüsten hervor-
ragender Persönlichkeiten des Landes geschaffen hat, feierte
am 28. März seinen 50. Geburtstag. Unter seinen für das
Elsaß gefertigten Werken erwähnen wir die Büsten des
berühmten Staatsrechtslehrers Laband, des Prälaten Müller-
Simonis, des vormaligen Ministers Mandel, des Professors
von Thür und der Großindustriellen Huber und Adt. Von
Geburt ist der Künstler Wiener, zu seiner künstlerischen
Heimat hat er Rom erkoren. k.
WETTBEWERBE
Der Verband der Kunstfreunde in den Ländern
am Rhein lädt Maler und Bildhauer ein zu einem Wett-
bewerb um die drei Preise der Konsul-Friedrich-Stiftung
und einen Preis, den die Stadt Stuttgart gegeben hat. Der
erste (Ernst Ludwig-Preis) beträgt 2500 M., der zweite
Preis der Stadt Stuttgart 2000 M., der dritte Preis der
Konsul-Friedrich-Stiftung 1500 M., der vierte Preis 1000 M.
Der Verband behält sich vor, aus den zum Wettbewerb
eingesandten Kunstwerken weitere anzukaufen. Berechtigt,
an dem Wettbewerb teilzunehmen, sind alle Bildhauer und
Maler, die im Verbandsgebiet wohnen, ebenso die im Ver-
bandsgebiet gebürtigen Maler und Bildhauer, sofern sie
sich nur studienhalber außerhalb des Verbandsgebietes auf-
halten. Die Einlieferung der Werke hat bis zum 10. Mai
d. J. in Stuttgart zu erfolgen. Die Jury besteht aus je
einem Delegierten der Kunstkommissionen und den Schrift-
führern für künstlerische Angelegenheiten als Vertreter des
Vorstandes. Für die zuerkannten Preise gehen die preis-
gekrönten Werke in den Besitz des Verbandes über. Das
mit dem Ernst-Ludwig-Preis gekrönte Werk wird einer
rheinländischen Galerie gestiftet; das mit dem zweiten Preis
ausgezeichnete Werk wird Eigentum der Stadt Stuttgart
DENKMÄLER
* Das Schiller-Denkmal in Dresden, ein Werk des
Bildhauers Prof. Selmar Werner, soll am 9. Mai enthüllt
werden. Die Festrede wird Dr. Minde-Pouet, der Direktor
der städtischen Museen, halten. Aufgestellt wird das Stand-
bild am Ende der Hauptstraße in Dresden-Neustadt in-
mitten einer gärtnerischen Anlage.
AUSSTELLUNGEN
Der Kunstsalon Cassirer in Berlin zeigt jetzt die
großen Wandbilder, die Heinrich Nauen für die Burg
Drove bei Aachen geschaffen hat. Es wird demnächst
Gelegenheit sein, auf die mit Spannung erwarteten Ge-
mälde des näheren einzugehen und das Schaffen des
Künstlers zu würdigen, den wir zu unseren stärksten Hoff-
nungen zählen, und durch eine Reihe von Abbildungen zu