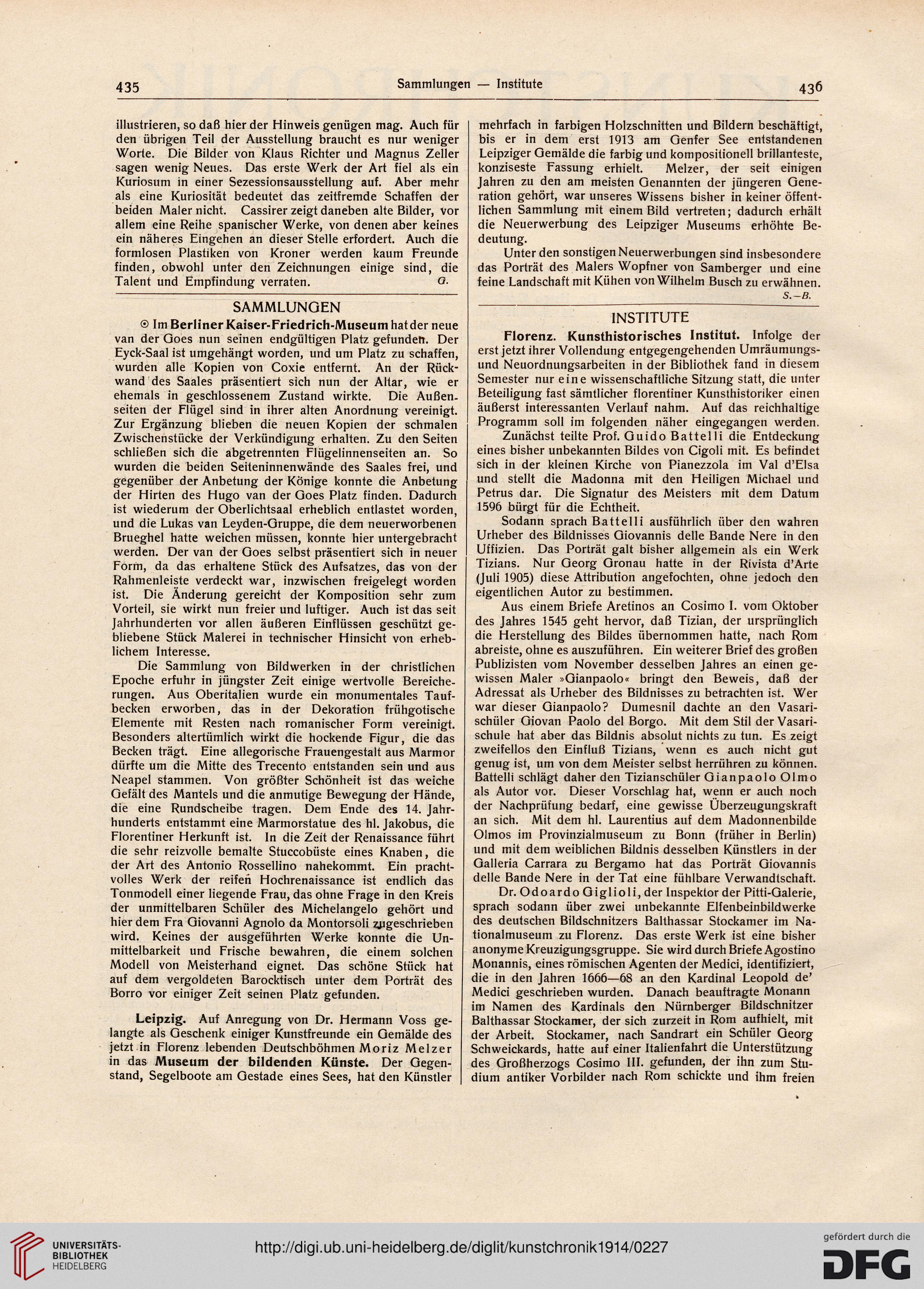435
Sammlungen — Institute
436
illustrieren, so daß hier der Hinweis genügen mag. Auch für
den übrigen Teil der Ausstellung braucht es nur weniger
Worte. Die Bilder von Klaus Richter und Magnus Zeller
sagen wenig Neues. Das erste Werk der Art fiel als ein
Kuriosum in einer Sezessionsausstellung auf. Aber mehr
als eine Kuriosität bedeutet das zeitfremde Schaffen der
beiden Maler nicht. Cassirer zeigt daneben alte Bilder, vor
allem eine Reihe spanischer Werke, von denen aber keines
ein näheres Eingehen an dieser Stelle erfordert. Auch die
formlosen Plastiken von Kroner werden kaum Freunde
finden, obwohl unter den Zeichnungen einige sind, die
Talent und Empfindung verraten. o.
SAMMLUNGEN
® Im Berliner Kaiser-Friedrich-Museum hatder neue
van der Goes nun seinen endgültigen Platz gefunden. Der
Eyck-Saal ist umgehängt worden, und um Platz zu schaffen,
wurden alle Kopien von Coxie entfernt. An der Rück-
wand des Saales präsentiert sich nun der Altar, wie er
ehemals in geschlossenem Zustand wirkte. Die Außen.
Seiten der Flügel sind in ihrer alten Anordnung vereinigt.
Zur Ergänzung blieben die neuen Kopien der schmalen
Zwischenstücke der Verkündigung erhalten. Zu den Seiten
schließen sich die abgetrennten Flügelinnenseiten an. So
wurden die beiden Seiteninnenwände des Saales frei, und
gegenüber der Anbetung der Könige konnte die Anbetung
der Hirten des Hugo van der Goes Platz finden. Dadurch
ist wiederum der Oberlichtsaal erheblich entlastet worden,
und die Lukas van Leyden-Gruppe, die dem neuerworbenen
Brueghel hatte weichen müssen, konnte hier untergebracht
werden. Der van der Goes selbst präsentiert sich in neuer
Form, da das erhaltene Stück des Aufsatzes, das von der
Rahmenleiste verdeckt war, inzwischen freigelegt worden
ist. Die Änderung gereicht der Komposition sehr zum
Vorteil, sie wirkt nun freier und luftiger. Auch ist das seit
Jahrhunderten vor allen äußeren Einflüssen geschützt ge-
bliebene Stück Malerei in technischer Hinsicht von erheb-
lichem Interesse.
Die Sammlung von Bildwerken in der christlichen
Epoche erfuhr in jüngster Zeit einige wertvolle Bereiche-
rungen. Aus Oberitalien wurde ein monumentales Tauf-
becken erworben, das in der Dekoration frühgotische
Elemente mit Resten nach romanischer Form vereinigt.
Besonders altertümlich wirkt die hockende Figur, die das
Becken trägt. Eine allegorische Frauengestalt aus Marmor
dürfte um die Mitte des Trecento entstanden sein und aus
Neapel stammen. Von größter Schönheit ist das weiche
Gefält des Mantels und die anmutige Bewegung der Hände,
die eine Rundscheibe tragen. Dem Ende des 14. Jahr-
hunderts entstammt eine Marmorstatue des hl. Jakobus, die
Florentiner Herkunft ist. In die Zeit der Renaissance führt
die sehr reizvolle bematte Stuccobüste eines Knaben, die
der Art des Antonio Rossellino nahekommt. Ein pracht-
volles Werk der reifen Hochrenaissance ist endlich das
Tonmodell einer liegende Frau, das ohne Frage in den Kreis
der unmittelbaren Schüler des Michelangelo gehört und
hier dem Fra Giovanni Agnolo da Montorsoli zugeschrieben
wird. Keines der ausgeführten Werke konnte die Un-
mittelbarkeit und Frische bewahren, die einem solchen
Modell von Meisterhand eignet. Das schöne Stück hat
auf dem vergoldeten Barocktisch unter dem Porträt des
Borro vor einiger Zeit seinen Platz gefunden.
Leipzig. Auf Anregung von Dr. Hermann Voss ge-
langte als Geschenk einiger Kunstfreunde ein Gemälde des
jetzt in Florenz lebenden Deutschböhmen Moriz Melzer
in das Museum der bildenden Künste. Der Gegen-
stand, Segelboote am Gestade eines Sees, hat den Künstler
mehrfach in farbigen Holzschnitten und Bildern beschäftigt,
bis er in dem erst 1913 am Genfer See entstandenen
Leipziger Gemälde die farbig und kompositioneil brillanteste,
konziseste Fassung erhielt. Melzer, der seit einigen
Jahren zu den am meisten Genannten der jüngeren Gene-
ration gehört, war unseres Wissens bisher in keiner öffent-
lichen Sammlung mit einem Bild vertreten; dadurch erhält
die Neuerwerbung des Leipziger Museums erhöhte Be-
deutung.
Unter den sonstigen Neuerwerbungen sind insbesondere
das Porträt des Malers Wopfner von Samberger und eine
feine Landschaft mit Kühen von Wilhelm Busch zu erwähnen.
S.-s.
INSTITUTE
Florenz. Kunsthistorisches Institut. Infolge der
erst jetzt ihrer Vollendung entgegengehenden Umräumungs-
und Neuordnungsarbeiten in der Bibliothek fand in diesem
Semester nur eine wissenschaftliche Sitzung statt, die unter
Beteiligung fast sämtlicher florentiner Kunsthistoriker einen
äußerst interessanten Verlauf nahm. Auf das reichhaltige
Programm soll im folgenden näher eingegangen werden.
Zunächst teilte Prof. Guido Battelli die Entdeckung
eines bisher unbekannten Bildes von Cigoli mit. Es befindet
sich in der kleinen Kirche von Pianezzola im Val d'Elsa
und stellt die Madonna mit den Heiligen Michael und
Petrus dar. Die Signatur des Meisters mit dem Datum
1596 bürgt für die Echtheit.
Sodann sprach Battelli ausführlich über den wahren
Urheber des Bildnisses Giovannis delle Bande Nere in den
Uffizien. Das Porträt galt bisher allgemein als ein Werk
Tizians. Nur Georg Gronau hatte in der Rivista d'Arte
(Juli 1905) diese Attribution angefochten, ohne jedoch den
eigentlichen Autor zu bestimmen.
Aus einem Briefe Aretinos an Cosimo I. vom Oktober
des Jahres 1545 geht hervor, daß Tizian, der ursprünglich
die Herstellung des Bildes übernommen hatte, nach Rom
abreiste, ohne es auszuführen. Ein weiterer Brief des großen
Publizisten vom November desselben Jahres an einen ge-
wissen Maler »Gianpaolo« bringt den Beweis, daß der
Adressat als Urheber des Bildnisses zu betrachten ist. Wer
war dieser Gianpaolo? Dumesnil dachte an den Vasari-
schüler Giovan Paolo del Borgo. Mit dem Stil der Vasari-
schule hat aber das Bildnis absolut nichts zu tun. Es zeigt
zweifellos den Einfluß Tizians, wenn es auch nicht gut
genug ist, um von dem Meister selbst herrühren zu können.
Battelli schlägt daher den Tizianschüler Gianpaolo Olmo
als Autor vor. Dieser Vorschlag hat, wenn er auch noch
der Nachprüfung bedarf, eine gewisse Überzeugungskraft
an sich. Mit dem hl. Laurentius auf dem Madonnenbilde
Olmos im Provinzialmuseum zu Bonn (früher in Berlin)
und mit dem weiblichen Bildnis desselben Künstlers in der
Galleria Carrara zu Bergamo hat das Porträt Giovannis
delle Bande Nere in der Tat eine fühlbare Verwandtschaft.
Dr. OdoardoGiglioli, der Inspektor der Pitti-Galerie,
sprach sodann über zwei unbekannte Elfenbeinbildwerke
des deutschen Bildschnitzers Balthassar Stockamer im Na-
tionalmuseum zu Florenz. Das erste Werk ist eine bisher
anonyme Kreuzigungsgruppe. Sie wird durch Briefe Agostino
Monannis, eines römischen Agenten der Medici, identifiziert,
die in den Jahren 1666—68 an den Kardinal Leopold de'
Medici geschrieben wurden. Danach beauftragte Monann
im Namen des Kardinals den Nürnberger Bildschnitzer
Balthassar Stockamer, der sich zurzeit in Rom aufhielt, mit
der Arbeit. Stockamer, nach Sandrart ein Schüler Georg
Schweickards, hatte auf einer Italienfahrt die Unterstützung
des Großherzogs Cosimo III. gefunden, der ihn zum Stu-
dium antiker Vorbilder nach Rom schickte und ihm freien
Sammlungen — Institute
436
illustrieren, so daß hier der Hinweis genügen mag. Auch für
den übrigen Teil der Ausstellung braucht es nur weniger
Worte. Die Bilder von Klaus Richter und Magnus Zeller
sagen wenig Neues. Das erste Werk der Art fiel als ein
Kuriosum in einer Sezessionsausstellung auf. Aber mehr
als eine Kuriosität bedeutet das zeitfremde Schaffen der
beiden Maler nicht. Cassirer zeigt daneben alte Bilder, vor
allem eine Reihe spanischer Werke, von denen aber keines
ein näheres Eingehen an dieser Stelle erfordert. Auch die
formlosen Plastiken von Kroner werden kaum Freunde
finden, obwohl unter den Zeichnungen einige sind, die
Talent und Empfindung verraten. o.
SAMMLUNGEN
® Im Berliner Kaiser-Friedrich-Museum hatder neue
van der Goes nun seinen endgültigen Platz gefunden. Der
Eyck-Saal ist umgehängt worden, und um Platz zu schaffen,
wurden alle Kopien von Coxie entfernt. An der Rück-
wand des Saales präsentiert sich nun der Altar, wie er
ehemals in geschlossenem Zustand wirkte. Die Außen.
Seiten der Flügel sind in ihrer alten Anordnung vereinigt.
Zur Ergänzung blieben die neuen Kopien der schmalen
Zwischenstücke der Verkündigung erhalten. Zu den Seiten
schließen sich die abgetrennten Flügelinnenseiten an. So
wurden die beiden Seiteninnenwände des Saales frei, und
gegenüber der Anbetung der Könige konnte die Anbetung
der Hirten des Hugo van der Goes Platz finden. Dadurch
ist wiederum der Oberlichtsaal erheblich entlastet worden,
und die Lukas van Leyden-Gruppe, die dem neuerworbenen
Brueghel hatte weichen müssen, konnte hier untergebracht
werden. Der van der Goes selbst präsentiert sich in neuer
Form, da das erhaltene Stück des Aufsatzes, das von der
Rahmenleiste verdeckt war, inzwischen freigelegt worden
ist. Die Änderung gereicht der Komposition sehr zum
Vorteil, sie wirkt nun freier und luftiger. Auch ist das seit
Jahrhunderten vor allen äußeren Einflüssen geschützt ge-
bliebene Stück Malerei in technischer Hinsicht von erheb-
lichem Interesse.
Die Sammlung von Bildwerken in der christlichen
Epoche erfuhr in jüngster Zeit einige wertvolle Bereiche-
rungen. Aus Oberitalien wurde ein monumentales Tauf-
becken erworben, das in der Dekoration frühgotische
Elemente mit Resten nach romanischer Form vereinigt.
Besonders altertümlich wirkt die hockende Figur, die das
Becken trägt. Eine allegorische Frauengestalt aus Marmor
dürfte um die Mitte des Trecento entstanden sein und aus
Neapel stammen. Von größter Schönheit ist das weiche
Gefält des Mantels und die anmutige Bewegung der Hände,
die eine Rundscheibe tragen. Dem Ende des 14. Jahr-
hunderts entstammt eine Marmorstatue des hl. Jakobus, die
Florentiner Herkunft ist. In die Zeit der Renaissance führt
die sehr reizvolle bematte Stuccobüste eines Knaben, die
der Art des Antonio Rossellino nahekommt. Ein pracht-
volles Werk der reifen Hochrenaissance ist endlich das
Tonmodell einer liegende Frau, das ohne Frage in den Kreis
der unmittelbaren Schüler des Michelangelo gehört und
hier dem Fra Giovanni Agnolo da Montorsoli zugeschrieben
wird. Keines der ausgeführten Werke konnte die Un-
mittelbarkeit und Frische bewahren, die einem solchen
Modell von Meisterhand eignet. Das schöne Stück hat
auf dem vergoldeten Barocktisch unter dem Porträt des
Borro vor einiger Zeit seinen Platz gefunden.
Leipzig. Auf Anregung von Dr. Hermann Voss ge-
langte als Geschenk einiger Kunstfreunde ein Gemälde des
jetzt in Florenz lebenden Deutschböhmen Moriz Melzer
in das Museum der bildenden Künste. Der Gegen-
stand, Segelboote am Gestade eines Sees, hat den Künstler
mehrfach in farbigen Holzschnitten und Bildern beschäftigt,
bis er in dem erst 1913 am Genfer See entstandenen
Leipziger Gemälde die farbig und kompositioneil brillanteste,
konziseste Fassung erhielt. Melzer, der seit einigen
Jahren zu den am meisten Genannten der jüngeren Gene-
ration gehört, war unseres Wissens bisher in keiner öffent-
lichen Sammlung mit einem Bild vertreten; dadurch erhält
die Neuerwerbung des Leipziger Museums erhöhte Be-
deutung.
Unter den sonstigen Neuerwerbungen sind insbesondere
das Porträt des Malers Wopfner von Samberger und eine
feine Landschaft mit Kühen von Wilhelm Busch zu erwähnen.
S.-s.
INSTITUTE
Florenz. Kunsthistorisches Institut. Infolge der
erst jetzt ihrer Vollendung entgegengehenden Umräumungs-
und Neuordnungsarbeiten in der Bibliothek fand in diesem
Semester nur eine wissenschaftliche Sitzung statt, die unter
Beteiligung fast sämtlicher florentiner Kunsthistoriker einen
äußerst interessanten Verlauf nahm. Auf das reichhaltige
Programm soll im folgenden näher eingegangen werden.
Zunächst teilte Prof. Guido Battelli die Entdeckung
eines bisher unbekannten Bildes von Cigoli mit. Es befindet
sich in der kleinen Kirche von Pianezzola im Val d'Elsa
und stellt die Madonna mit den Heiligen Michael und
Petrus dar. Die Signatur des Meisters mit dem Datum
1596 bürgt für die Echtheit.
Sodann sprach Battelli ausführlich über den wahren
Urheber des Bildnisses Giovannis delle Bande Nere in den
Uffizien. Das Porträt galt bisher allgemein als ein Werk
Tizians. Nur Georg Gronau hatte in der Rivista d'Arte
(Juli 1905) diese Attribution angefochten, ohne jedoch den
eigentlichen Autor zu bestimmen.
Aus einem Briefe Aretinos an Cosimo I. vom Oktober
des Jahres 1545 geht hervor, daß Tizian, der ursprünglich
die Herstellung des Bildes übernommen hatte, nach Rom
abreiste, ohne es auszuführen. Ein weiterer Brief des großen
Publizisten vom November desselben Jahres an einen ge-
wissen Maler »Gianpaolo« bringt den Beweis, daß der
Adressat als Urheber des Bildnisses zu betrachten ist. Wer
war dieser Gianpaolo? Dumesnil dachte an den Vasari-
schüler Giovan Paolo del Borgo. Mit dem Stil der Vasari-
schule hat aber das Bildnis absolut nichts zu tun. Es zeigt
zweifellos den Einfluß Tizians, wenn es auch nicht gut
genug ist, um von dem Meister selbst herrühren zu können.
Battelli schlägt daher den Tizianschüler Gianpaolo Olmo
als Autor vor. Dieser Vorschlag hat, wenn er auch noch
der Nachprüfung bedarf, eine gewisse Überzeugungskraft
an sich. Mit dem hl. Laurentius auf dem Madonnenbilde
Olmos im Provinzialmuseum zu Bonn (früher in Berlin)
und mit dem weiblichen Bildnis desselben Künstlers in der
Galleria Carrara zu Bergamo hat das Porträt Giovannis
delle Bande Nere in der Tat eine fühlbare Verwandtschaft.
Dr. OdoardoGiglioli, der Inspektor der Pitti-Galerie,
sprach sodann über zwei unbekannte Elfenbeinbildwerke
des deutschen Bildschnitzers Balthassar Stockamer im Na-
tionalmuseum zu Florenz. Das erste Werk ist eine bisher
anonyme Kreuzigungsgruppe. Sie wird durch Briefe Agostino
Monannis, eines römischen Agenten der Medici, identifiziert,
die in den Jahren 1666—68 an den Kardinal Leopold de'
Medici geschrieben wurden. Danach beauftragte Monann
im Namen des Kardinals den Nürnberger Bildschnitzer
Balthassar Stockamer, der sich zurzeit in Rom aufhielt, mit
der Arbeit. Stockamer, nach Sandrart ein Schüler Georg
Schweickards, hatte auf einer Italienfahrt die Unterstützung
des Großherzogs Cosimo III. gefunden, der ihn zum Stu-
dium antiker Vorbilder nach Rom schickte und ihm freien