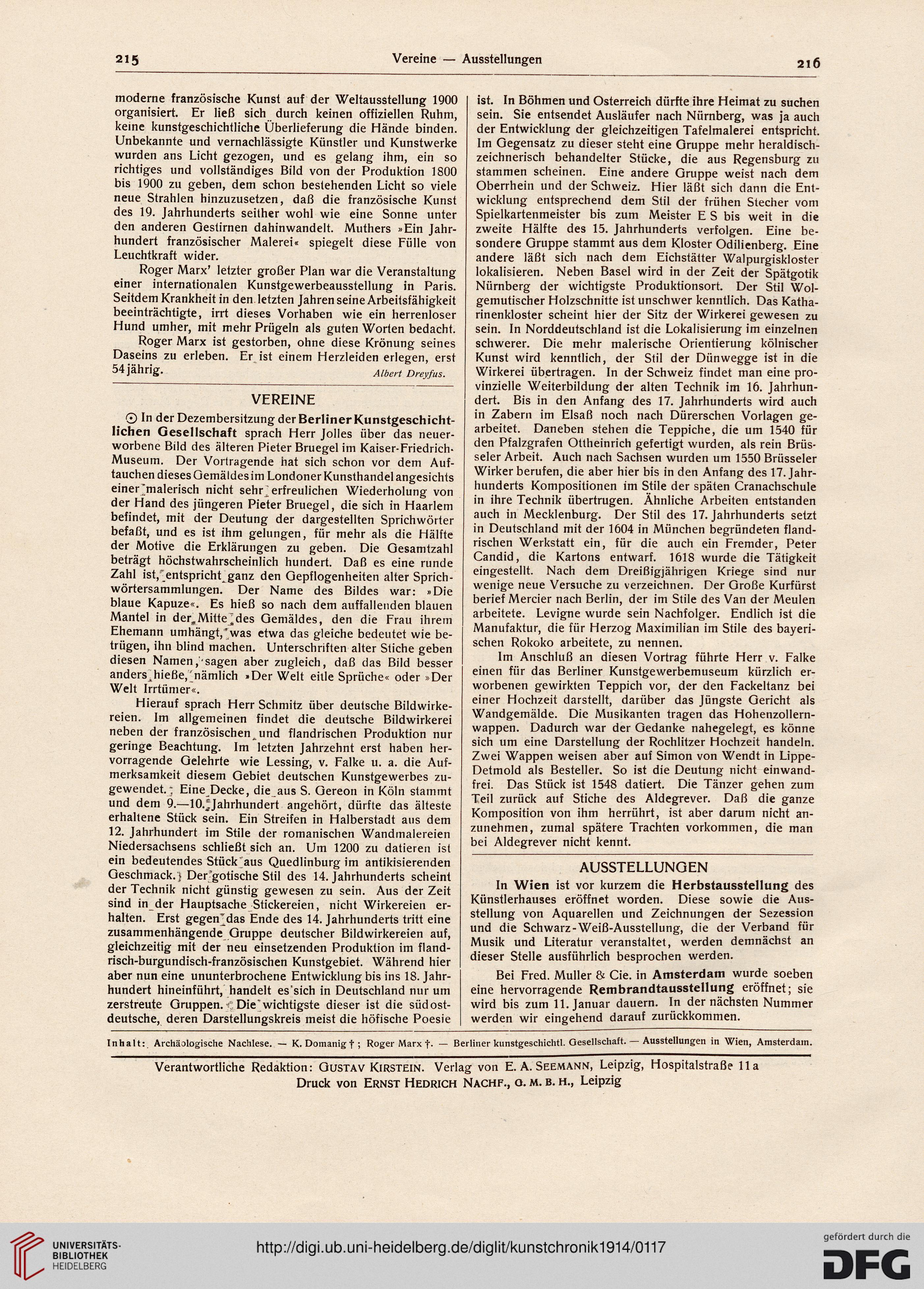215
Vereine — Ausstellungen
216
moderne französische Kunst auf der Weltausstellung 1900
organisiert. Er ließ sich durch keinen offiziellen Ruhm,
keine kunstgeschichtliche Überlieferung die Hände binden.
Unbekannte und vernachlässigte Künstler und Kunstwerke
wurden ans Licht gezogen, und es gelang ihm, ein so
richtiges und vollständiges Bild von der Produktion 1800
bis 1900 zu geben, dem schon bestehenden Licht so viele
neue Strahlen hinzuzusetzen, daß die französische Kunst
des 19. Jahrhunderts seither wohl wie eine Sonne unter
den anderen Gestirnen dahinwandelt. Muthers »Ein Jahr-
hundert französischer Malerei« spiegelt diese Fülle von
Leuchtkraft wider.
Roger Marx' letzter großer Plan war die Veranstaltung
einer internationalen Kunstgewerbeausstellung in Paris.
Seitdem Krankheit in den letzten Jahren seine Arbeitsfähigkeit
beeinträchtigte, irrt dieses Vorhaben wie ein herrenloser
Hund umher, mit mehr Prügeln als guten Worten bedacht.
Roger Marx ist gestorben, ohne diese Krönung seines
Daseins zu erleben. Er ist einem Herzleiden erlegen, erst
54 jährig. Albert Dreyfus.
VEREINE
0 In der Dezembersitzung der Berliner Kunstgeschicht-
lichen Gesellschaft sprach Herr Jolles über das neuer-
worbene Bild des älteren Pieter Bruegel im Kaiser-Friedrich-
Museum. Der Vortragende hat sich schon vor dem Auf-
tauchen dieses Gemäldes im Londoner Kunsthandel angesichts
einer'malerisch nicht sehr erfreulichen Wiederholung von
der Hand des jüngeren Pieter Bruegel, die sich in Haarlem
befindet, mit der Deutung der dargestellten Sprichwörter
befaßt, und es ist ihm gelungen, für mehr als die Hälfte
der Motive die Erklärungen zu geben. Die Gesamtzahl
beträgt höchstwahrscheinlich hundert. Daß es eine runde
Zahl ist,"entspricht ganz den Gepflogenheiten alter Sprich-
wörtersammlungen. Der Name des Bildes war: »Die
blaue Kapuze«. Es hieß so nach dem auffallenden blauen
Mantel in der,Mittendes Gemäldes, den die Frau ihrem
Ehemann umhängt,' was etwa das gleiche bedeutet wie be-
trügen, ihn blind machen. Unterschriften alter Stiche geben
diesen Namen, sagen aber zugleich, daß das Bild besser
anders^hieße.'nämlich »Der Welt eitle Sprüche« oder »Der
Welt Irrtümer«.
Hierauf sprach Herr Schmitz über deutsche Bildwirke-
reien. Im allgemeinen findet die deutsche Bildwirkerei
neben der französischen und flandrischen Produktion nur
geringe Beachtung. Im letzten Jahrzehnt erst haben her-
vorragende Gelehrte wie Lessing, v. Falke u. a. die Auf-
merksamkeit diesem Gebiet deutschen Kunstgewerbes zu-
gewendet; Eine Decke, die aus S. Gereon in Köln stammt
und dem 9.—10.* Jahrhundert angehört, dürfte das älteste
erhaltene Stück sein. Ein Streifen in Halberstadt aus dem
12. Jahrhundert im Stile der romanischen Wandmalereien
Niedersachsens schließt sich an. Um 1200 zu datieren ist
ein bedeutendes Stück aus Quedlinburg im antikisierenden
Geschmack. » Der/gotische Stil des 14. Jahrhunderts scheint
der Technik nicht günstig gewesen zu sein. Aus der Zeit
sind in der Hauptsache Stickereien, nicht Wirkereien er-
halten. Erst gegen'das Ende des 14. Jahrhunderts tritt eine
zusammenhängende Gruppe deutscher Bildwirkereien auf,
gleichzeitig mit der neu einsetzenden Produktion im fland-
risch-burgundisch-französischen Kunstgebiet. Während hier
aber nun eine ununterbrochene Entwicklung bis ins 18. Jahr-
hundert hineinführt, handelt es'sich in Deutschland nur um
zerstreute Gruppen.- Die'wichtigste dieser ist die südost-
deutsche, deren Darstellungskreis meist die höfische Poesie
ist. In Böhmen und Osterreich dürfte ihre Heimat zu suchen
sein. Sie entsendet Ausläufer nach Nürnberg, was ja auch
der Entwicklung der gleichzeitigen Tafelmalerei entspricht.
Im Gegensatz zu dieser steht eine Gruppe mehr heraldisch-
zeichnerisch behandelter Stücke, die aus Regensburg zu
stammen scheinen. Eine andere Gruppe weist nach dem
Oberrhein und der Schweiz. Hier läßt sich dann die Ent-
wicklung entsprechend dem Stil der frühen Stecher vom
Spielkartenmeister bis zum Meister E S bis weit in die
zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts verfolgen. Eine be-
sondere Gruppe stammt aus dem Kloster Odilienberg. Eine
andere läßt sich nach dem Eichstätter Walpurgiskloster
lokalisieren. Neben Basel wird in der Zeit der Spätgotik
Nürnberg der wichtigste Produktionsort. Der Stil Wol-
gemutischer Holzschnitte ist unschwer kenntlich. Das Katha-
rinenkloster scheint hier der Sitz der Wirkerei gewesen zu
sein. In Norddeutschland ist die Lokalisierung im einzelnen
schwerer. Die mehr malerische Orientierung kölnischer
Kunst wird kenntlich, der Stil der Dünwegge ist in die
Wirkerei übertragen. In der Schweiz findet man eine pro-
vinzielle Weiterbildung der alten Technik im 16. Jahrhun-
dert. Bis in den Anfang des 17. Jahrhunderts wird auch
in Zabern im Elsaß noch nach Dürerschen Vorlagen ge-
arbeitet. Daneben stehen die Teppiche, die um 1540 für
den Pfalzgrafen Ottheinrich gefertigt wurden, als rein Brüs-
seler Arbeit. Auch nach Sachsen wurden um 1550 Brüsseler
Wirker berufen, die aber hier bis in den Anfang des 17. Jahr-
hunderts Kompositionen im Stile der späten Cranachschule
in ihre Technik übertrugen. Ähnliche Arbeiten entstanden
auch in Mecklenburg. Der Stil des 17. Jahrhunderts setzt
in Deutschland mit der 1604 in München begründeten fland-
rischen Werkstatt ein, für die auch ein Fremder, Peter
Candid, die Kartons entwarf. 1618 wurde die Tätigkeit
eingestellt. Nach dem Dreißigjährigen Kriege sind nur
wenige neue Versuche zu verzeichnen. Der Große Kurfürst
berief Mercier nach Berlin, der im Stile des Van der Meulen
arbeitete. Levigne wurde sein Nachfolger. Endlich ist die
Manufaktur, die für Herzog Maximilian im Stile des bayeri-
schen Rokoko arbeitete, zu nennen.
Im Anschluß an diesen Vortrag führte Herr v. Falke
einen für das Berliner Kunstgewerbemuseum kürzlich er-
worbenen gewirkten Teppich vor, der den Fackeltanz bei
einer Hochzeit darstellt, darüber das Jüngste Gericht als
Wandgemälde. Die Musikanten tragen das Hohenzollern-
wappen. Dadurch war der Gedanke nahegelegt, es könne
sich um eine Darstellung der Rochlitzer Hochzeit handeln.
Zwei Wappen weisen aber auf Simon von Wendt in Lippe-
Detmold als Besteller. So ist die Deutung nicht einwand-
frei. Das Stück ist 1548 datiert. Die Tänzer gehen zum
Teil zurück auf Stiche des Aldegrever. Daß die ganze
Komposition von ihm herrührt, ist aber darum nicht an-
zunehmen, zumal spätere Trachten vorkommen, die man
bei Aldegrever nicht kennt.
AUSSTELLUNGEN
In Wien ist vor kurzem die Herbstausstellung des
Künstlerhauses eröffnet worden. Diese sowie die Aus-
stellung von Aquarellen und Zeichnungen der Sezession
und die Schwarz-Weiß-Ausstellung, die der Verband für
Musik und Literatur veranstaltet, werden demnächst an
dieser Stelle ausführlich besprochen werden.
Bei Fred. Muller & Cie. in Amsterdam wurde soeben
eine hervorragende Rembrandtausstellung eröffnet; sie
wird bis zum 11. Januar dauern. In der nächsten Nummer
werden wir eingehend darauf zurückkommen.
Inhalt:. Archäologische Nachlese. - K. Domanig f ; Roger Marx t- - Berliner kunstgeschichtl. Gesellschaft. — Ausstellungen in Wien, Amsterdam.
Verantwortliche Redaktion: Gustav Kirstein. Verlag von E. A. Seemann, Leipzig, Hospitalstraße IIa
Druck von Ernst Hedrich Nachf., o. m. b. h., Leipzig
Vereine — Ausstellungen
216
moderne französische Kunst auf der Weltausstellung 1900
organisiert. Er ließ sich durch keinen offiziellen Ruhm,
keine kunstgeschichtliche Überlieferung die Hände binden.
Unbekannte und vernachlässigte Künstler und Kunstwerke
wurden ans Licht gezogen, und es gelang ihm, ein so
richtiges und vollständiges Bild von der Produktion 1800
bis 1900 zu geben, dem schon bestehenden Licht so viele
neue Strahlen hinzuzusetzen, daß die französische Kunst
des 19. Jahrhunderts seither wohl wie eine Sonne unter
den anderen Gestirnen dahinwandelt. Muthers »Ein Jahr-
hundert französischer Malerei« spiegelt diese Fülle von
Leuchtkraft wider.
Roger Marx' letzter großer Plan war die Veranstaltung
einer internationalen Kunstgewerbeausstellung in Paris.
Seitdem Krankheit in den letzten Jahren seine Arbeitsfähigkeit
beeinträchtigte, irrt dieses Vorhaben wie ein herrenloser
Hund umher, mit mehr Prügeln als guten Worten bedacht.
Roger Marx ist gestorben, ohne diese Krönung seines
Daseins zu erleben. Er ist einem Herzleiden erlegen, erst
54 jährig. Albert Dreyfus.
VEREINE
0 In der Dezembersitzung der Berliner Kunstgeschicht-
lichen Gesellschaft sprach Herr Jolles über das neuer-
worbene Bild des älteren Pieter Bruegel im Kaiser-Friedrich-
Museum. Der Vortragende hat sich schon vor dem Auf-
tauchen dieses Gemäldes im Londoner Kunsthandel angesichts
einer'malerisch nicht sehr erfreulichen Wiederholung von
der Hand des jüngeren Pieter Bruegel, die sich in Haarlem
befindet, mit der Deutung der dargestellten Sprichwörter
befaßt, und es ist ihm gelungen, für mehr als die Hälfte
der Motive die Erklärungen zu geben. Die Gesamtzahl
beträgt höchstwahrscheinlich hundert. Daß es eine runde
Zahl ist,"entspricht ganz den Gepflogenheiten alter Sprich-
wörtersammlungen. Der Name des Bildes war: »Die
blaue Kapuze«. Es hieß so nach dem auffallenden blauen
Mantel in der,Mittendes Gemäldes, den die Frau ihrem
Ehemann umhängt,' was etwa das gleiche bedeutet wie be-
trügen, ihn blind machen. Unterschriften alter Stiche geben
diesen Namen, sagen aber zugleich, daß das Bild besser
anders^hieße.'nämlich »Der Welt eitle Sprüche« oder »Der
Welt Irrtümer«.
Hierauf sprach Herr Schmitz über deutsche Bildwirke-
reien. Im allgemeinen findet die deutsche Bildwirkerei
neben der französischen und flandrischen Produktion nur
geringe Beachtung. Im letzten Jahrzehnt erst haben her-
vorragende Gelehrte wie Lessing, v. Falke u. a. die Auf-
merksamkeit diesem Gebiet deutschen Kunstgewerbes zu-
gewendet; Eine Decke, die aus S. Gereon in Köln stammt
und dem 9.—10.* Jahrhundert angehört, dürfte das älteste
erhaltene Stück sein. Ein Streifen in Halberstadt aus dem
12. Jahrhundert im Stile der romanischen Wandmalereien
Niedersachsens schließt sich an. Um 1200 zu datieren ist
ein bedeutendes Stück aus Quedlinburg im antikisierenden
Geschmack. » Der/gotische Stil des 14. Jahrhunderts scheint
der Technik nicht günstig gewesen zu sein. Aus der Zeit
sind in der Hauptsache Stickereien, nicht Wirkereien er-
halten. Erst gegen'das Ende des 14. Jahrhunderts tritt eine
zusammenhängende Gruppe deutscher Bildwirkereien auf,
gleichzeitig mit der neu einsetzenden Produktion im fland-
risch-burgundisch-französischen Kunstgebiet. Während hier
aber nun eine ununterbrochene Entwicklung bis ins 18. Jahr-
hundert hineinführt, handelt es'sich in Deutschland nur um
zerstreute Gruppen.- Die'wichtigste dieser ist die südost-
deutsche, deren Darstellungskreis meist die höfische Poesie
ist. In Böhmen und Osterreich dürfte ihre Heimat zu suchen
sein. Sie entsendet Ausläufer nach Nürnberg, was ja auch
der Entwicklung der gleichzeitigen Tafelmalerei entspricht.
Im Gegensatz zu dieser steht eine Gruppe mehr heraldisch-
zeichnerisch behandelter Stücke, die aus Regensburg zu
stammen scheinen. Eine andere Gruppe weist nach dem
Oberrhein und der Schweiz. Hier läßt sich dann die Ent-
wicklung entsprechend dem Stil der frühen Stecher vom
Spielkartenmeister bis zum Meister E S bis weit in die
zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts verfolgen. Eine be-
sondere Gruppe stammt aus dem Kloster Odilienberg. Eine
andere läßt sich nach dem Eichstätter Walpurgiskloster
lokalisieren. Neben Basel wird in der Zeit der Spätgotik
Nürnberg der wichtigste Produktionsort. Der Stil Wol-
gemutischer Holzschnitte ist unschwer kenntlich. Das Katha-
rinenkloster scheint hier der Sitz der Wirkerei gewesen zu
sein. In Norddeutschland ist die Lokalisierung im einzelnen
schwerer. Die mehr malerische Orientierung kölnischer
Kunst wird kenntlich, der Stil der Dünwegge ist in die
Wirkerei übertragen. In der Schweiz findet man eine pro-
vinzielle Weiterbildung der alten Technik im 16. Jahrhun-
dert. Bis in den Anfang des 17. Jahrhunderts wird auch
in Zabern im Elsaß noch nach Dürerschen Vorlagen ge-
arbeitet. Daneben stehen die Teppiche, die um 1540 für
den Pfalzgrafen Ottheinrich gefertigt wurden, als rein Brüs-
seler Arbeit. Auch nach Sachsen wurden um 1550 Brüsseler
Wirker berufen, die aber hier bis in den Anfang des 17. Jahr-
hunderts Kompositionen im Stile der späten Cranachschule
in ihre Technik übertrugen. Ähnliche Arbeiten entstanden
auch in Mecklenburg. Der Stil des 17. Jahrhunderts setzt
in Deutschland mit der 1604 in München begründeten fland-
rischen Werkstatt ein, für die auch ein Fremder, Peter
Candid, die Kartons entwarf. 1618 wurde die Tätigkeit
eingestellt. Nach dem Dreißigjährigen Kriege sind nur
wenige neue Versuche zu verzeichnen. Der Große Kurfürst
berief Mercier nach Berlin, der im Stile des Van der Meulen
arbeitete. Levigne wurde sein Nachfolger. Endlich ist die
Manufaktur, die für Herzog Maximilian im Stile des bayeri-
schen Rokoko arbeitete, zu nennen.
Im Anschluß an diesen Vortrag führte Herr v. Falke
einen für das Berliner Kunstgewerbemuseum kürzlich er-
worbenen gewirkten Teppich vor, der den Fackeltanz bei
einer Hochzeit darstellt, darüber das Jüngste Gericht als
Wandgemälde. Die Musikanten tragen das Hohenzollern-
wappen. Dadurch war der Gedanke nahegelegt, es könne
sich um eine Darstellung der Rochlitzer Hochzeit handeln.
Zwei Wappen weisen aber auf Simon von Wendt in Lippe-
Detmold als Besteller. So ist die Deutung nicht einwand-
frei. Das Stück ist 1548 datiert. Die Tänzer gehen zum
Teil zurück auf Stiche des Aldegrever. Daß die ganze
Komposition von ihm herrührt, ist aber darum nicht an-
zunehmen, zumal spätere Trachten vorkommen, die man
bei Aldegrever nicht kennt.
AUSSTELLUNGEN
In Wien ist vor kurzem die Herbstausstellung des
Künstlerhauses eröffnet worden. Diese sowie die Aus-
stellung von Aquarellen und Zeichnungen der Sezession
und die Schwarz-Weiß-Ausstellung, die der Verband für
Musik und Literatur veranstaltet, werden demnächst an
dieser Stelle ausführlich besprochen werden.
Bei Fred. Muller & Cie. in Amsterdam wurde soeben
eine hervorragende Rembrandtausstellung eröffnet; sie
wird bis zum 11. Januar dauern. In der nächsten Nummer
werden wir eingehend darauf zurückkommen.
Inhalt:. Archäologische Nachlese. - K. Domanig f ; Roger Marx t- - Berliner kunstgeschichtl. Gesellschaft. — Ausstellungen in Wien, Amsterdam.
Verantwortliche Redaktion: Gustav Kirstein. Verlag von E. A. Seemann, Leipzig, Hospitalstraße IIa
Druck von Ernst Hedrich Nachf., o. m. b. h., Leipzig