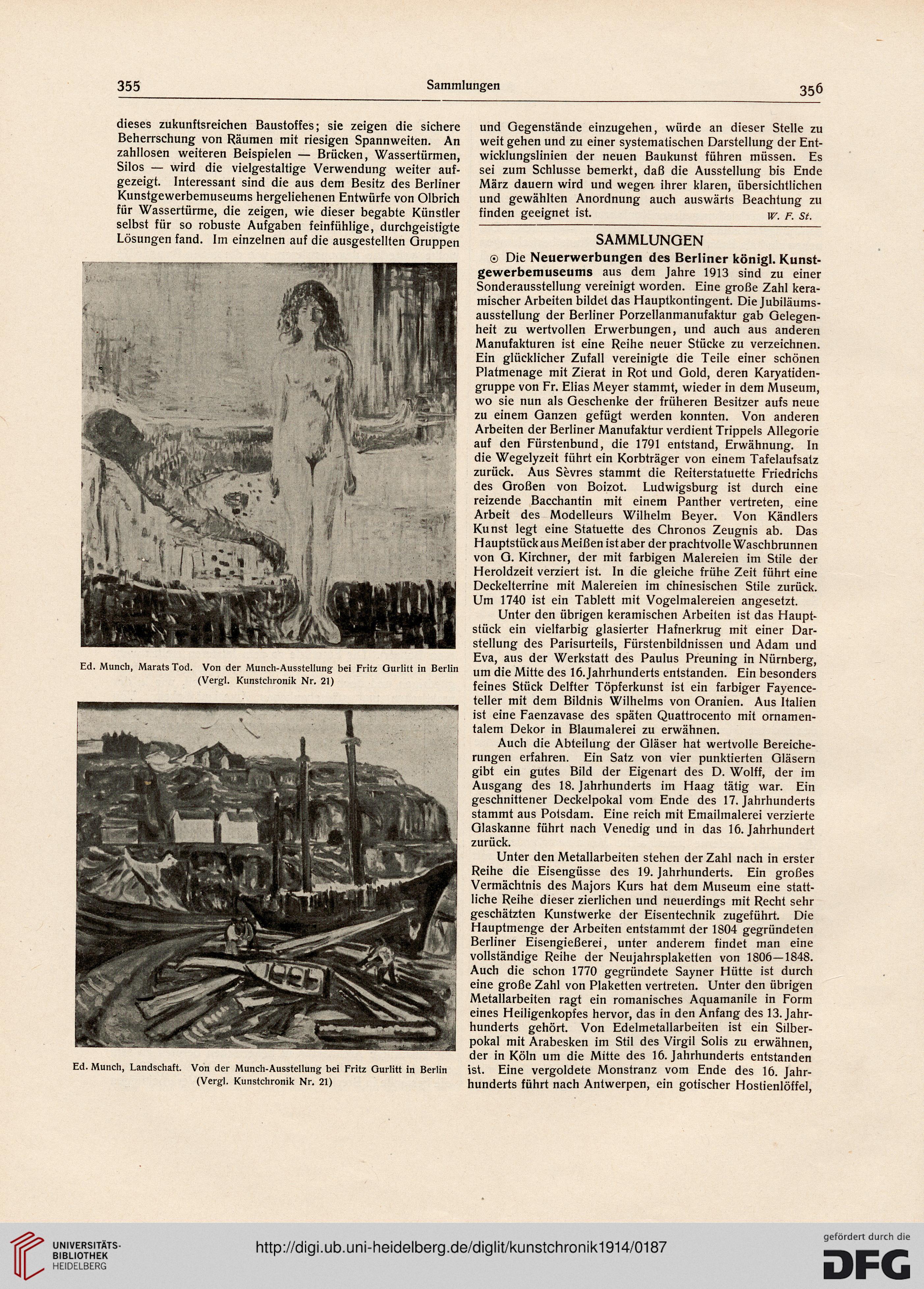355
Sammlungen
356
dieses zukunftsreichen Baustoffes; sie zeigen die sichere
Beherrschung von Räumen mit riesigen Spannweiten. An
zahllosen weiteren Beispielen — Brücken, Wassertürmen,
Silos — wird die vielgestaltige Verwendung weiter auf-
gezeigt. Interessant sind die aus dem Besitz des Berliner
Kunstgewerbemuseums hergeliehenen Entwürfe von Olbrich
für Wassertürme, die zeigen, wie dieser begabte Künstler
selbst für so robuste Aufgaben feinfühlige, durchgeistigte
Lösungen fand. Im einzelnen auf die ausgestellten Gruppen
Ed. Münch, MaratsTod. Von der Münch-Ausstellung bei Fritz Ourlitt in Berlin
(Vergl. Kunstchronik Nr. 21)
Ed. Münch, Landschaft. Von der Münch-Ausstellung bei Fritz Gurlitt in Berlin
(Vergl. Kunstchronik Nr. 21)
und Gegenstände einzugehen, würde an dieser Stelle zu
weit gehen und zu einer systematischen Darstellung der Ent-
wicklungslinien der neuen Baukunst führen müssen. Es
sei zum Schlüsse bemerkt, daß die Ausstellung bis Ende
März dauern wird und wegen ihrer klaren, übersichtlichen
und gewählten Anordnung auch auswärts Beachtung zu
finden geeignet ist. w. F. St.
SAMMLUNGEN
© Die Neuerwerbungen des Berliner königl. Kunst-
gewerbemuseums aus dem Jahre 1913 sind zu einer
Sonderausstellung vereinigt worden. Eine große Zahl kera-
mischer Arbeiten bildet das Hauptkontingent. Die Jubiläums-
ausstellung der Berliner Porzellanmanufaktur gab Gelegen-
heit zu wertvollen Erwerbungen, und auch aus anderen
Manufakturen ist eine Reihe neuer Stücke zu verzeichnen.
Ein glücklicher Zufall vereinigte die Teile einer schönen
Platmenage mit Zierat in Rot und Gold, deren Karyatiden-
gruppe von Fr. Elias Meyer stammt, wieder in dem Museum,
wo sie nun als Geschenke der früheren Besitzer aufs neue
zu einem Ganzen gefügt werden konnten. Von anderen
Arbeiten der Berliner Manufaktur verdient Trippeis Allegorie
auf den Fürstenbund, die 1791 entstand, Erwähnung. In
die Wegelyzeit führt ein Korbträger von einem Tafelaufsatz
zurück. Aus Sevres stammt die Reiterstatuette Friedrichs
des Großen von Boizot. Ludwigsburg ist durch eine
reizende Bacchantin mit einem Panther vertreten, eine
Arbeit des Modelleurs Wilhelm Beyer. Von Kändlers
Kunst legt eine Statuette des Chronos Zeugnis ab. Das
Hauptstück aus Meißen ist aber der prachtvolle Waschbrunnen
von G. Kirchner, der mit farbigen Malereien im Stile der
Heroldzeit verziert ist. In die gleiche frühe Zeit führt eine
Deckelterrine mit Malereien im chinesischen Stile zurück.
Um 1740 ist ein Tablett mit Vogelmalereien angesetzt.
Unter den übrigen keramischen Arbeiten ist das Haupt-
stück ein vielfarbig glasierter Hafnerkrug mit einer Dar-
stellung des Parisurteils, Fürstenbildnissen und Adam und
Eva, aus der Werkstatt des Paulus Preuning in Nürnberg,
um die Mitte des lö.Jahrhunderts entstanden. Ein besonders
feines Stück Delfter Töpferkunst ist ein farbiger Fayence-
teller mit dem Bildnis Wilhelms von Oranien. Aus Italien
ist eine Faenzavase des späten Quattrocento mit ornamen-
talem Dekor in Blaumalerei zu erwähnen.
Auch die Abteilung der Gläser hat wertvolle Bereiche-
rungen erfahren. Ein Satz von vier punktierten Gläsern
gibt ein gutes Bild der Eigenart des D. Wolff, der im
Ausgang des 18. Jahrhunderts im Haag tätig war. Ein
geschnittener Deckelpokal vom Ende des 17. Jahrhunderts
stammt aus Potsdam. Eine reich mit Emailmalerei verzierte
Glaskanne führt nach Venedig und in das 16. Jahrhundert
zurück.
Unter den Metallarbeiten stehen der Zahl nach in erster
Reihe die Eisengüsse des 19. Jahrhunderts. Ein großes
Vermächtnis des Majors Kurs hat dem Museum eine statt-
liche Reihe dieser zierlichen und neuerdings mit Recht sehr
geschätzten Kunstwerke der Eisentechnik zugeführt. Die
Hauptmenge der Arbeiten entstammt der 1804 gegründeten
Berliner Eisengießerei, unter anderem findet man eine
vollständige Reihe der Neujahrsplaketten von 1806—1848.
Auch die schon 1770 gegründete Sayner Hütte ist durch
eine große Zahl von Plaketten vertreten. Unter den übrigen
Metallarbeiten ragt ein romanisches Aquamanile in Form
eines Heiligenkopfes hervor, das in den Anfang des 13. Jahr-
hunderts gehört. Von Edelmetallarbeiten ist ein Silber-
pokal mit Arabesken im Stil des Virgil Solis zu erwähnen,
der in Köln um die Mitte des 16. Jahrhunderts entstanden
ist. Eine vergoldete Monstranz vom Ende des 16. Jahr-
hunderts führt nach Antwerpen, ein gotischer Hostienlöffel,
Sammlungen
356
dieses zukunftsreichen Baustoffes; sie zeigen die sichere
Beherrschung von Räumen mit riesigen Spannweiten. An
zahllosen weiteren Beispielen — Brücken, Wassertürmen,
Silos — wird die vielgestaltige Verwendung weiter auf-
gezeigt. Interessant sind die aus dem Besitz des Berliner
Kunstgewerbemuseums hergeliehenen Entwürfe von Olbrich
für Wassertürme, die zeigen, wie dieser begabte Künstler
selbst für so robuste Aufgaben feinfühlige, durchgeistigte
Lösungen fand. Im einzelnen auf die ausgestellten Gruppen
Ed. Münch, MaratsTod. Von der Münch-Ausstellung bei Fritz Ourlitt in Berlin
(Vergl. Kunstchronik Nr. 21)
Ed. Münch, Landschaft. Von der Münch-Ausstellung bei Fritz Gurlitt in Berlin
(Vergl. Kunstchronik Nr. 21)
und Gegenstände einzugehen, würde an dieser Stelle zu
weit gehen und zu einer systematischen Darstellung der Ent-
wicklungslinien der neuen Baukunst führen müssen. Es
sei zum Schlüsse bemerkt, daß die Ausstellung bis Ende
März dauern wird und wegen ihrer klaren, übersichtlichen
und gewählten Anordnung auch auswärts Beachtung zu
finden geeignet ist. w. F. St.
SAMMLUNGEN
© Die Neuerwerbungen des Berliner königl. Kunst-
gewerbemuseums aus dem Jahre 1913 sind zu einer
Sonderausstellung vereinigt worden. Eine große Zahl kera-
mischer Arbeiten bildet das Hauptkontingent. Die Jubiläums-
ausstellung der Berliner Porzellanmanufaktur gab Gelegen-
heit zu wertvollen Erwerbungen, und auch aus anderen
Manufakturen ist eine Reihe neuer Stücke zu verzeichnen.
Ein glücklicher Zufall vereinigte die Teile einer schönen
Platmenage mit Zierat in Rot und Gold, deren Karyatiden-
gruppe von Fr. Elias Meyer stammt, wieder in dem Museum,
wo sie nun als Geschenke der früheren Besitzer aufs neue
zu einem Ganzen gefügt werden konnten. Von anderen
Arbeiten der Berliner Manufaktur verdient Trippeis Allegorie
auf den Fürstenbund, die 1791 entstand, Erwähnung. In
die Wegelyzeit führt ein Korbträger von einem Tafelaufsatz
zurück. Aus Sevres stammt die Reiterstatuette Friedrichs
des Großen von Boizot. Ludwigsburg ist durch eine
reizende Bacchantin mit einem Panther vertreten, eine
Arbeit des Modelleurs Wilhelm Beyer. Von Kändlers
Kunst legt eine Statuette des Chronos Zeugnis ab. Das
Hauptstück aus Meißen ist aber der prachtvolle Waschbrunnen
von G. Kirchner, der mit farbigen Malereien im Stile der
Heroldzeit verziert ist. In die gleiche frühe Zeit führt eine
Deckelterrine mit Malereien im chinesischen Stile zurück.
Um 1740 ist ein Tablett mit Vogelmalereien angesetzt.
Unter den übrigen keramischen Arbeiten ist das Haupt-
stück ein vielfarbig glasierter Hafnerkrug mit einer Dar-
stellung des Parisurteils, Fürstenbildnissen und Adam und
Eva, aus der Werkstatt des Paulus Preuning in Nürnberg,
um die Mitte des lö.Jahrhunderts entstanden. Ein besonders
feines Stück Delfter Töpferkunst ist ein farbiger Fayence-
teller mit dem Bildnis Wilhelms von Oranien. Aus Italien
ist eine Faenzavase des späten Quattrocento mit ornamen-
talem Dekor in Blaumalerei zu erwähnen.
Auch die Abteilung der Gläser hat wertvolle Bereiche-
rungen erfahren. Ein Satz von vier punktierten Gläsern
gibt ein gutes Bild der Eigenart des D. Wolff, der im
Ausgang des 18. Jahrhunderts im Haag tätig war. Ein
geschnittener Deckelpokal vom Ende des 17. Jahrhunderts
stammt aus Potsdam. Eine reich mit Emailmalerei verzierte
Glaskanne führt nach Venedig und in das 16. Jahrhundert
zurück.
Unter den Metallarbeiten stehen der Zahl nach in erster
Reihe die Eisengüsse des 19. Jahrhunderts. Ein großes
Vermächtnis des Majors Kurs hat dem Museum eine statt-
liche Reihe dieser zierlichen und neuerdings mit Recht sehr
geschätzten Kunstwerke der Eisentechnik zugeführt. Die
Hauptmenge der Arbeiten entstammt der 1804 gegründeten
Berliner Eisengießerei, unter anderem findet man eine
vollständige Reihe der Neujahrsplaketten von 1806—1848.
Auch die schon 1770 gegründete Sayner Hütte ist durch
eine große Zahl von Plaketten vertreten. Unter den übrigen
Metallarbeiten ragt ein romanisches Aquamanile in Form
eines Heiligenkopfes hervor, das in den Anfang des 13. Jahr-
hunderts gehört. Von Edelmetallarbeiten ist ein Silber-
pokal mit Arabesken im Stil des Virgil Solis zu erwähnen,
der in Köln um die Mitte des 16. Jahrhunderts entstanden
ist. Eine vergoldete Monstranz vom Ende des 16. Jahr-
hunderts führt nach Antwerpen, ein gotischer Hostienlöffel,