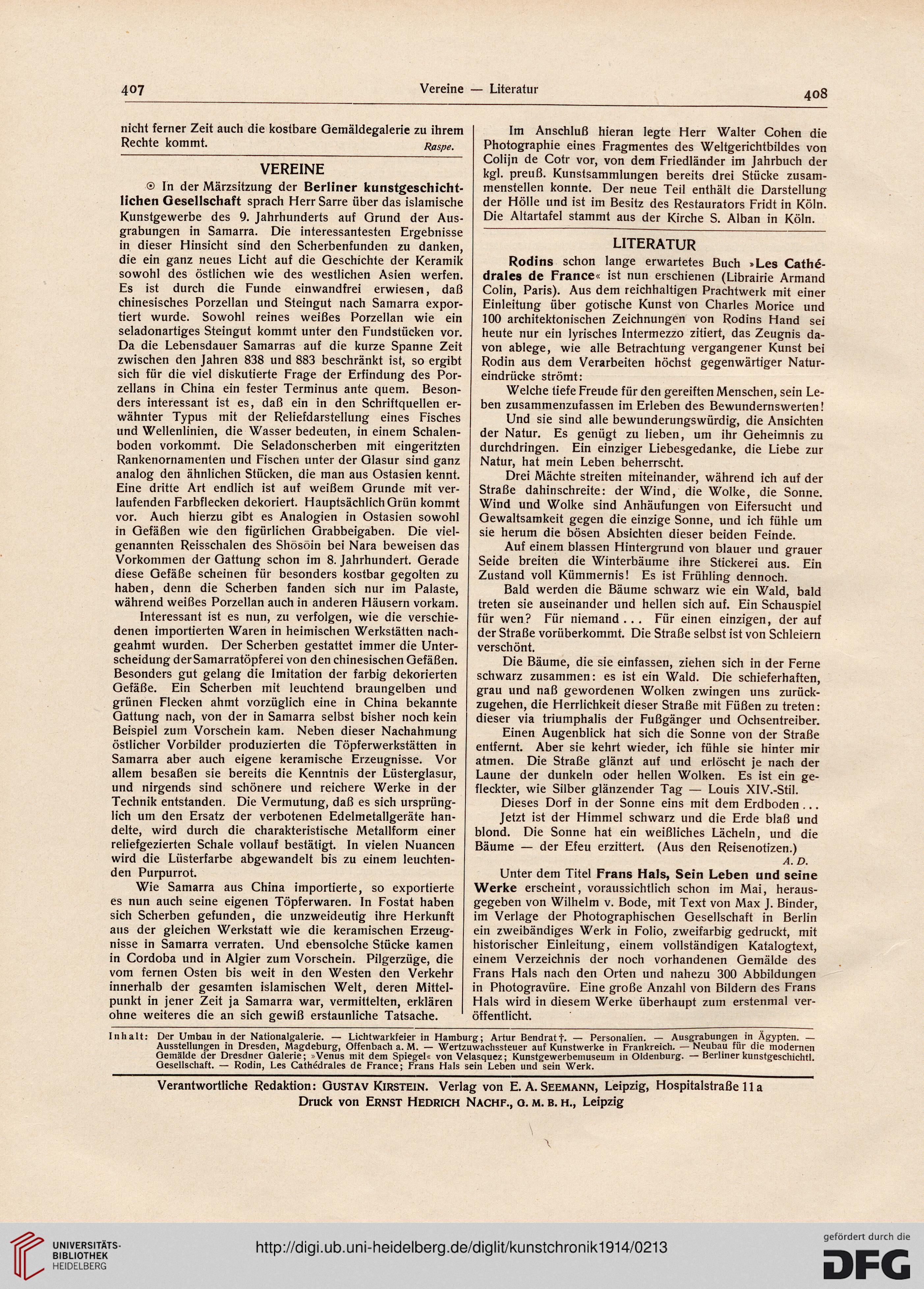407
Vereine — Literatur
408
nicht ferner Zeit auch die kostbare Gemäldegalerie zu ihrem
Rechte kommt. Raspe.
VEREINE
® In der Märzsitzung der Berliner kunstgeschicht-
lichen Gesellschaft sprach Herr Sarre über das islamische
Kunstgewerbe des 9. Jahrhunderts auf Grund der Aus-
grabungen in Samarra. Die interessantesten Ergebnisse
in dieser Hinsicht sind den Scherbenfunden zu danken,
die ein ganz neues Licht auf die Geschichte der Keramik
sowohl des östlichen wie des westlichen Asien werfen.
Es ist durch die Funde einwandfrei erwiesen, daß
chinesisches Porzellan und Steingut nach Samarra expor-
tiert wurde. Sowohl reines weißes Porzellan wie ein
seladonartiges Steingut kommt unter den Fundstücken vor.
Da die Lebensdauer Samarras auf die kurze Spanne Zeit
zwischen den Jahren 838 und 883 beschränkt ist, so ergibt
sich für die viel diskutierte Frage der Erfindung des Por-
zellans in China ein fester Terminus ante quem. Beson-
ders interessant ist es, daß ein in den Schriftquellen er-
wähnter Typus mit der Reliefdarstellung eines Fisches
und Wellenlinien, die Wasser bedeuten, in einem Schalen-
boden vorkommt. Die Seladonscherben mit eingeritzten
Rankenornamenlen und Fischen unter der Glasur sind ganz
analog den ähnlichen Stücken, die man aus Ostasien kennt.
Eine dritte Art endlich ist auf weißem Grunde mit ver-
laufenden Farbflecken dekoriert. Hauptsächlich Grün kommt
vor. Auch hierzu gibt es Analogien in Ostasien sowohl
in Gefäßen wie den figürlichen Grabbeigäben. Die viel-
genannten Reisschalen des Shösöin bei Nara beweisen das
Vorkommen der Gattung schon im 8. Jahrhundert. Gerade
diese Gefäße scheinen für besonders kostbar gegolten zu
haben, denn die Scherben fanden sich nur im Palaste,
während weißes Porzellan auch in anderen Häusern vorkam.
Interessant ist es nun, zu verfolgen, wie die verschie-
denen importierten Waren in heimischen Werkstätten nach-
geahmt wurden. Der Scherben gestattet immer die Unter-
scheidung derSamarratöpferei von den chinesischen Gefäßen.
Besonders gut gelang die Imitation der farbig dekorierten
Gefäße. Ein Scherben mit leuchtend braungelben und
grünen Flecken ahmt vorzüglich eine in China bekannte
Gattung nach, von der in Samarra selbst bisher noch kein
Beispiel zum Vorschein kam. Neben dieser Nachahmung
östlicher Vorbilder produzierten die Töpferwerkstätten in
Samarra aber auch eigene keramische Erzeugnisse. Vor
allem besaßen sie bereits die Kenntnis der Lüsterglasur,
und nirgends sind schönere und reichere Werke in der
Technik entstanden. Die Vermutung, daß es sich ursprüng-
lich um den Ersatz der verbotenen Edelmetallgeräte han-
delte, wird durch die charakteristische Metallform einer
reliefgezierten Schale vollauf bestätigt. In vielen Nuancen
wird die Lüsterfarbe abgewandelt bis zu einem leuchten-
den Purpurrot.
Wie Samarra aus China importierte, so exportierte
es nun auch seine eigenen Töpferwaren. In Fostat haben
sich Scherben gefunden, die unzweideutig ihre Herkunft
aus der gleichen Werkstatt wie die keramischen Erzeug-
nisse in Samarra verraten. Und ebensolche Stücke kamen
in Cordoba und in Algier zum Vorschein. Pilgerzüge, die
vom fernen Osten bis weit in den Westen den Verkehr
innerhalb der gesamten islamischen Welt, deren Mittel-
punkt in jener Zeit ja Samarra war, vermittelten, erklären
ohne weiteres die an sich gewiß erstaunliche Tatsache.
Im Anschluß hieran legte Herr Walter Cohen die
Photographie eines Fragmentes des Weltgerichtbildes von
Colijn de Cotr vor, von dem Friedländer im Jahrbuch der
kgl. preuß. Kunstsammlungen bereits drei Stücke zusam-
menstellen konnte. Der neue Teil enthält die Darstellung
der Hölle und ist im Besitz des Restaurators Fridt in Köln.
Die Altartafel stammt aus der Kirche S. Alban in Köln.
LITERATUR
Rodins schon lange erwartetes Buch »Les Cath£-
drales de France« ist nun erschienen (Librairie Armand
Colin, Paris). Aus dem reichhaltigen Prachtwerk mit einer
Einleitung über gotische Kunst von Charles Morice und
100 architektonischen Zeichnungen von Rodins Hand sei
heute nur ein lyrisches Intermezzo zitiert, das Zeugnis da-
von ablege, wie alle Betrachtung vergangener Kunst bei
Rodin aus dem Verarbeiten höchst gegenwärtiger Natur-
eindrücke strömt:
Welche tiefe Freude für den gereiften Menschen, sein Le-
ben zusammenzufassen im Erleben des Bewundernswerten!
Und sie sind alle bewunderungswürdig, die Ansichten
der Natur. Es genügt zu lieben, um ihr Geheimnis zu
durchdringen. Ein einziger Liebesgedanke, die Liebe zur
Natur, hat mein Leben beherrscht.
Drei Mächte streiten miteinander, während ich auf der
Straße dahinschreite: der Wind, die Wolke, die Sonne.
Wind und Wolke sind Anhäufungen von Eifersucht und
Gewaltsamkeit gegen die einzige Sonne, und ich fühle um
sie herum die bösen Absichten dieser beiden Feinde.
Auf einem blassen Hintergrund von blauer und grauer
Seide breiten die Winterbäume ihre Stickerei aus. Ein
Zustand voll Kümmernis! Es ist Frühling dennoch.
Bald werden die Bäume schwarz wie ein Wald, bald
treten sie auseinander und hellen sich auf. Ein Schauspiel
für wen? Für niemand ... Für einen einzigen, der auf
der Straße vorüberkommt. Die Straße selbst ist von Schleiern
verschönt.
Die Bäume, die sie einfassen, ziehen sich in der Ferne
schwarz zusammen: es ist ein Wald. Die schieferhaften,
grau und naß gewordenen Wolken zwingen uns zurück-
zugehen, die Herrlichkeit dieser Straße mit Füßen zu treten:
dieser via triumphalis der Fußgänger und Ochsentreiber.
Einen Augenblick hat sich die Sonne von der Straße
entfernt. Aber sie kehrt wieder, ich fühle sie hinter mir
atmen. Die Straße glänzt auf und erlöscht je nach der
Laune der dunkeln oder hellen Wolken. Es ist ein ge-
fleckter, wie Silber glänzender Tag — Louis XlV.-Stil.
Dieses Dorf in der Sonne eins mit dem Erdboden...
Jetzt ist der Himmel schwarz und die Erde blaß und
blond. Die Sonne hat ein weißliches Lächeln, und die
Bäume — der Efeu erzittert. (Aus den Reisenotizen.)
A. D.
Unter dem Titel Frans Hals, Sein Leben und seine
Werke erscheint, voraussichtlich schon im Mai, heraus-
gegeben von Wilhelm v. Bode, mit Text von Max J. Binder,
im Verlage der Photographischen Gesellschaft in Berlin
ein zweibändiges Werk in Folio, zweifarbig gedruckt, mit
historischer Einleitung, einem vollständigen Katalogtext,
einem Verzeichnis der noch vorhandenen Gemälde des
Frans Hals nach den Orten und nahezu 300 Abbildungen
in Photogravüre. Eine große Anzahl von Bildern des Frans
Hals wird in diesem Werke überhaupt zum erstenmal ver-
öffentlicht.
Inhalt: Der Umbau in der Nationalgalerie. — Lichtwarkfeier in Hamburg; Artur Bendratf. — Personalien. — Ausgrabungen in Ägypten. —
Ausstellungen in Dresden, Magdeburg, Olfenbach a. M. — Wertzuwachssteuer auf Kunstwerke in Frankreich. — Neubau für die modernen
Gemälde der Dresdner Galerie; »Venus mit dem Spiegel« von Velasquez; Kunstgewerbemuseum in Oldenburg. — Berliner kunstgeschichtl.
Gesellschaft. — Rodin, Les Cathedrales de France; Frans Hals sein Leben und sein Werk.
Verantwortliche Redaktion: Gustav Kirstein. Verlag von E.A.Seemann, Leipzig, Hospitalstraßella
Druck von Ernst Hedrich Nachf., o. m. b. h., Leipzig
\
\
Vereine — Literatur
408
nicht ferner Zeit auch die kostbare Gemäldegalerie zu ihrem
Rechte kommt. Raspe.
VEREINE
® In der Märzsitzung der Berliner kunstgeschicht-
lichen Gesellschaft sprach Herr Sarre über das islamische
Kunstgewerbe des 9. Jahrhunderts auf Grund der Aus-
grabungen in Samarra. Die interessantesten Ergebnisse
in dieser Hinsicht sind den Scherbenfunden zu danken,
die ein ganz neues Licht auf die Geschichte der Keramik
sowohl des östlichen wie des westlichen Asien werfen.
Es ist durch die Funde einwandfrei erwiesen, daß
chinesisches Porzellan und Steingut nach Samarra expor-
tiert wurde. Sowohl reines weißes Porzellan wie ein
seladonartiges Steingut kommt unter den Fundstücken vor.
Da die Lebensdauer Samarras auf die kurze Spanne Zeit
zwischen den Jahren 838 und 883 beschränkt ist, so ergibt
sich für die viel diskutierte Frage der Erfindung des Por-
zellans in China ein fester Terminus ante quem. Beson-
ders interessant ist es, daß ein in den Schriftquellen er-
wähnter Typus mit der Reliefdarstellung eines Fisches
und Wellenlinien, die Wasser bedeuten, in einem Schalen-
boden vorkommt. Die Seladonscherben mit eingeritzten
Rankenornamenlen und Fischen unter der Glasur sind ganz
analog den ähnlichen Stücken, die man aus Ostasien kennt.
Eine dritte Art endlich ist auf weißem Grunde mit ver-
laufenden Farbflecken dekoriert. Hauptsächlich Grün kommt
vor. Auch hierzu gibt es Analogien in Ostasien sowohl
in Gefäßen wie den figürlichen Grabbeigäben. Die viel-
genannten Reisschalen des Shösöin bei Nara beweisen das
Vorkommen der Gattung schon im 8. Jahrhundert. Gerade
diese Gefäße scheinen für besonders kostbar gegolten zu
haben, denn die Scherben fanden sich nur im Palaste,
während weißes Porzellan auch in anderen Häusern vorkam.
Interessant ist es nun, zu verfolgen, wie die verschie-
denen importierten Waren in heimischen Werkstätten nach-
geahmt wurden. Der Scherben gestattet immer die Unter-
scheidung derSamarratöpferei von den chinesischen Gefäßen.
Besonders gut gelang die Imitation der farbig dekorierten
Gefäße. Ein Scherben mit leuchtend braungelben und
grünen Flecken ahmt vorzüglich eine in China bekannte
Gattung nach, von der in Samarra selbst bisher noch kein
Beispiel zum Vorschein kam. Neben dieser Nachahmung
östlicher Vorbilder produzierten die Töpferwerkstätten in
Samarra aber auch eigene keramische Erzeugnisse. Vor
allem besaßen sie bereits die Kenntnis der Lüsterglasur,
und nirgends sind schönere und reichere Werke in der
Technik entstanden. Die Vermutung, daß es sich ursprüng-
lich um den Ersatz der verbotenen Edelmetallgeräte han-
delte, wird durch die charakteristische Metallform einer
reliefgezierten Schale vollauf bestätigt. In vielen Nuancen
wird die Lüsterfarbe abgewandelt bis zu einem leuchten-
den Purpurrot.
Wie Samarra aus China importierte, so exportierte
es nun auch seine eigenen Töpferwaren. In Fostat haben
sich Scherben gefunden, die unzweideutig ihre Herkunft
aus der gleichen Werkstatt wie die keramischen Erzeug-
nisse in Samarra verraten. Und ebensolche Stücke kamen
in Cordoba und in Algier zum Vorschein. Pilgerzüge, die
vom fernen Osten bis weit in den Westen den Verkehr
innerhalb der gesamten islamischen Welt, deren Mittel-
punkt in jener Zeit ja Samarra war, vermittelten, erklären
ohne weiteres die an sich gewiß erstaunliche Tatsache.
Im Anschluß hieran legte Herr Walter Cohen die
Photographie eines Fragmentes des Weltgerichtbildes von
Colijn de Cotr vor, von dem Friedländer im Jahrbuch der
kgl. preuß. Kunstsammlungen bereits drei Stücke zusam-
menstellen konnte. Der neue Teil enthält die Darstellung
der Hölle und ist im Besitz des Restaurators Fridt in Köln.
Die Altartafel stammt aus der Kirche S. Alban in Köln.
LITERATUR
Rodins schon lange erwartetes Buch »Les Cath£-
drales de France« ist nun erschienen (Librairie Armand
Colin, Paris). Aus dem reichhaltigen Prachtwerk mit einer
Einleitung über gotische Kunst von Charles Morice und
100 architektonischen Zeichnungen von Rodins Hand sei
heute nur ein lyrisches Intermezzo zitiert, das Zeugnis da-
von ablege, wie alle Betrachtung vergangener Kunst bei
Rodin aus dem Verarbeiten höchst gegenwärtiger Natur-
eindrücke strömt:
Welche tiefe Freude für den gereiften Menschen, sein Le-
ben zusammenzufassen im Erleben des Bewundernswerten!
Und sie sind alle bewunderungswürdig, die Ansichten
der Natur. Es genügt zu lieben, um ihr Geheimnis zu
durchdringen. Ein einziger Liebesgedanke, die Liebe zur
Natur, hat mein Leben beherrscht.
Drei Mächte streiten miteinander, während ich auf der
Straße dahinschreite: der Wind, die Wolke, die Sonne.
Wind und Wolke sind Anhäufungen von Eifersucht und
Gewaltsamkeit gegen die einzige Sonne, und ich fühle um
sie herum die bösen Absichten dieser beiden Feinde.
Auf einem blassen Hintergrund von blauer und grauer
Seide breiten die Winterbäume ihre Stickerei aus. Ein
Zustand voll Kümmernis! Es ist Frühling dennoch.
Bald werden die Bäume schwarz wie ein Wald, bald
treten sie auseinander und hellen sich auf. Ein Schauspiel
für wen? Für niemand ... Für einen einzigen, der auf
der Straße vorüberkommt. Die Straße selbst ist von Schleiern
verschönt.
Die Bäume, die sie einfassen, ziehen sich in der Ferne
schwarz zusammen: es ist ein Wald. Die schieferhaften,
grau und naß gewordenen Wolken zwingen uns zurück-
zugehen, die Herrlichkeit dieser Straße mit Füßen zu treten:
dieser via triumphalis der Fußgänger und Ochsentreiber.
Einen Augenblick hat sich die Sonne von der Straße
entfernt. Aber sie kehrt wieder, ich fühle sie hinter mir
atmen. Die Straße glänzt auf und erlöscht je nach der
Laune der dunkeln oder hellen Wolken. Es ist ein ge-
fleckter, wie Silber glänzender Tag — Louis XlV.-Stil.
Dieses Dorf in der Sonne eins mit dem Erdboden...
Jetzt ist der Himmel schwarz und die Erde blaß und
blond. Die Sonne hat ein weißliches Lächeln, und die
Bäume — der Efeu erzittert. (Aus den Reisenotizen.)
A. D.
Unter dem Titel Frans Hals, Sein Leben und seine
Werke erscheint, voraussichtlich schon im Mai, heraus-
gegeben von Wilhelm v. Bode, mit Text von Max J. Binder,
im Verlage der Photographischen Gesellschaft in Berlin
ein zweibändiges Werk in Folio, zweifarbig gedruckt, mit
historischer Einleitung, einem vollständigen Katalogtext,
einem Verzeichnis der noch vorhandenen Gemälde des
Frans Hals nach den Orten und nahezu 300 Abbildungen
in Photogravüre. Eine große Anzahl von Bildern des Frans
Hals wird in diesem Werke überhaupt zum erstenmal ver-
öffentlicht.
Inhalt: Der Umbau in der Nationalgalerie. — Lichtwarkfeier in Hamburg; Artur Bendratf. — Personalien. — Ausgrabungen in Ägypten. —
Ausstellungen in Dresden, Magdeburg, Olfenbach a. M. — Wertzuwachssteuer auf Kunstwerke in Frankreich. — Neubau für die modernen
Gemälde der Dresdner Galerie; »Venus mit dem Spiegel« von Velasquez; Kunstgewerbemuseum in Oldenburg. — Berliner kunstgeschichtl.
Gesellschaft. — Rodin, Les Cathedrales de France; Frans Hals sein Leben und sein Werk.
Verantwortliche Redaktion: Gustav Kirstein. Verlag von E.A.Seemann, Leipzig, Hospitalstraßella
Druck von Ernst Hedrich Nachf., o. m. b. h., Leipzig
\
\