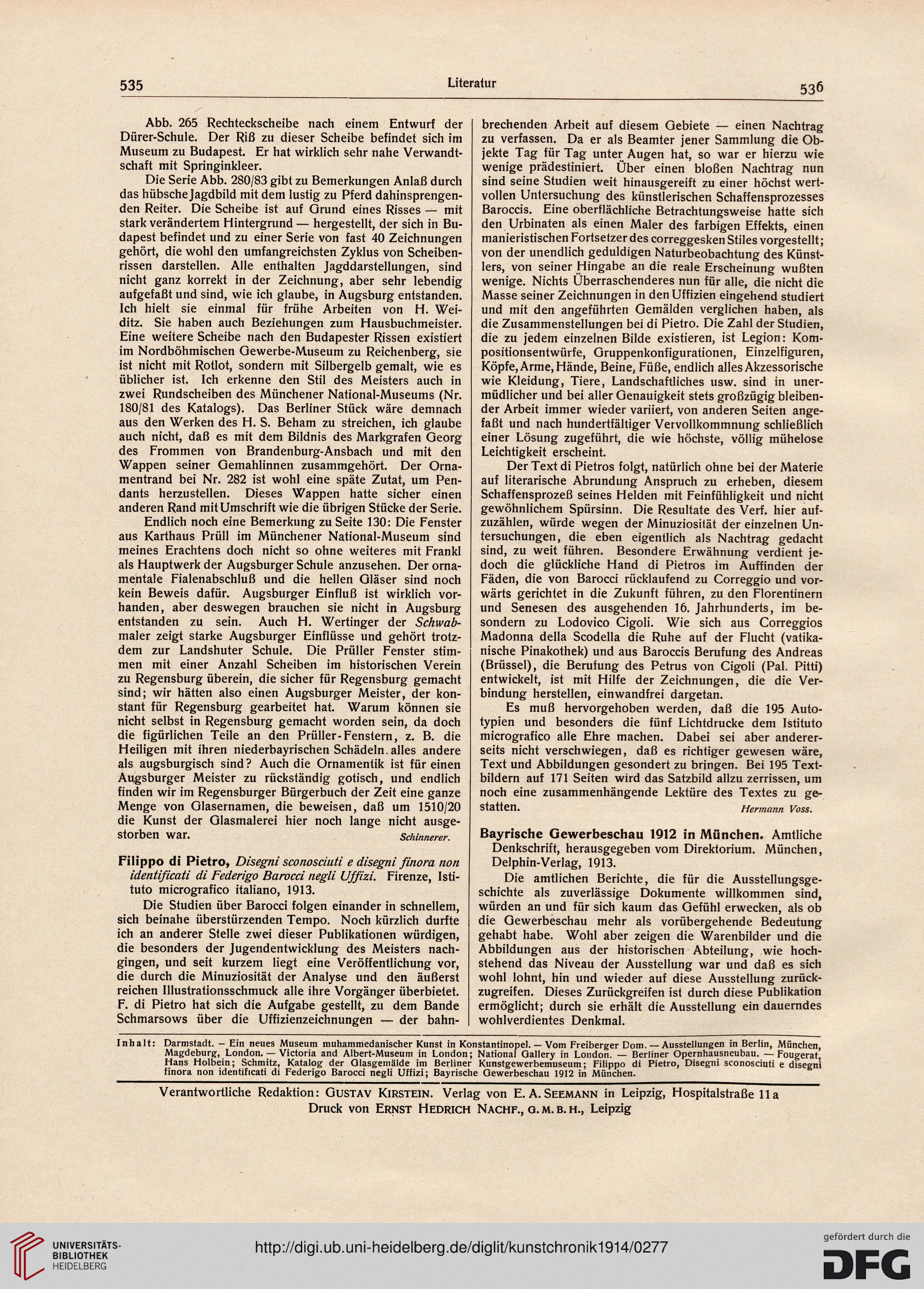535
Literatur
536
Abb. 265 Rechteckscheibe nach einem Entwurf der
Dürer-Schule. Der Riß zu dieser Scheibe befindet sich im
Museum zu Budapest. Er hat wirklich sehr nahe Verwandt-
schaft mit Springinkleer.
Die Serie Abb. 280/83 gibt zu Bemerkungen Anlaß durch
das hübschejagdbild mit dem lustig zu Pferd dahinsprengen-
den Reiter. Die Scheibe ist auf Grund eines Risses — mit
stark verändertem Hintergrund — hergestellt, der sich in Bu-
dapest befindet und zu einer Serie von fast 40 Zeichnungen
gehört, die wohl den umfangreichsten Zyklus von Scheiben-
rissen darstellen. Alle enthalten Jagddarstellungen, sind
nicht ganz korrekt in der Zeichnung, aber sehr lebendig
aufgefaßt und sind, wie ich glaube, in Augsburg entstanden.
Ich hielt sie einmal für frühe Arbeiten von H. Wei-
ditz. Sie haben auch Beziehungen zum Hausbuchmeister.
Eine weitere Scheibe nach den Budapester Rissen existiert
im Nordböhmischen Gewerbe-Museum zu Reichenberg, sie
ist nicht mit Rotlot, sondern mit Silbergelb gemalt, wie es
üblicher ist. Ich erkenne den Stil des Meisters auch in
zwei Rundscheiben des Münchener National-Museums (Nr.
180/81 des Katalogs). Das Berliner Stück wäre demnach
aus den Werken des H. S. Beham zu streichen, ich glaube
auch nicht, daß es mit dem Bildnis des Markgrafen Georg
des Frommen von Brandenburg-Ansbach und mit den
Wappen seiner Gemahlinnen zusammgehört. Der Orna-
mentrand bei Nr. 282 ist wohl eine späte Zutat, um Pen-
dants herzustellen. Dieses Wappen hatte sicher einen
anderen Rand mit Umschrift wie die übrigen Stücke der Serie.
Endlich noch eine Bemerkung zu Seite 130: Die Fenster
aus Karthaus Prüll im Münchener National-Museum sind
meines Erachtens doch nicht so ohne weiteres mit Frankl
als Hauptwerk der Augsburger Schule anzusehen. Der orna-
mentale Fialenabschluß und die hellen Gläser sind noch
kein Beweis dafür. Augsburger Einfluß ist wirklich vor-
handen, aber deswegen brauchen sie nicht in Augsburg
entstanden zu sein. Auch H. Wertinger der Schwab-
malet zeigt starke Augsburger Einflüsse und gehört trotz-
dem zur Landshuter Schule. Die Prüller Fenster stim-
men mit einer Anzahl Scheiben im historischen Verein
zu Regensburg überein, die sicher für Regensburg gemacht
sind; wir hätten also einen Augsburger Meister, der kon-
stant für Regensburg gearbeitet hat. Warum können sie
nicht selbst in Regensburg gemacht worden sein, da doch
die figürlichen Teile an den Prüller-Fenstern, z. B. die
Heiligen mit ihren niederbayrischen Schädeln, alles andere
als augsburgisch sind? Auch die Ornamentik ist für einen
Augsburger Meister zu rückständig gotisch, und endlich
finden wir im Regensburger Bürgerbuch der Zeit eine ganze
Menge von Glasernamen, die beweisen, daß um 1510/20
die Kunst der Glasmalerei hier noch lange nicht ausge-
storben war. Schinnerer.
Filippo di Pietro, Disegni sconosciuti e disegni finora non
identificati di Federigo Barocci negä Uffizi. Firenze, Isti-
tuto micrografico italiano, 1913.
Die Studien über Barocci folgen einander in schnellem,
sich beinahe überstürzenden Tempo. Noch kürzlich durfte
ich an anderer Stelle zwei dieser Publikationen würdigen,
die besonders der Jugendentwicklung des Meisters nach-
gingen, und seit kurzem liegt eine Veröffentlichung vor,
die durch die Minuziosität der Analyse und den äußerst
reichen Illustrationsschmuck alle ihre Vorgänger überbietet.
F. di Pietro hat sich die Aufgabe gestellt, zu dem Bande
Schmarsows über die Uffizienzeichnungen — der bahn-
Inhalt:
brechenden Arbeit auf diesem Gebiete — einen Nachtrag
zu verfassen. Da er als Beamter jener Sammlung die Ob-
jekte Tag für Tag unter Augen hat, so war er hierzu wie
wenige prädestiniert. Über einen bloßen Nachtrag nun
sind seine Studien weit hinausgereift zu einer höchst wert-
vollen Untersuchung des künstlerischen Schaffensprozesses
Baroccis. Eine oberflächliche Betrachtungsweise hatte sich
den Urbinaten als einen Maler des farbigen Effekts, einen
manieristischen Fortsetzer des correggesken Stiles vorgestellt;
von der unendlich geduldigen Naturbeobachtung des Künst-
lers, von seiner Hingabe an die reale Erscheinung wußten
wenige. Nichts Überraschenderes nun für alle, die nicht die
Masse seiner Zeichnungen in den Uffizien eingehend studiert
und mit den angeführten Gemälden verglichen haben, als
die Zusammenstellungen bei di Pietro. Die Zahl der Studien,
die zu jedem einzelnen Bilde existieren, ist Legion: Kom-
positionsentwürfe, Gruppenkonfigurationen, Einzelfiguren,
Köpfe, Arme, Hände, Beine, Füße, endlich alles Akzessorische
wie Kleidung, Tiere, Landschaftliches usw. sind in uner-
müdlicher und bei aller Genauigkeit stets großzügig bleiben-
der Arbeit immer wieder variiert, von anderen Seiten ange-
faßt und nach hundertfältiger Vervollkommnung schließlich
einer Lösung zugeführt, die wie höchste, völlig mühelose
Leichtigkeit erscheint.
Der Text di Pietros folgt, natürlich ohne bei der Materie
auf literarische Abrundung Anspruch zu erheben, diesem
Schaffensprozeß seines Helden mit Feinfühligkeit und nicht
gewöhnlichem Spürsinn. Die Resultate des Verf. hier auf-
zuzählen, würde wegen der Minuziosität der einzelnen Un-
tersuchungen, die eben eigentlich als Nachtrag gedacht
sind, zu weit führen. Besondere Erwähnung verdient je-
doch die glückliche Hand di Pietros im Auffinden der
Fäden, die von Barocci rücklaufend zu Correggio und vor-
wärts gerichtet in die Zukunft führen, zu den Florentinern
und Senesen des ausgehenden 16. Jahrhunderts, im be-
sondern zu Lodovico Cigoli. Wie sich aus Correggios
Madonna della Scodella die Ruhe auf der Flucht (vatika-
nische Pinakothek) und aus Baroccis Berufung des Andreas
(Brüssel), die Berufung des Petrus von Cigoli (Pal. Pitti)
entwickelt, ist mit Hilfe der Zeichnungen, die die Ver-
bindung herstellen, einwandfrei dargetan.
Es muß hervorgehoben werden, daß die 195 Auto-
typien und besonders die fünf Lichtdrucke dem Istituto
micrografico alle Ehre machen. Dabei sei aber anderer-
seits nicht verschwiegen, daß es richtiger gewesen wäre,
Text und Abbildungen gesondert zu bringen. Bei 195 Text-
bildern auf 171 Seiten wird das Satzbild allzu zerrissen, um
noch eine zusammenhängende Lektüre des Textes zu ge-
statten. Hermann Voss.
Bayrische Gewerbeschau 1912 in München. Amtliche
Denkschrift, herausgegeben vom Direktorium. München,
Delphin-Verlag, 1913.
Die amtlichen Berichte, die für die Ausstellungsge-
schichte als zuverlässige Dokumente willkommen sind,
würden an und für sich kaum das Gefühl erwecken, als ob
die Gewerbeschau mehr als vorübergehende Bedeutung
gehabt habe. Wohl aber zeigen die Warenbilder und die
Abbildungen aus der historischen Abteilung, wie hoch-
stehend das Niveau der Ausstellung war und daß es sich
wohl lohnt, hin und wieder auf diese Ausstellung zurück-
zugreifen. Dieses Zurückgreifen ist durch diese Publikation
ermöglicht; durch sie erhält die Ausstellung ein dauerndes
wohlverdientes Denkmal.
Darmstadt. - Ein neues Museum muhammedanischer Kunst in Konstantinopel. — Vom Freiberger Dom. — Ausstellungen in Berlin, München,
Magdeburg, London. — Victoria and Albert-Museum in London; National Oallery in London. — Berliner Opernhausneubau. ■—Fougerat,
Hans Holbein; Schmitz, Katalog der Olasgemälde im Berliner Kunstgewerbemuseum; Filippo di Pietro, Disegni sconosciuti e disegni
finora non identificati di Federigo Barocci negli Uffizi; Bayrische Oewerbeschau 1912 in München.
Verantwortliche Redaktion: Gustav Kirstein. Verlag von E.A.Seemann in Leipzig, Hospitalstraße IIa
Druck von Ernst Hedrich Nachf., o. m. b. h., Leipzig
Literatur
536
Abb. 265 Rechteckscheibe nach einem Entwurf der
Dürer-Schule. Der Riß zu dieser Scheibe befindet sich im
Museum zu Budapest. Er hat wirklich sehr nahe Verwandt-
schaft mit Springinkleer.
Die Serie Abb. 280/83 gibt zu Bemerkungen Anlaß durch
das hübschejagdbild mit dem lustig zu Pferd dahinsprengen-
den Reiter. Die Scheibe ist auf Grund eines Risses — mit
stark verändertem Hintergrund — hergestellt, der sich in Bu-
dapest befindet und zu einer Serie von fast 40 Zeichnungen
gehört, die wohl den umfangreichsten Zyklus von Scheiben-
rissen darstellen. Alle enthalten Jagddarstellungen, sind
nicht ganz korrekt in der Zeichnung, aber sehr lebendig
aufgefaßt und sind, wie ich glaube, in Augsburg entstanden.
Ich hielt sie einmal für frühe Arbeiten von H. Wei-
ditz. Sie haben auch Beziehungen zum Hausbuchmeister.
Eine weitere Scheibe nach den Budapester Rissen existiert
im Nordböhmischen Gewerbe-Museum zu Reichenberg, sie
ist nicht mit Rotlot, sondern mit Silbergelb gemalt, wie es
üblicher ist. Ich erkenne den Stil des Meisters auch in
zwei Rundscheiben des Münchener National-Museums (Nr.
180/81 des Katalogs). Das Berliner Stück wäre demnach
aus den Werken des H. S. Beham zu streichen, ich glaube
auch nicht, daß es mit dem Bildnis des Markgrafen Georg
des Frommen von Brandenburg-Ansbach und mit den
Wappen seiner Gemahlinnen zusammgehört. Der Orna-
mentrand bei Nr. 282 ist wohl eine späte Zutat, um Pen-
dants herzustellen. Dieses Wappen hatte sicher einen
anderen Rand mit Umschrift wie die übrigen Stücke der Serie.
Endlich noch eine Bemerkung zu Seite 130: Die Fenster
aus Karthaus Prüll im Münchener National-Museum sind
meines Erachtens doch nicht so ohne weiteres mit Frankl
als Hauptwerk der Augsburger Schule anzusehen. Der orna-
mentale Fialenabschluß und die hellen Gläser sind noch
kein Beweis dafür. Augsburger Einfluß ist wirklich vor-
handen, aber deswegen brauchen sie nicht in Augsburg
entstanden zu sein. Auch H. Wertinger der Schwab-
malet zeigt starke Augsburger Einflüsse und gehört trotz-
dem zur Landshuter Schule. Die Prüller Fenster stim-
men mit einer Anzahl Scheiben im historischen Verein
zu Regensburg überein, die sicher für Regensburg gemacht
sind; wir hätten also einen Augsburger Meister, der kon-
stant für Regensburg gearbeitet hat. Warum können sie
nicht selbst in Regensburg gemacht worden sein, da doch
die figürlichen Teile an den Prüller-Fenstern, z. B. die
Heiligen mit ihren niederbayrischen Schädeln, alles andere
als augsburgisch sind? Auch die Ornamentik ist für einen
Augsburger Meister zu rückständig gotisch, und endlich
finden wir im Regensburger Bürgerbuch der Zeit eine ganze
Menge von Glasernamen, die beweisen, daß um 1510/20
die Kunst der Glasmalerei hier noch lange nicht ausge-
storben war. Schinnerer.
Filippo di Pietro, Disegni sconosciuti e disegni finora non
identificati di Federigo Barocci negä Uffizi. Firenze, Isti-
tuto micrografico italiano, 1913.
Die Studien über Barocci folgen einander in schnellem,
sich beinahe überstürzenden Tempo. Noch kürzlich durfte
ich an anderer Stelle zwei dieser Publikationen würdigen,
die besonders der Jugendentwicklung des Meisters nach-
gingen, und seit kurzem liegt eine Veröffentlichung vor,
die durch die Minuziosität der Analyse und den äußerst
reichen Illustrationsschmuck alle ihre Vorgänger überbietet.
F. di Pietro hat sich die Aufgabe gestellt, zu dem Bande
Schmarsows über die Uffizienzeichnungen — der bahn-
Inhalt:
brechenden Arbeit auf diesem Gebiete — einen Nachtrag
zu verfassen. Da er als Beamter jener Sammlung die Ob-
jekte Tag für Tag unter Augen hat, so war er hierzu wie
wenige prädestiniert. Über einen bloßen Nachtrag nun
sind seine Studien weit hinausgereift zu einer höchst wert-
vollen Untersuchung des künstlerischen Schaffensprozesses
Baroccis. Eine oberflächliche Betrachtungsweise hatte sich
den Urbinaten als einen Maler des farbigen Effekts, einen
manieristischen Fortsetzer des correggesken Stiles vorgestellt;
von der unendlich geduldigen Naturbeobachtung des Künst-
lers, von seiner Hingabe an die reale Erscheinung wußten
wenige. Nichts Überraschenderes nun für alle, die nicht die
Masse seiner Zeichnungen in den Uffizien eingehend studiert
und mit den angeführten Gemälden verglichen haben, als
die Zusammenstellungen bei di Pietro. Die Zahl der Studien,
die zu jedem einzelnen Bilde existieren, ist Legion: Kom-
positionsentwürfe, Gruppenkonfigurationen, Einzelfiguren,
Köpfe, Arme, Hände, Beine, Füße, endlich alles Akzessorische
wie Kleidung, Tiere, Landschaftliches usw. sind in uner-
müdlicher und bei aller Genauigkeit stets großzügig bleiben-
der Arbeit immer wieder variiert, von anderen Seiten ange-
faßt und nach hundertfältiger Vervollkommnung schließlich
einer Lösung zugeführt, die wie höchste, völlig mühelose
Leichtigkeit erscheint.
Der Text di Pietros folgt, natürlich ohne bei der Materie
auf literarische Abrundung Anspruch zu erheben, diesem
Schaffensprozeß seines Helden mit Feinfühligkeit und nicht
gewöhnlichem Spürsinn. Die Resultate des Verf. hier auf-
zuzählen, würde wegen der Minuziosität der einzelnen Un-
tersuchungen, die eben eigentlich als Nachtrag gedacht
sind, zu weit führen. Besondere Erwähnung verdient je-
doch die glückliche Hand di Pietros im Auffinden der
Fäden, die von Barocci rücklaufend zu Correggio und vor-
wärts gerichtet in die Zukunft führen, zu den Florentinern
und Senesen des ausgehenden 16. Jahrhunderts, im be-
sondern zu Lodovico Cigoli. Wie sich aus Correggios
Madonna della Scodella die Ruhe auf der Flucht (vatika-
nische Pinakothek) und aus Baroccis Berufung des Andreas
(Brüssel), die Berufung des Petrus von Cigoli (Pal. Pitti)
entwickelt, ist mit Hilfe der Zeichnungen, die die Ver-
bindung herstellen, einwandfrei dargetan.
Es muß hervorgehoben werden, daß die 195 Auto-
typien und besonders die fünf Lichtdrucke dem Istituto
micrografico alle Ehre machen. Dabei sei aber anderer-
seits nicht verschwiegen, daß es richtiger gewesen wäre,
Text und Abbildungen gesondert zu bringen. Bei 195 Text-
bildern auf 171 Seiten wird das Satzbild allzu zerrissen, um
noch eine zusammenhängende Lektüre des Textes zu ge-
statten. Hermann Voss.
Bayrische Gewerbeschau 1912 in München. Amtliche
Denkschrift, herausgegeben vom Direktorium. München,
Delphin-Verlag, 1913.
Die amtlichen Berichte, die für die Ausstellungsge-
schichte als zuverlässige Dokumente willkommen sind,
würden an und für sich kaum das Gefühl erwecken, als ob
die Gewerbeschau mehr als vorübergehende Bedeutung
gehabt habe. Wohl aber zeigen die Warenbilder und die
Abbildungen aus der historischen Abteilung, wie hoch-
stehend das Niveau der Ausstellung war und daß es sich
wohl lohnt, hin und wieder auf diese Ausstellung zurück-
zugreifen. Dieses Zurückgreifen ist durch diese Publikation
ermöglicht; durch sie erhält die Ausstellung ein dauerndes
wohlverdientes Denkmal.
Darmstadt. - Ein neues Museum muhammedanischer Kunst in Konstantinopel. — Vom Freiberger Dom. — Ausstellungen in Berlin, München,
Magdeburg, London. — Victoria and Albert-Museum in London; National Oallery in London. — Berliner Opernhausneubau. ■—Fougerat,
Hans Holbein; Schmitz, Katalog der Olasgemälde im Berliner Kunstgewerbemuseum; Filippo di Pietro, Disegni sconosciuti e disegni
finora non identificati di Federigo Barocci negli Uffizi; Bayrische Oewerbeschau 1912 in München.
Verantwortliche Redaktion: Gustav Kirstein. Verlag von E.A.Seemann in Leipzig, Hospitalstraße IIa
Druck von Ernst Hedrich Nachf., o. m. b. h., Leipzig