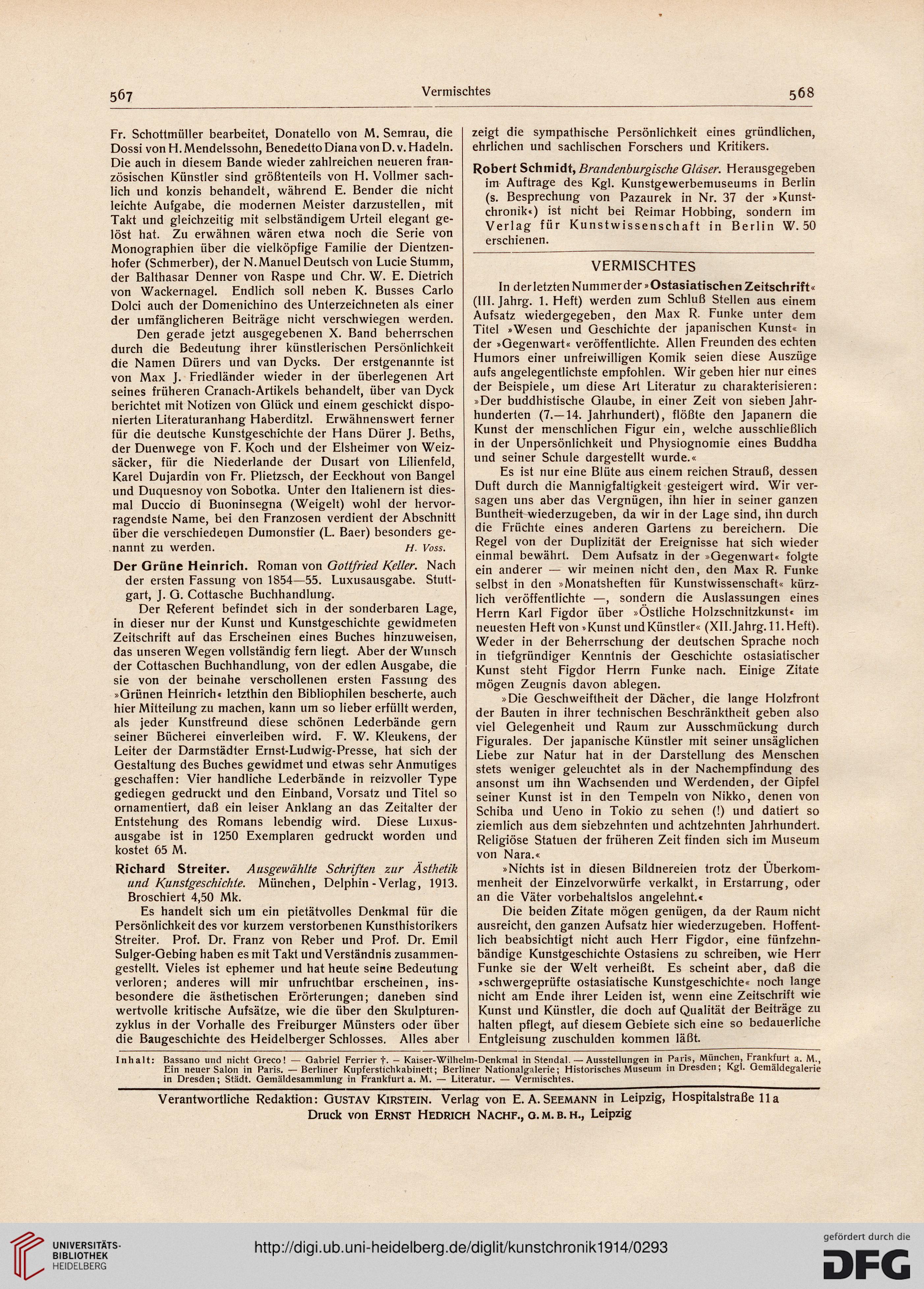567
Vermischtes
568
Fr. Schottmüller bearbeitet, Donatello von M. Semrau, die
Dossi von H. Mendelssohn, Benedetto Diana von D. v. Hadeln.
Die auch in diesem Bande wieder zahlreichen neueren fran-
zösischen Künstler sind größtenteils von H. Vollmer sach-
lich und konzis behandelt, während E. Bender die nicht
leichte Aufgabe, die modernen Meister darzustellen, mit
Takt und gleichzeitig mit selbständigem Urteil elegant ge-
löst hat. Zu erwähnen wären etwa noch die Serie von
Monographien über die vielköpfige Familie der Dientzen-
hofer (Schmerber), der N.Manuel Deutsch von Lucie Stumm,
der Balthasar Denner von Raspe und Chr. W. E. Dietrich
von Wackernagel. Endlich soll neben K. Busses Carlo
Dolci auch der Domenichino des Unterzeichneten als einer
der umfänglicheren Beiträge nicht verschwiegen werden.
Den gerade jetzt ausgegebenen X. Band beherrschen
durch die Bedeutung ihrer künstlerischen Persönlichkeil
die Namen Dürers und van Dycks. Der erstgenannte ist
von Max J. Friedländer wieder in der überlegenen Art
seines früheren Cranach-Artikels behandelt, über van Dyck
berichtet mit Notizen von Glück und einem geschickt dispo-
nierten Literaturanhang Haberditzl. Erwähnenswert ferner
für die deutsche Kunstgeschichte der Hans Dürer J. Beths,
der Duenwege von F. Koch und der Elsheimer von Weiz-
säcker, für die Niederlande der Dusart von Lilienfeld,
Karel Dujardin von Fr. Plietzsch, der Eeckhout von Bangel
und Duquesnoy von Sobotka. Unter den Italienern ist dies-
mal Duccio di Buoninsegna (Weigelt) wohl der hervor-
ragendste Name, bei den Franzosen verdient der Abschnitt
über die verschiederjen Dumonstier (L. Baer) besonders ge-
nannt zu werden. h. Voss.
Der Grüne Heinrich. Roman von Gottfried Keller. Nach
der ersten Fassung von 1854—55. Luxusausgabe. Stutt-
gart, J. G. Cottasche Buchhandlung.
Der Referent befindet sich in der sonderbaren Lage,
in dieser nur der Kunst und Kunstgeschichte gewidmeten
Zeitschrift auf das Erscheinen eines Buches hinzuweisen,
das unseren Wegen vollständig fern liegt. Aber der Wunsch
der Cottaschen Buchhandlung, von der edlen Ausgabe, die
sie von der beinahe verschollenen ersten Fassung des
»Grünen Heinrich« letzthin den Bibliophilen bescherte, auch
hier Mitteilung zu machen, kann um so lieber erfüllt werden,
als jeder Kunstfreund diese schönen Lederbände gern
seiner Bücherei einverleiben wird. F. W. Kleukens, der
Leiter der Darmstädter Ernst-Ludwig-Presse, hat sich der
Gestaltung des Buches gewidmet und etwas sehr Anmutiges
geschaffen: Vier handliche Lederbände in reizvoller Type
gediegen gedruckt und den Einband, Vorsatz und Titel so
ornamentiert, daß ein leiser Anklang an das Zeitalter der
Entstehung des Romans lebendig wird. Diese Luxus-
ausgabe ist in 1250 Exemplaren gedruckt worden und
kostet 65 M.
Richard Streiter. Ausgewählte Schriften zur Ästhetik
und Kunstgeschichte. München, Delphin-Verlag, 1913.
Broschiert 4,50 Mk.
Es handelt sich um ein pietätvolles Denkmal für die
Persönlichkeit des vor kurzem verstorbenen Kunsthistorikers
Streiter. Prof. Dr. Franz von Reber und Prof. Dr. Emil
Sulger-Gebing haben es mit Takt und Verständnis zusammen-
gestellt. Vieles ist ephemer und hat heute seine Bedeutung
verloren; anderes will mir unfruchtbar erscheinen, ins-
besondere die ästhetischen Erörterungen; daneben sind
wertvolle kritische Aufsätze, wie die über den Skulpturen-
zyklus in der Vorhalle des Freiburger Münsters oder über
die Baugeschichte des Heidelberger Schlosses. Alles aber
zeigt die sympathische Persönlichkeit eines gründlichen,
ehrlichen und sachlischen Forschers und Kritikers.
Robert Schmidt, Brandenburgische Gläser. Herausgegeben
im Auftrage des Kgl. Kunstgewerbemuseums in Berlin
(s. Besprechung von Pazaurek in Nr. 37 der »Kunst-
chronik«) ist nicht bei Reimar Hobbing, sondern im
Verlag für Kunstwissenschaft in Berlin W. 50
erschienen.
VERMISCHTES
In derletztenNummerder »OstasiatischenZeitschrift«
(III. Jahrg. 1. Heft) werden zum Schluß Stellen aus einem
Aufsatz wiedergegeben, den Max R. Funke unter dem
Titel »Wesen und Geschichte der japanischen Kunst« in
der »Gegenwart« veröffentlichte. Allen Freunden des echten
Humors einer unfreiwilligen Komik seien diese Auszüge
aufs angelegentlichste empfohlen. Wir geben hier nur eines
der Beispiele, um diese Art Literatur zu charakterisieren:
»Der buddhistische Glaube, in einer Zeit von sieben Jahr-
hunderten (7.—14. Jahrhundert), flößte den Japanern die
Kunst der menschlichen Figur ein, welche ausschließlich
in der Unpersönlichkeit und Physiognomie eines Buddha
und seiner Schule dargestellt wurde.«
Es ist nur eine Blüte aus einem reichen Strauß, dessen
Duft durch die Mannigfaltigkeit gesteigert wird. Wir ver-
sagen uns aber das Vergnügen, ihn hier in seiner ganzen
Buntheit wiederzugeben, da wir in der Lage sind, ihn durch
die Früchte eines anderen Gartens zu bereichern. Die
Regel von der Duplizität der Ereignisse hat sich wieder
einmal bewährt. Dem Aufsatz in der »Gegenwart« folgte
ein anderer — wir meinen nicht den, den Max R. Funke
selbst in den »Monatsheften für Kunstwissenschaft« kürz-
lich veröffentlichte —, sondern die Auslassungen eines
Herrn Karl Figdor über »Östliche Holzschnitzkunst« im
neuesten Heft von»Kunst undKünstler« (XII.Jahrg.ll.Heft).
Weder in der Beherrschung der deutschen Sprache noch
in tiefgründiger Kenntnis der Geschichte ostasiatischer
Kunst steht Figdor Herrn Funke nach. Einige Zitate
mögen Zeugnis davon ablegen.
»Die Geschweiftheit der Dächer, die lange Holzfront
der Bauten in ihrer technischen Beschränktheit geben also
viel Gelegenheit und Raum zur Ausschmückung durch
Figurales. Der japanische Künstler mit seiner unsäglichen
Liebe zur Natur hat in der Darstellung des Menschen
stets weniger geleuchtet als in der Nachempfindung des
ansonst um ihn Wachsenden und Werdenden, der Gipfel
seiner Kunst ist in den Tempeln von Nikko, denen von
Schiba und Ueno in Tokio zu sehen (!) und datiert so
ziemlich aus dem siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert.
Religiöse Statuen der früheren Zeit finden sich im Museum
von Nara.«
»Nichts ist in diesen Bildnereien trotz der Überkom-
menheit der Einzel vorwürfe verkalkt, in Erstarrung, oder
an die Väter vorbehaltslos angelehnt.«
Die beiden Zitate mögen genügen, da der Raum nicht
ausreicht, den ganzen Aufsatz hier wiederzugeben. Hoffent-
lich beabsichtigt nicht auch Herr Figdor, eine fünfzehn-
bändige Kunstgeschichte Ostasiens zu schreiben, wie Herr
Funke sie der Welt verheißt. Es scheint aber, daß die
»schwergeprüfte ostasiatische Kunstgeschichte« noch lange
nicht am Ende ihrer Leiden ist, wenn eine Zeitschrift wie
Kunst und Künstler, die doch auf Qualität der Beiträge zu
halten pflegt, auf diesem Gebiete sich eine so bedauerliche
Entgleisung zuschulden kommen läßt.
Inhalt: Bassano und nicht Oreco! — Gabriel Ferner f. - Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Stendal. — Ausstellungen in Paris, München, Frankfurt a. M.,
Ein neuer Salon in Paris. — Berliner Kupferstichkabinett; Berliner Nationalgalerie; Historisches Museum in Dresden; Kgl. Gemäldegalerie
in Dresden; Stadt. Gemäldesammlung in Frankfurt a. M. — Literatur. — Vermischtes.
Verantwortliche Redaktion: Gustav Kirstein. Verlag von E.A.Seemann in Leipzig, Hospitalstraße IIa
Druck von Ernst Hedrich Nachf., o. m. b. h., Leipzig
Vermischtes
568
Fr. Schottmüller bearbeitet, Donatello von M. Semrau, die
Dossi von H. Mendelssohn, Benedetto Diana von D. v. Hadeln.
Die auch in diesem Bande wieder zahlreichen neueren fran-
zösischen Künstler sind größtenteils von H. Vollmer sach-
lich und konzis behandelt, während E. Bender die nicht
leichte Aufgabe, die modernen Meister darzustellen, mit
Takt und gleichzeitig mit selbständigem Urteil elegant ge-
löst hat. Zu erwähnen wären etwa noch die Serie von
Monographien über die vielköpfige Familie der Dientzen-
hofer (Schmerber), der N.Manuel Deutsch von Lucie Stumm,
der Balthasar Denner von Raspe und Chr. W. E. Dietrich
von Wackernagel. Endlich soll neben K. Busses Carlo
Dolci auch der Domenichino des Unterzeichneten als einer
der umfänglicheren Beiträge nicht verschwiegen werden.
Den gerade jetzt ausgegebenen X. Band beherrschen
durch die Bedeutung ihrer künstlerischen Persönlichkeil
die Namen Dürers und van Dycks. Der erstgenannte ist
von Max J. Friedländer wieder in der überlegenen Art
seines früheren Cranach-Artikels behandelt, über van Dyck
berichtet mit Notizen von Glück und einem geschickt dispo-
nierten Literaturanhang Haberditzl. Erwähnenswert ferner
für die deutsche Kunstgeschichte der Hans Dürer J. Beths,
der Duenwege von F. Koch und der Elsheimer von Weiz-
säcker, für die Niederlande der Dusart von Lilienfeld,
Karel Dujardin von Fr. Plietzsch, der Eeckhout von Bangel
und Duquesnoy von Sobotka. Unter den Italienern ist dies-
mal Duccio di Buoninsegna (Weigelt) wohl der hervor-
ragendste Name, bei den Franzosen verdient der Abschnitt
über die verschiederjen Dumonstier (L. Baer) besonders ge-
nannt zu werden. h. Voss.
Der Grüne Heinrich. Roman von Gottfried Keller. Nach
der ersten Fassung von 1854—55. Luxusausgabe. Stutt-
gart, J. G. Cottasche Buchhandlung.
Der Referent befindet sich in der sonderbaren Lage,
in dieser nur der Kunst und Kunstgeschichte gewidmeten
Zeitschrift auf das Erscheinen eines Buches hinzuweisen,
das unseren Wegen vollständig fern liegt. Aber der Wunsch
der Cottaschen Buchhandlung, von der edlen Ausgabe, die
sie von der beinahe verschollenen ersten Fassung des
»Grünen Heinrich« letzthin den Bibliophilen bescherte, auch
hier Mitteilung zu machen, kann um so lieber erfüllt werden,
als jeder Kunstfreund diese schönen Lederbände gern
seiner Bücherei einverleiben wird. F. W. Kleukens, der
Leiter der Darmstädter Ernst-Ludwig-Presse, hat sich der
Gestaltung des Buches gewidmet und etwas sehr Anmutiges
geschaffen: Vier handliche Lederbände in reizvoller Type
gediegen gedruckt und den Einband, Vorsatz und Titel so
ornamentiert, daß ein leiser Anklang an das Zeitalter der
Entstehung des Romans lebendig wird. Diese Luxus-
ausgabe ist in 1250 Exemplaren gedruckt worden und
kostet 65 M.
Richard Streiter. Ausgewählte Schriften zur Ästhetik
und Kunstgeschichte. München, Delphin-Verlag, 1913.
Broschiert 4,50 Mk.
Es handelt sich um ein pietätvolles Denkmal für die
Persönlichkeit des vor kurzem verstorbenen Kunsthistorikers
Streiter. Prof. Dr. Franz von Reber und Prof. Dr. Emil
Sulger-Gebing haben es mit Takt und Verständnis zusammen-
gestellt. Vieles ist ephemer und hat heute seine Bedeutung
verloren; anderes will mir unfruchtbar erscheinen, ins-
besondere die ästhetischen Erörterungen; daneben sind
wertvolle kritische Aufsätze, wie die über den Skulpturen-
zyklus in der Vorhalle des Freiburger Münsters oder über
die Baugeschichte des Heidelberger Schlosses. Alles aber
zeigt die sympathische Persönlichkeit eines gründlichen,
ehrlichen und sachlischen Forschers und Kritikers.
Robert Schmidt, Brandenburgische Gläser. Herausgegeben
im Auftrage des Kgl. Kunstgewerbemuseums in Berlin
(s. Besprechung von Pazaurek in Nr. 37 der »Kunst-
chronik«) ist nicht bei Reimar Hobbing, sondern im
Verlag für Kunstwissenschaft in Berlin W. 50
erschienen.
VERMISCHTES
In derletztenNummerder »OstasiatischenZeitschrift«
(III. Jahrg. 1. Heft) werden zum Schluß Stellen aus einem
Aufsatz wiedergegeben, den Max R. Funke unter dem
Titel »Wesen und Geschichte der japanischen Kunst« in
der »Gegenwart« veröffentlichte. Allen Freunden des echten
Humors einer unfreiwilligen Komik seien diese Auszüge
aufs angelegentlichste empfohlen. Wir geben hier nur eines
der Beispiele, um diese Art Literatur zu charakterisieren:
»Der buddhistische Glaube, in einer Zeit von sieben Jahr-
hunderten (7.—14. Jahrhundert), flößte den Japanern die
Kunst der menschlichen Figur ein, welche ausschließlich
in der Unpersönlichkeit und Physiognomie eines Buddha
und seiner Schule dargestellt wurde.«
Es ist nur eine Blüte aus einem reichen Strauß, dessen
Duft durch die Mannigfaltigkeit gesteigert wird. Wir ver-
sagen uns aber das Vergnügen, ihn hier in seiner ganzen
Buntheit wiederzugeben, da wir in der Lage sind, ihn durch
die Früchte eines anderen Gartens zu bereichern. Die
Regel von der Duplizität der Ereignisse hat sich wieder
einmal bewährt. Dem Aufsatz in der »Gegenwart« folgte
ein anderer — wir meinen nicht den, den Max R. Funke
selbst in den »Monatsheften für Kunstwissenschaft« kürz-
lich veröffentlichte —, sondern die Auslassungen eines
Herrn Karl Figdor über »Östliche Holzschnitzkunst« im
neuesten Heft von»Kunst undKünstler« (XII.Jahrg.ll.Heft).
Weder in der Beherrschung der deutschen Sprache noch
in tiefgründiger Kenntnis der Geschichte ostasiatischer
Kunst steht Figdor Herrn Funke nach. Einige Zitate
mögen Zeugnis davon ablegen.
»Die Geschweiftheit der Dächer, die lange Holzfront
der Bauten in ihrer technischen Beschränktheit geben also
viel Gelegenheit und Raum zur Ausschmückung durch
Figurales. Der japanische Künstler mit seiner unsäglichen
Liebe zur Natur hat in der Darstellung des Menschen
stets weniger geleuchtet als in der Nachempfindung des
ansonst um ihn Wachsenden und Werdenden, der Gipfel
seiner Kunst ist in den Tempeln von Nikko, denen von
Schiba und Ueno in Tokio zu sehen (!) und datiert so
ziemlich aus dem siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert.
Religiöse Statuen der früheren Zeit finden sich im Museum
von Nara.«
»Nichts ist in diesen Bildnereien trotz der Überkom-
menheit der Einzel vorwürfe verkalkt, in Erstarrung, oder
an die Väter vorbehaltslos angelehnt.«
Die beiden Zitate mögen genügen, da der Raum nicht
ausreicht, den ganzen Aufsatz hier wiederzugeben. Hoffent-
lich beabsichtigt nicht auch Herr Figdor, eine fünfzehn-
bändige Kunstgeschichte Ostasiens zu schreiben, wie Herr
Funke sie der Welt verheißt. Es scheint aber, daß die
»schwergeprüfte ostasiatische Kunstgeschichte« noch lange
nicht am Ende ihrer Leiden ist, wenn eine Zeitschrift wie
Kunst und Künstler, die doch auf Qualität der Beiträge zu
halten pflegt, auf diesem Gebiete sich eine so bedauerliche
Entgleisung zuschulden kommen läßt.
Inhalt: Bassano und nicht Oreco! — Gabriel Ferner f. - Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Stendal. — Ausstellungen in Paris, München, Frankfurt a. M.,
Ein neuer Salon in Paris. — Berliner Kupferstichkabinett; Berliner Nationalgalerie; Historisches Museum in Dresden; Kgl. Gemäldegalerie
in Dresden; Stadt. Gemäldesammlung in Frankfurt a. M. — Literatur. — Vermischtes.
Verantwortliche Redaktion: Gustav Kirstein. Verlag von E.A.Seemann in Leipzig, Hospitalstraße IIa
Druck von Ernst Hedrich Nachf., o. m. b. h., Leipzig