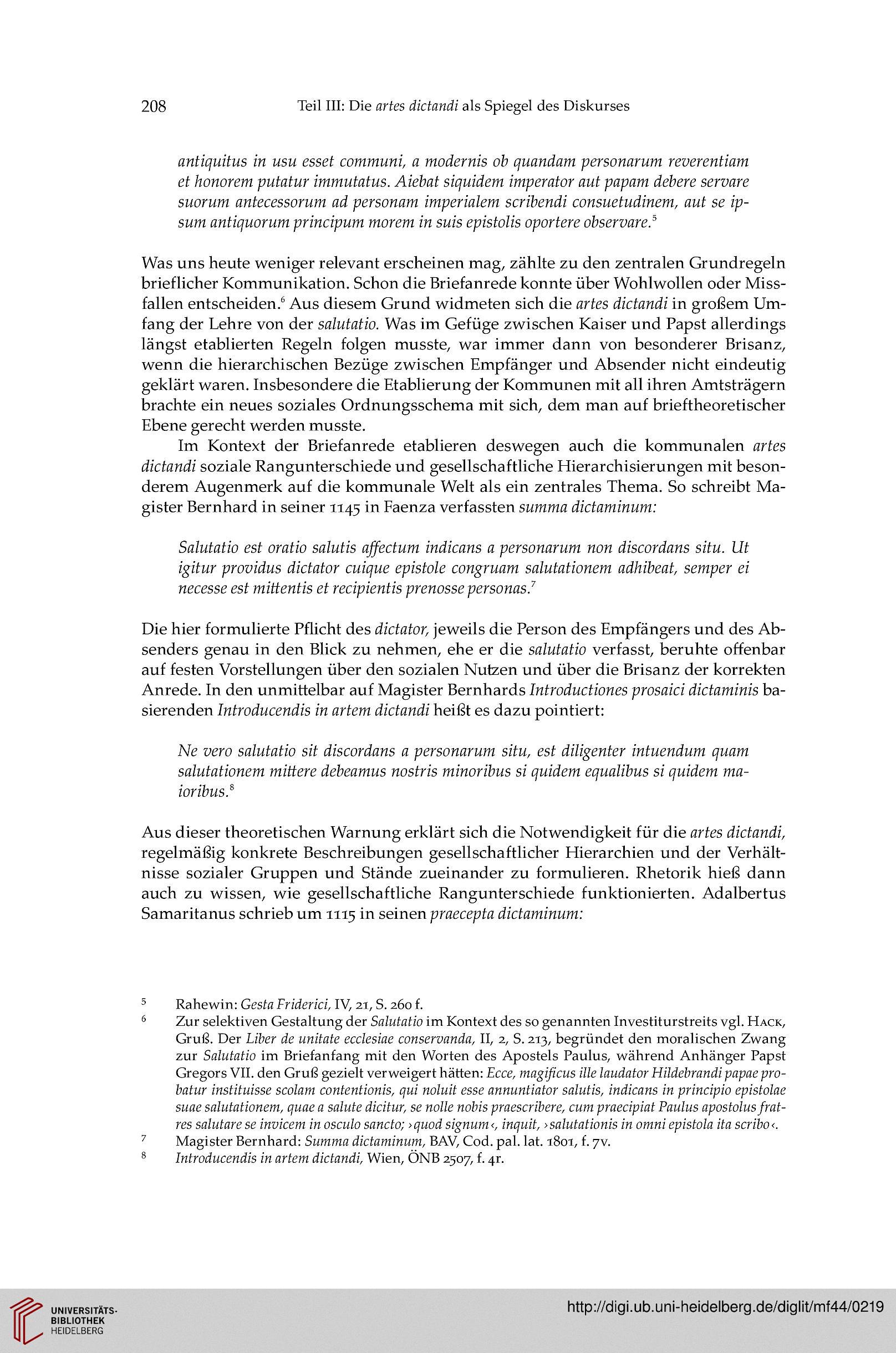208
Teil III: Die arfcs dzcfaad; als Spiegel des Diskurses
azihptzzlMS zzi ztszz essef coztzzüMziz, a ztzoderzizs ob pzzazidazü porsoziarMZü rooorotifzam
N boziorozü pMfafzzr zztzzüMfafMS. Azobaf szpMzdozü zztzporafor azzf papazzr doboro soroaro
SMorzzzü anlecessomw ad porsonam zztzporzaUzü scrzbozidz cozisMNMdzziozü, azzf so zp-
SMW azihptzorMZü prmczpMZü morom zzi szzzs opzsfoüs oporforo obsoroaro/
Was uns heute weniger relevant erscheinen mag, zählte zu den zentralen Grundregeln
brieflicher Kommunikation. Schon die Briefanrede konnte über Wohlwollen oder Miss-
fallen entscheiden/ Aus diesem Grund widmeten sich die arfos dzcfandz in großem Um-
fang der Lehre von der salzdafzo. Was im Gefüge zwischen Kaiser und Papst allerdings
längst etablierten Regeln folgen musste, war immer dann von besonderer Brisanz,
wenn die hierarchischen Bezüge zwischen Empfänger und Absender nicht eindeutig
geklärt waren. Insbesondere die Etablierung der Kommunen mit all ihren Amtsträgern
brachte ein neues soziales Ordnungsschema mit sich, dem man auf brieftheoretischer
Ebene gerecht werden musste.
Im Kontext der Briefanrede etablieren deswegen auch die kommunalen arfos
dzcfandz soziale Rangunterschiede und gesellschaftliche Hierarchisierungen mit beson-
derem Augenmerk auf die kommunale Welt als ein zentrales Thema. So schreibt Ma-
gister Bernhard in seiner 1145 in Faenza verfassten szzzwzwa dzcfazwzziMZW.'
Salzzfafzo osf orafzo sabdzs a^bcfzzzü zndzcatis a porsozzarzzzü non dzscordans szhz. LÜ
zgzftzr proozdzzs dzcfafor ctüptzo opzsfoU con^rnanz salnfahonenz adbzboaf, sompor oz
necesse osf znzitenfzs N roczpzonfzs prenossepersonas/
Die hier formulierte Pflicht des dzcfafop. jeweils die Person des Empfängers und des Ab-
senders genau in den Blick zu nehmen, ehe er die salnfafzo verfasst, beruhte offenbar
auf festen Vorstellungen über den sozialen Nutzen und über die Brisanz der korrekten
Anrede. In den unmittelbar auf Magister Bernhards fnfrodncfzones prosazcz dzcfaznznzs ba-
sierenden fzzhodzzcezzdzs z'zz azdczzz dzcfandz heißt es dazu pointiert:
Ne ooro salzzfafzo szf dzscordazis a persozzarzzzzz szfzz, esf dzb^ozifor zzzfMezzdzzzzz pzzazzz
salzzfafzozzezzz mzdoro doboazzzzzs zzoshzs zzzzzzorzizzzs sz pzzzdezzz epzzalzizMS sz pzzzdezzz zzza-
zorzbzzs/
Aus dieser theoretischen Warnung erklärt sich die Notwendigkeit für die arfos dzcfandz,
regelmäßig konkrete Beschreibungen gesellschaftlicher Hierarchien und der Verhält-
nisse sozialer Gruppen und Stände zueinander zu formulieren. Rhetorik hieß dann
auch zu wissen, wie gesellschaftliche Rangunterschiede funktionierten. Adalbertus
Samaritanus schrieb um 1115 in seinen praocopfa dzcfazzzzzzzzzw;
Rahewin: Gcsia Frzdcncz, IV, 21, S. 260 f.
Zur selektiven Gestaltung der Saiafah'o im Kontext des so genannten Investiturstreits vgl. HACK,
Gruß. Der Ez'bcr & aazYafc ccdcsz'ac coascruaada, II, 2, S. 213, begründet den moralischen Zwang
zur Saiafah'o im Briefanfang mit den Worten des Apostels Paulus, während Anhänger Papst
Gregors VII. den Gruß gezielt verweigert hätten: Eccc, azagzpcas z'be iaadafor fh'Mcbraad; papac pro-
bafar z'asfdaz'ssc scoiaa: coafcafz'oaz's, t?az aoiad esse aaaaah'afor saiahs, z'adz'caas z'a pn'acz'pz'o cpz'sfoiac
saac saiafafz'oacaz, z^aac a saiafc dz'cdar, sc aobe aobz's pracscrz'bcrc, caa: praecz'pz'af Paaias aposfoias/raf-
rcs saiafarc sc z'aUcca: z'a oscaio saacfo; >t?aod szgaaa:<, z'a^ad, >saiafah'oaz's z'a oazaz cpz'sfoia da scrz'bo<.
Magister Bernhard: Saazaza dz'cfaazz'aaaz, BAV, Cod. pal. lat. 1801, f. yv.
fafrodaccadz's z'a arfcaz dz'cfaadz, Wien, ÖNB 2307, f. 4r.
Teil III: Die arfcs dzcfaad; als Spiegel des Diskurses
azihptzzlMS zzi ztszz essef coztzzüMziz, a ztzoderzizs ob pzzazidazü porsoziarMZü rooorotifzam
N boziorozü pMfafzzr zztzzüMfafMS. Azobaf szpMzdozü zztzporafor azzf papazzr doboro soroaro
SMorzzzü anlecessomw ad porsonam zztzporzaUzü scrzbozidz cozisMNMdzziozü, azzf so zp-
SMW azihptzorMZü prmczpMZü morom zzi szzzs opzsfoüs oporforo obsoroaro/
Was uns heute weniger relevant erscheinen mag, zählte zu den zentralen Grundregeln
brieflicher Kommunikation. Schon die Briefanrede konnte über Wohlwollen oder Miss-
fallen entscheiden/ Aus diesem Grund widmeten sich die arfos dzcfandz in großem Um-
fang der Lehre von der salzdafzo. Was im Gefüge zwischen Kaiser und Papst allerdings
längst etablierten Regeln folgen musste, war immer dann von besonderer Brisanz,
wenn die hierarchischen Bezüge zwischen Empfänger und Absender nicht eindeutig
geklärt waren. Insbesondere die Etablierung der Kommunen mit all ihren Amtsträgern
brachte ein neues soziales Ordnungsschema mit sich, dem man auf brieftheoretischer
Ebene gerecht werden musste.
Im Kontext der Briefanrede etablieren deswegen auch die kommunalen arfos
dzcfandz soziale Rangunterschiede und gesellschaftliche Hierarchisierungen mit beson-
derem Augenmerk auf die kommunale Welt als ein zentrales Thema. So schreibt Ma-
gister Bernhard in seiner 1145 in Faenza verfassten szzzwzwa dzcfazwzziMZW.'
Salzzfafzo osf orafzo sabdzs a^bcfzzzü zndzcatis a porsozzarzzzü non dzscordans szhz. LÜ
zgzftzr proozdzzs dzcfafor ctüptzo opzsfoU con^rnanz salnfahonenz adbzboaf, sompor oz
necesse osf znzitenfzs N roczpzonfzs prenossepersonas/
Die hier formulierte Pflicht des dzcfafop. jeweils die Person des Empfängers und des Ab-
senders genau in den Blick zu nehmen, ehe er die salnfafzo verfasst, beruhte offenbar
auf festen Vorstellungen über den sozialen Nutzen und über die Brisanz der korrekten
Anrede. In den unmittelbar auf Magister Bernhards fnfrodncfzones prosazcz dzcfaznznzs ba-
sierenden fzzhodzzcezzdzs z'zz azdczzz dzcfandz heißt es dazu pointiert:
Ne ooro salzzfafzo szf dzscordazis a persozzarzzzzz szfzz, esf dzb^ozifor zzzfMezzdzzzzz pzzazzz
salzzfafzozzezzz mzdoro doboazzzzzs zzoshzs zzzzzzorzizzzs sz pzzzdezzz epzzalzizMS sz pzzzdezzz zzza-
zorzbzzs/
Aus dieser theoretischen Warnung erklärt sich die Notwendigkeit für die arfos dzcfandz,
regelmäßig konkrete Beschreibungen gesellschaftlicher Hierarchien und der Verhält-
nisse sozialer Gruppen und Stände zueinander zu formulieren. Rhetorik hieß dann
auch zu wissen, wie gesellschaftliche Rangunterschiede funktionierten. Adalbertus
Samaritanus schrieb um 1115 in seinen praocopfa dzcfazzzzzzzzzw;
Rahewin: Gcsia Frzdcncz, IV, 21, S. 260 f.
Zur selektiven Gestaltung der Saiafah'o im Kontext des so genannten Investiturstreits vgl. HACK,
Gruß. Der Ez'bcr & aazYafc ccdcsz'ac coascruaada, II, 2, S. 213, begründet den moralischen Zwang
zur Saiafah'o im Briefanfang mit den Worten des Apostels Paulus, während Anhänger Papst
Gregors VII. den Gruß gezielt verweigert hätten: Eccc, azagzpcas z'be iaadafor fh'Mcbraad; papac pro-
bafar z'asfdaz'ssc scoiaa: coafcafz'oaz's, t?az aoiad esse aaaaah'afor saiahs, z'adz'caas z'a pn'acz'pz'o cpz'sfoiac
saac saiafafz'oacaz, z^aac a saiafc dz'cdar, sc aobe aobz's pracscrz'bcrc, caa: praecz'pz'af Paaias aposfoias/raf-
rcs saiafarc sc z'aUcca: z'a oscaio saacfo; >t?aod szgaaa:<, z'a^ad, >saiafah'oaz's z'a oazaz cpz'sfoia da scrz'bo<.
Magister Bernhard: Saazaza dz'cfaazz'aaaz, BAV, Cod. pal. lat. 1801, f. yv.
fafrodaccadz's z'a arfcaz dz'cfaadz, Wien, ÖNB 2307, f. 4r.