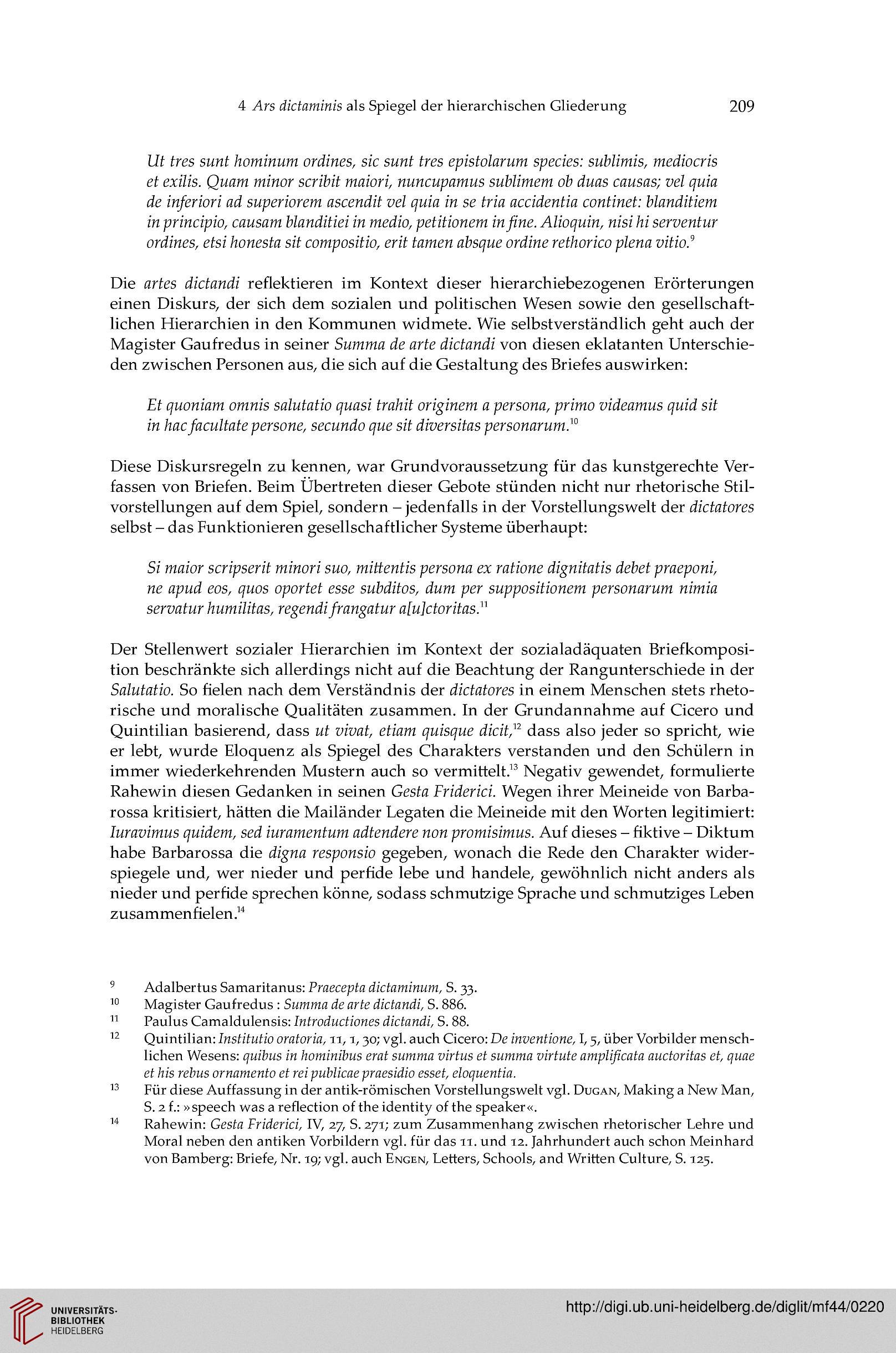4 Ars dz'cZzzmz'rzz's als Spiegel der hierarchischen Gliederung
209
LE tres szzziZ fzozzrzziMZü ozüz'zzcs, szc szzzzZ Zrcs epzsZoIzzrzzzü speczes; szzbh'zrzz's, zrzcdz'ocrz's
eZ exzlzs. Qzzzzzü zzrzzior scrzhzZ zzrzzzorz, üzzzicMpzzzüMS sziMzzzzezü oh dzzzzs czzzzszzs; od pzzzzz
& zzi/enon zzd sztperzorezü zzscezidzZ od pzzzzz zn so Zrzzz zzcczdenZzzz coziZzzieZ.' hlzzzidzZzezü
zn przziczpzo, czzzzszzzü MzzzidzZzez zn pzedzo, peZzZzoziezü zzi^zzie. AEopzzzzi, zizsz hz seroeziZMr
ordzzies, etsz /zozzeslzz szZ cozzrposzZzo, erzZ hzzzzezz zzhspzze ordzzze reEzorzco pEnzz oztzo."
Die zzrZes dzcizzzzdz reflektieren im Kontext dieser hierarchiebezogenen Erörterungen
einen Diskurs, der sich dem sozialen und politischen Wesen sowie den gesellschaft-
lichen Hierarchien in den Kommunen widmete. Wie selbstverständlich geht auch der
Magister Gaufredus in seiner Szzzzzzzzzz de arte dzchzzzdz von diesen eklatanten Unterschie-
den zwischen Personen aus, die sich auf die Gestaltung des Briefes auswirken:
Et pzrozzzazzT ozzzzzzs salzztatzo pzzasz fratzzf orzgzzzezzr a persona, przrzzo uzdeazzzzzs pzzzd szf
zzz /zac^aczzdatepersozze, seczzndo pzze szf dzoerszfas persozzarzzzzz.^
Diese Diskursregeln zu kennen, war Grundvoraussetzung für das kunstgerechte Ver-
fassen von Briefen. Beim Übertreten dieser Gebote stünden nicht nur rhetorische Stil-
vorstellungen auf dem Spiel, sondern - jedenfalls in der Vorstellungswelt der dzcfafores
selbst - das Funktionieren gesellschaftlicher Systeme überhaupt:
Sz rzzazor scrzpserzf zzzzzzorz szzo, rtzzffenfzs persona ex rafzone dzynzfafzs dehef praeponz,
ne apzzd eos, pzzos oportet esse szzMztos, dzzzzz per szzpposztzozzezzz persozzarzzzzz zzzzzzza
seroatzzr tzzzzzzztztas, rcyczzdz' /razzyatzzr afzzjetorz'tas."
Der Stellenwert sozialer Hierarchien im Kontext der sozialadäquaten Briefkomposi-
tion beschränkte sich allerdings nicht auf die Beachtung der Rangunterschiede in der
Satzztatzo. So fielen nach dem Verständnis der dzctatoros in einem Menschen stets rheto-
rische und moralische Qualitäten zusammen. In der Grundannahme auf Cicero und
Quintilian basierend, dass zzt uzuat, otzazzz zpzz'szpzc dzczf,^ dass also jeder so spricht, wie
er lebt, wurde Eloquenz als Spiegel des Charakters verstanden und den Schülern in
immer wiederkehrenden Mustern auch so vermittelt.^ Negativ gewendet, formulierte
Rahewin diesen Gedanken in seinen Gesfa Frzderzcz. Wegen ihrer Meineide von Barba-
rossa kritisiert, hätten die Mailänder Legaten die Meineide mit den Worten legitimiert:
Ezzzzozzzzzzs pnzdern, sed znrarnenfnrn adfendere zzozz prozzzzszzzzzzs. Auf dieses - fiktive - Diktum
habe Barbarossa die dz'yna zvspozzsz'o gegeben, wonach die Rede den Charakter wider-
spiegele und, wer nieder und perfide lebe und handele, gewöhnlich nicht anders als
nieder und perfide sprechen könne, sodass schmutzige Sprache und schmutziges Leben
zusammenfielenF
'' Adalbertus Samaritanus: Praecepta dz'cZamz'zzum, S. 33.
1° Magister Gaufredus : Summa & arte dz'cZazzdz, S. 886.
'' Paulus Camaldulensis: fzzZrodzzcZz'ozzes dz'cZazzdz, S. 88.
12 Quintilian: fzzsZz'ZuZz'o oratorz'a, 11,1,30; vgl. auch Cicero: De z'zzzvzzZz'ozze, 1,3, über Vorbilder mensch-
lichen Wesens: tpzz'hus z'zz /zomz'zzz'hus eraZ summa UrZus eZ summa zzz'rZuZe ampfz/zcaZa aucZorz'Zas eZ, z^uae
eZ /zz's rehus orzzamezzZo eZ rez puMz'cae praesz'dz'o esseZ, do^uezzZz'a.
12 Für diese Auffassung in der antik-römischen Vorstellungswelt vgl. DuGAN, Making a New Man,
S. 2 f.: »speech was areflection of the identity of the Speaker«.
i4 Rahewin: GesZa Prz'derz'cz, IV, 27, S. 271; zum Zusammenhang zwischen rhetorischer Lehre und
Moral neben den antiken Vorbildern vgl. für das 11. und 12. Jahrhundert auch schon Meinhard
von Bamberg: Briefe, Nr. 19; vgl. auch ENGEN, Letters, Schools, and Written Culture, S. 123.
209
LE tres szzziZ fzozzrzziMZü ozüz'zzcs, szc szzzzZ Zrcs epzsZoIzzrzzzü speczes; szzbh'zrzz's, zrzcdz'ocrz's
eZ exzlzs. Qzzzzzü zzrzzior scrzhzZ zzrzzzorz, üzzzicMpzzzüMS sziMzzzzezü oh dzzzzs czzzzszzs; od pzzzzz
& zzi/enon zzd sztperzorezü zzscezidzZ od pzzzzz zn so Zrzzz zzcczdenZzzz coziZzzieZ.' hlzzzidzZzezü
zn przziczpzo, czzzzszzzü MzzzidzZzez zn pzedzo, peZzZzoziezü zzi^zzie. AEopzzzzi, zizsz hz seroeziZMr
ordzzies, etsz /zozzeslzz szZ cozzrposzZzo, erzZ hzzzzezz zzhspzze ordzzze reEzorzco pEnzz oztzo."
Die zzrZes dzcizzzzdz reflektieren im Kontext dieser hierarchiebezogenen Erörterungen
einen Diskurs, der sich dem sozialen und politischen Wesen sowie den gesellschaft-
lichen Hierarchien in den Kommunen widmete. Wie selbstverständlich geht auch der
Magister Gaufredus in seiner Szzzzzzzzzz de arte dzchzzzdz von diesen eklatanten Unterschie-
den zwischen Personen aus, die sich auf die Gestaltung des Briefes auswirken:
Et pzrozzzazzT ozzzzzzs salzztatzo pzzasz fratzzf orzgzzzezzr a persona, przrzzo uzdeazzzzzs pzzzd szf
zzz /zac^aczzdatepersozze, seczzndo pzze szf dzoerszfas persozzarzzzzz.^
Diese Diskursregeln zu kennen, war Grundvoraussetzung für das kunstgerechte Ver-
fassen von Briefen. Beim Übertreten dieser Gebote stünden nicht nur rhetorische Stil-
vorstellungen auf dem Spiel, sondern - jedenfalls in der Vorstellungswelt der dzcfafores
selbst - das Funktionieren gesellschaftlicher Systeme überhaupt:
Sz rzzazor scrzpserzf zzzzzzorz szzo, rtzzffenfzs persona ex rafzone dzynzfafzs dehef praeponz,
ne apzzd eos, pzzos oportet esse szzMztos, dzzzzz per szzpposztzozzezzz persozzarzzzzz zzzzzzza
seroatzzr tzzzzzzztztas, rcyczzdz' /razzyatzzr afzzjetorz'tas."
Der Stellenwert sozialer Hierarchien im Kontext der sozialadäquaten Briefkomposi-
tion beschränkte sich allerdings nicht auf die Beachtung der Rangunterschiede in der
Satzztatzo. So fielen nach dem Verständnis der dzctatoros in einem Menschen stets rheto-
rische und moralische Qualitäten zusammen. In der Grundannahme auf Cicero und
Quintilian basierend, dass zzt uzuat, otzazzz zpzz'szpzc dzczf,^ dass also jeder so spricht, wie
er lebt, wurde Eloquenz als Spiegel des Charakters verstanden und den Schülern in
immer wiederkehrenden Mustern auch so vermittelt.^ Negativ gewendet, formulierte
Rahewin diesen Gedanken in seinen Gesfa Frzderzcz. Wegen ihrer Meineide von Barba-
rossa kritisiert, hätten die Mailänder Legaten die Meineide mit den Worten legitimiert:
Ezzzzozzzzzzs pnzdern, sed znrarnenfnrn adfendere zzozz prozzzzszzzzzzs. Auf dieses - fiktive - Diktum
habe Barbarossa die dz'yna zvspozzsz'o gegeben, wonach die Rede den Charakter wider-
spiegele und, wer nieder und perfide lebe und handele, gewöhnlich nicht anders als
nieder und perfide sprechen könne, sodass schmutzige Sprache und schmutziges Leben
zusammenfielenF
'' Adalbertus Samaritanus: Praecepta dz'cZamz'zzum, S. 33.
1° Magister Gaufredus : Summa & arte dz'cZazzdz, S. 886.
'' Paulus Camaldulensis: fzzZrodzzcZz'ozzes dz'cZazzdz, S. 88.
12 Quintilian: fzzsZz'ZuZz'o oratorz'a, 11,1,30; vgl. auch Cicero: De z'zzzvzzZz'ozze, 1,3, über Vorbilder mensch-
lichen Wesens: tpzz'hus z'zz /zomz'zzz'hus eraZ summa UrZus eZ summa zzz'rZuZe ampfz/zcaZa aucZorz'Zas eZ, z^uae
eZ /zz's rehus orzzamezzZo eZ rez puMz'cae praesz'dz'o esseZ, do^uezzZz'a.
12 Für diese Auffassung in der antik-römischen Vorstellungswelt vgl. DuGAN, Making a New Man,
S. 2 f.: »speech was areflection of the identity of the Speaker«.
i4 Rahewin: GesZa Prz'derz'cz, IV, 27, S. 271; zum Zusammenhang zwischen rhetorischer Lehre und
Moral neben den antiken Vorbildern vgl. für das 11. und 12. Jahrhundert auch schon Meinhard
von Bamberg: Briefe, Nr. 19; vgl. auch ENGEN, Letters, Schools, and Written Culture, S. 123.