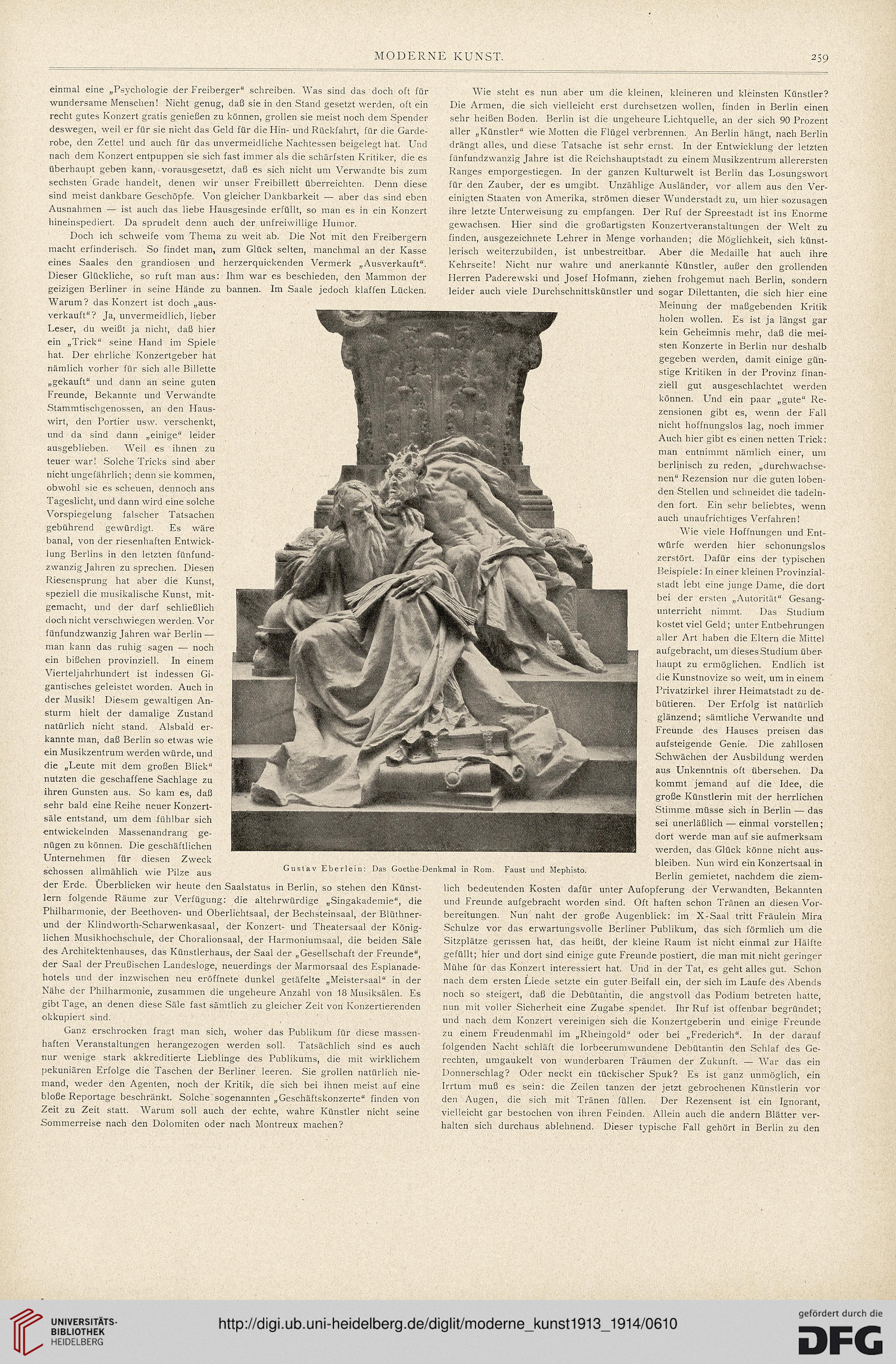MODERNE KUNST.
259
einmal eine „Psychologie der Freiberger“ schreiben. Was sind das doch oft für
wundersame Menschen! Nicht genug, daß sie in den Stand gesetzt werden, oft ein
recht gutes Konzert gratis genießen zu können, grollen sie meist noch dem Spender
deswegen, weil er für sie nicht das Geld für die Hin- und Rückfahrt, für die Garde-
robe, den Zette! und auch für das unvermeidliche Nachtessen beigelegt hat. Und
nach dem Konzert entpuppen sie sich fast immer als die schärfsten Kritiker, die es
überhaupt geben kann, • vorausgesetzt, daß es sich nicht um Verwandte bis zum
sechsten Grade handelt, denen wir unser Freibillett überreichten. Denn diese
sind meist dankbare Geschöpfe. Von gleicher Dankbarkeit — aber das sind eben
Ausnahmen — ist auch das liebe Hausgesinde erfüllt, so man es in ein Konzert
hineinspediert. Da sprudelt denn auch der unfreiwillige Ilumor.
Doch ich schweife vom Thema zu weit ab. Die Not mit den Freibergern
macht erfinderisch. So findet man, zum Glück selten, manchmal an der Kasse
eines Saales den grandiosen und herzerquickenden Vermerk „Ausverkauft“.
Dieser Glückliche, so ruft man aus: Ihm war es beschieden, den Mammon der
geizigen Berliner in seine Ilände zu bannen. Im Saale jedoch klaffen Lücken.
Warum? das Konzert ist doch „aus-
verkauft“? Ja, unvermeidlich, lieber
Leser, du weißt ja nicht, daß hier
ein „Trick“ seine Hand im Spiele
hat. Der ehrliche Konzertgeber hat
nämlich vorher für sich alle Billette
„gekauft“ und dann an seine guten
Freunde, Bekannte und Verwandte
Stammtischgenossen, an den Haus-
wirt, den Portier usw. verschenkt,
und da sind dann „einige“ leider
ausgeblieben. Weil es ihnen zu
teuer warl Solche Tricks sind aber
nicht ungefährlich; denn sie kommen,
obwohl sie es scheuen, dennoch ans
Tageslicht, und dann wird eine solche
Vorspiegelung falscher Tatsachen
gebührend gewürdigt. Es wäre
banal, von der riesenhaften Entwick-
lung Berlins in den letzten fünfund-
zwanzig Jahren zu sprechen. Diesen
Riesensprung hat aber die Kunst,
speziell die musikalische Kunst, mit-
gemacht, und der darf schließlich
doch nicht verschwiegen werden. Vor
fünfundzwanzig Jahren war Berlin —
man kann das ruhig sagen — noch
ein bißchen provinziell. In einem
Vierteljahrhundert ist indessen Gi-
gantisches geleistet worden. Auch in
der Musik! Diesem gewaltigen An-
sturm hielt der damalige Zustand
natürlich nicht stand. Alsbald er-
kannte man, daß Berlin so etwas wie
ein Musikzentrum werden würde, und
die „Leute mit dem großen Blick“
nutzten die geschaffene Sachlage zu
ihren Gunsten aus. So kam es, daß
sehr bald eine Reihe neuer Konzert-
säle entstand, um dem fühlbar sich
entwickelnden Massenandrang ge-
nügen zu können. Die geschäftlichen
Unternehmen für diesen Zweck
1 ,, ..ir 1 • T,., Gustav Eberlein: Das Goethe-Denk
schossen allmählich wie Pilze aus
der Erde. Überblicken wir heute den Saalstatus in Berlin, so stehen den Künst-
lern folgende Räume zur Verfügung: die altehrwürdige „Singakademie“, die
Philharmonie, der Beethoven- und Oberlichtsaal, der Bechsteinsaal, der Blüthner-
und der Ivlindworth-Scharwenkasaal, der Konzert- und Theatersaal der König-
lichen Musikhochschule, der Choralionsaal, der Ilarmoniumsaal, die beiden Säle
des Architektenhauses, das Künstlerhaus, der Saal der „Gesellschaft der Freunde“,
der Saal der Preußischen Landesloge, neuerdings der Marinorsaal des Esplanade-
hotels und der inzwischen neu eröffnete dunkel getäfelte „Meistersaal“ in der
Nähe der Philharmonie, zusammen die ungeheure Anzahl von 18 Musiksälen. Es
gibt Tage, an denen diese Säle fast sämtlich zu gleicher Zeit von Konzertierenden
okkupiert sind.
Ganz erschrocken fragt man sich, woher das Publikum für diese massen-
haften Veranstaltungen herangezogen werden soll. Tatsächlich sind es auch
nur wenige stark akkreditierte Lieblinge des Publikums, die mit wirklichem
pekuniären Erfolge die Taschen der Berliner leeren. Sie grollen natürlich nie-
mand, weder den Agenten, noch der Kritik, die sich bei ihnen meist auf eine
bloße Reportage beschränkt. Solche sogenannten „Geschäftskonzerte“ finden von
Zeit zu Zeit statt. Warum soll auch der echte, wahre Künstler nicht seine
Sommerreise nach den Dolomiten oder nach Montreux machen?
Wie steht es nun aber um die kleinen, kleineren und kleinsten Künstler?
Die Armen, die sich vielleicht erst durchsetzen wollen, finden in Berlin einen
sehr heißen Boden. Berlin ist die ungeheure Lichtquelle, an der sich 90 Prozent
aller „Künstler“ wie Motten die Flügel verbrennen. An Berlin hängt, nach Berlin
drängt alles, und diese Tatsache ist sehr ernst. In der Entwicklung der letzten
fünfundzwanzig Jahre ist die Reichshauptstadt zu einem Musikzentrum allerersten
Ranges emporgestiegen. In der ganzen Kulturwelt ist Berlin das Losungswort
für den Zauber, der es umgibt. Unzählige Ausländer, vor allem aus den Ver-
einigten Staaten von Amerika, strömen dieser Wunderstadt zu, um hier sozusagen
ihre letzte Unterweisung zu empfangen. Der Ruf der Spreestadt ist ins Enorme
gewachsen. Hier sind die großartigsten Konzertveranstaltungen der Welt zu
finden, ausgezeichnete Lehrer in Menge vorhanden; die Möglichkeit, sich künst-
lerisch weiterzubilden, ist unbestreitbar. Aber die Medaille hat auch ihre
Kehrseite! Nicht nur wahre und anerkannte Künstler, außer den grollenden
Herren Paderewski und Josef Hofmann, ziehen frohgemut nach Berlin, sondern
leider auch viele Durchschnittskünstler und sogar Dilettanten, die sich hier eine
Meinung der maßgebenden Kritik
holen wollen. Es ist ja längst gar
kein Geheimnis mehr, daß die mei-
sten Konzerte in Berlin nur deshalb
gegeben werden, damit einige gün-
stige Kritiken in der Provinz finan-
ziell gut ausgeschlachtet werden
können. Und ein paar „gute“ Re-
zensionen gibt es, wenn der Fall
nicht hoffnungslos lag, noch immer
Auch hier gibt es einen netten Trick:
man entnimmt nämlich einer, um
berlinisch zu reden, „durchwachse-
nen“ Rezension nur die guten loben-
den Stellen und schneidet die tadeln-
den fort. Ein sehr beliebtes, wenn
auch unaufrichtiges Verfahren!
Wie viele Hoffnungen und Ent-
würfe werden hier schonungslos
zerstört. Dafür eins der typischen
Beispiele: In einer kleinen Provinzial-
stadt lebt eine junge Dame, die dort
bei der ersten „Autorität“ Gesang-
unterricht nimmt. Das Studium
kostet viel Geld; unter Entbehrungen
aller Art haben die Eltern die Mittel
aufgebracht, um dieses Studium über-
haupt zu ermöglichen. Endlich ist
die Kunstnovize so weit, um in einem
Privatzirkel ihrer Heimatstadt zu de-
bütieren. Der Erfolg ist natürlich
glänzend; sämtliche Verwandte und
Freunde des Hauses preisen das
aufsteigende Genie. Die zahllosen
Schwächen der Ausbildung werden
aus Unkenntnis oft übersehen. Da
kommt jemand auf die Idee, die
große Künstlerin mit der herrlichen
Stimme müsse sich in Berlin — das
sei unerläßlich — einmal vorstellen;
dort werde man auf sie aufmerksam
werden, das Glück könne nicht aus-
bleiben. Nun wird ein Konzertsaal in
mal in Rom. Faust und Mephisto. „ . , . ...
Berlin gemietet, nachdem die ziem-
lich bedeutenden Kosten dafür unter Aufopferung der Verwandten, Bekannten
und Freunde aufgebracht worden sind. Oft haften schon Tränen an diesen Vor-
bereitungen. Nun naht der große Augenblick: im X-Saal tritt Fräulein Mira
Schulze vor das erwartungsvolle Berliner Publikum, das sich förmlich um die
Sitzplätze gerissen hat, das heißt, der kleine Raum ist nicht einmal zur Hälfte
gefüllt; hier und dort sind einige gute Freunde postiert, die man mit nicht geringer
Mühe für das Konzert interessiert hat. Und in der Tat, es geht alles gut. Schon
nach dem ersten Liede setzte ein guter Beifall ein, der sich im Laufe des Abends
noch so steigert, daß die Debütantin, die angstvoll das Podium betreten hatte,
nun mit voller Sicherheit eine Zugabe spendet. Ihr Ruf ist offenbar begründet;
und nach dem Konzert vereinigen sich die Konzertgeberin und einige Freunde
zu einem Freudenmahl im „Rheingold“ oder bei „Frederich“. In der darauf
folgenden Nacht schläft die lorbeerumwundene Debütantin den Schlaf des Ge-
rechten, umgaukelt von wunderbaren Träumen der Zukunft. — War das ein
Donnerschlag? Oder neckt ein tückischer Spuk? Es ist ganz unmöglich, ein
Irrtum muß es sein: die Zeilen tanzen der jetzt gebrochenen Künstlerin vor
den Augen, die sich mit Tränen füllen. Der Rezensent ist ein Ignorant,
vielleicht gar bestochen von ihren Feinden. Allein auch die andern Blätter ver-
halten sich durchaus ablehnend. Dieser typische Fall gehört in Berlin zu den
259
einmal eine „Psychologie der Freiberger“ schreiben. Was sind das doch oft für
wundersame Menschen! Nicht genug, daß sie in den Stand gesetzt werden, oft ein
recht gutes Konzert gratis genießen zu können, grollen sie meist noch dem Spender
deswegen, weil er für sie nicht das Geld für die Hin- und Rückfahrt, für die Garde-
robe, den Zette! und auch für das unvermeidliche Nachtessen beigelegt hat. Und
nach dem Konzert entpuppen sie sich fast immer als die schärfsten Kritiker, die es
überhaupt geben kann, • vorausgesetzt, daß es sich nicht um Verwandte bis zum
sechsten Grade handelt, denen wir unser Freibillett überreichten. Denn diese
sind meist dankbare Geschöpfe. Von gleicher Dankbarkeit — aber das sind eben
Ausnahmen — ist auch das liebe Hausgesinde erfüllt, so man es in ein Konzert
hineinspediert. Da sprudelt denn auch der unfreiwillige Ilumor.
Doch ich schweife vom Thema zu weit ab. Die Not mit den Freibergern
macht erfinderisch. So findet man, zum Glück selten, manchmal an der Kasse
eines Saales den grandiosen und herzerquickenden Vermerk „Ausverkauft“.
Dieser Glückliche, so ruft man aus: Ihm war es beschieden, den Mammon der
geizigen Berliner in seine Ilände zu bannen. Im Saale jedoch klaffen Lücken.
Warum? das Konzert ist doch „aus-
verkauft“? Ja, unvermeidlich, lieber
Leser, du weißt ja nicht, daß hier
ein „Trick“ seine Hand im Spiele
hat. Der ehrliche Konzertgeber hat
nämlich vorher für sich alle Billette
„gekauft“ und dann an seine guten
Freunde, Bekannte und Verwandte
Stammtischgenossen, an den Haus-
wirt, den Portier usw. verschenkt,
und da sind dann „einige“ leider
ausgeblieben. Weil es ihnen zu
teuer warl Solche Tricks sind aber
nicht ungefährlich; denn sie kommen,
obwohl sie es scheuen, dennoch ans
Tageslicht, und dann wird eine solche
Vorspiegelung falscher Tatsachen
gebührend gewürdigt. Es wäre
banal, von der riesenhaften Entwick-
lung Berlins in den letzten fünfund-
zwanzig Jahren zu sprechen. Diesen
Riesensprung hat aber die Kunst,
speziell die musikalische Kunst, mit-
gemacht, und der darf schließlich
doch nicht verschwiegen werden. Vor
fünfundzwanzig Jahren war Berlin —
man kann das ruhig sagen — noch
ein bißchen provinziell. In einem
Vierteljahrhundert ist indessen Gi-
gantisches geleistet worden. Auch in
der Musik! Diesem gewaltigen An-
sturm hielt der damalige Zustand
natürlich nicht stand. Alsbald er-
kannte man, daß Berlin so etwas wie
ein Musikzentrum werden würde, und
die „Leute mit dem großen Blick“
nutzten die geschaffene Sachlage zu
ihren Gunsten aus. So kam es, daß
sehr bald eine Reihe neuer Konzert-
säle entstand, um dem fühlbar sich
entwickelnden Massenandrang ge-
nügen zu können. Die geschäftlichen
Unternehmen für diesen Zweck
1 ,, ..ir 1 • T,., Gustav Eberlein: Das Goethe-Denk
schossen allmählich wie Pilze aus
der Erde. Überblicken wir heute den Saalstatus in Berlin, so stehen den Künst-
lern folgende Räume zur Verfügung: die altehrwürdige „Singakademie“, die
Philharmonie, der Beethoven- und Oberlichtsaal, der Bechsteinsaal, der Blüthner-
und der Ivlindworth-Scharwenkasaal, der Konzert- und Theatersaal der König-
lichen Musikhochschule, der Choralionsaal, der Ilarmoniumsaal, die beiden Säle
des Architektenhauses, das Künstlerhaus, der Saal der „Gesellschaft der Freunde“,
der Saal der Preußischen Landesloge, neuerdings der Marinorsaal des Esplanade-
hotels und der inzwischen neu eröffnete dunkel getäfelte „Meistersaal“ in der
Nähe der Philharmonie, zusammen die ungeheure Anzahl von 18 Musiksälen. Es
gibt Tage, an denen diese Säle fast sämtlich zu gleicher Zeit von Konzertierenden
okkupiert sind.
Ganz erschrocken fragt man sich, woher das Publikum für diese massen-
haften Veranstaltungen herangezogen werden soll. Tatsächlich sind es auch
nur wenige stark akkreditierte Lieblinge des Publikums, die mit wirklichem
pekuniären Erfolge die Taschen der Berliner leeren. Sie grollen natürlich nie-
mand, weder den Agenten, noch der Kritik, die sich bei ihnen meist auf eine
bloße Reportage beschränkt. Solche sogenannten „Geschäftskonzerte“ finden von
Zeit zu Zeit statt. Warum soll auch der echte, wahre Künstler nicht seine
Sommerreise nach den Dolomiten oder nach Montreux machen?
Wie steht es nun aber um die kleinen, kleineren und kleinsten Künstler?
Die Armen, die sich vielleicht erst durchsetzen wollen, finden in Berlin einen
sehr heißen Boden. Berlin ist die ungeheure Lichtquelle, an der sich 90 Prozent
aller „Künstler“ wie Motten die Flügel verbrennen. An Berlin hängt, nach Berlin
drängt alles, und diese Tatsache ist sehr ernst. In der Entwicklung der letzten
fünfundzwanzig Jahre ist die Reichshauptstadt zu einem Musikzentrum allerersten
Ranges emporgestiegen. In der ganzen Kulturwelt ist Berlin das Losungswort
für den Zauber, der es umgibt. Unzählige Ausländer, vor allem aus den Ver-
einigten Staaten von Amerika, strömen dieser Wunderstadt zu, um hier sozusagen
ihre letzte Unterweisung zu empfangen. Der Ruf der Spreestadt ist ins Enorme
gewachsen. Hier sind die großartigsten Konzertveranstaltungen der Welt zu
finden, ausgezeichnete Lehrer in Menge vorhanden; die Möglichkeit, sich künst-
lerisch weiterzubilden, ist unbestreitbar. Aber die Medaille hat auch ihre
Kehrseite! Nicht nur wahre und anerkannte Künstler, außer den grollenden
Herren Paderewski und Josef Hofmann, ziehen frohgemut nach Berlin, sondern
leider auch viele Durchschnittskünstler und sogar Dilettanten, die sich hier eine
Meinung der maßgebenden Kritik
holen wollen. Es ist ja längst gar
kein Geheimnis mehr, daß die mei-
sten Konzerte in Berlin nur deshalb
gegeben werden, damit einige gün-
stige Kritiken in der Provinz finan-
ziell gut ausgeschlachtet werden
können. Und ein paar „gute“ Re-
zensionen gibt es, wenn der Fall
nicht hoffnungslos lag, noch immer
Auch hier gibt es einen netten Trick:
man entnimmt nämlich einer, um
berlinisch zu reden, „durchwachse-
nen“ Rezension nur die guten loben-
den Stellen und schneidet die tadeln-
den fort. Ein sehr beliebtes, wenn
auch unaufrichtiges Verfahren!
Wie viele Hoffnungen und Ent-
würfe werden hier schonungslos
zerstört. Dafür eins der typischen
Beispiele: In einer kleinen Provinzial-
stadt lebt eine junge Dame, die dort
bei der ersten „Autorität“ Gesang-
unterricht nimmt. Das Studium
kostet viel Geld; unter Entbehrungen
aller Art haben die Eltern die Mittel
aufgebracht, um dieses Studium über-
haupt zu ermöglichen. Endlich ist
die Kunstnovize so weit, um in einem
Privatzirkel ihrer Heimatstadt zu de-
bütieren. Der Erfolg ist natürlich
glänzend; sämtliche Verwandte und
Freunde des Hauses preisen das
aufsteigende Genie. Die zahllosen
Schwächen der Ausbildung werden
aus Unkenntnis oft übersehen. Da
kommt jemand auf die Idee, die
große Künstlerin mit der herrlichen
Stimme müsse sich in Berlin — das
sei unerläßlich — einmal vorstellen;
dort werde man auf sie aufmerksam
werden, das Glück könne nicht aus-
bleiben. Nun wird ein Konzertsaal in
mal in Rom. Faust und Mephisto. „ . , . ...
Berlin gemietet, nachdem die ziem-
lich bedeutenden Kosten dafür unter Aufopferung der Verwandten, Bekannten
und Freunde aufgebracht worden sind. Oft haften schon Tränen an diesen Vor-
bereitungen. Nun naht der große Augenblick: im X-Saal tritt Fräulein Mira
Schulze vor das erwartungsvolle Berliner Publikum, das sich förmlich um die
Sitzplätze gerissen hat, das heißt, der kleine Raum ist nicht einmal zur Hälfte
gefüllt; hier und dort sind einige gute Freunde postiert, die man mit nicht geringer
Mühe für das Konzert interessiert hat. Und in der Tat, es geht alles gut. Schon
nach dem ersten Liede setzte ein guter Beifall ein, der sich im Laufe des Abends
noch so steigert, daß die Debütantin, die angstvoll das Podium betreten hatte,
nun mit voller Sicherheit eine Zugabe spendet. Ihr Ruf ist offenbar begründet;
und nach dem Konzert vereinigen sich die Konzertgeberin und einige Freunde
zu einem Freudenmahl im „Rheingold“ oder bei „Frederich“. In der darauf
folgenden Nacht schläft die lorbeerumwundene Debütantin den Schlaf des Ge-
rechten, umgaukelt von wunderbaren Träumen der Zukunft. — War das ein
Donnerschlag? Oder neckt ein tückischer Spuk? Es ist ganz unmöglich, ein
Irrtum muß es sein: die Zeilen tanzen der jetzt gebrochenen Künstlerin vor
den Augen, die sich mit Tränen füllen. Der Rezensent ist ein Ignorant,
vielleicht gar bestochen von ihren Feinden. Allein auch die andern Blätter ver-
halten sich durchaus ablehnend. Dieser typische Fall gehört in Berlin zu den