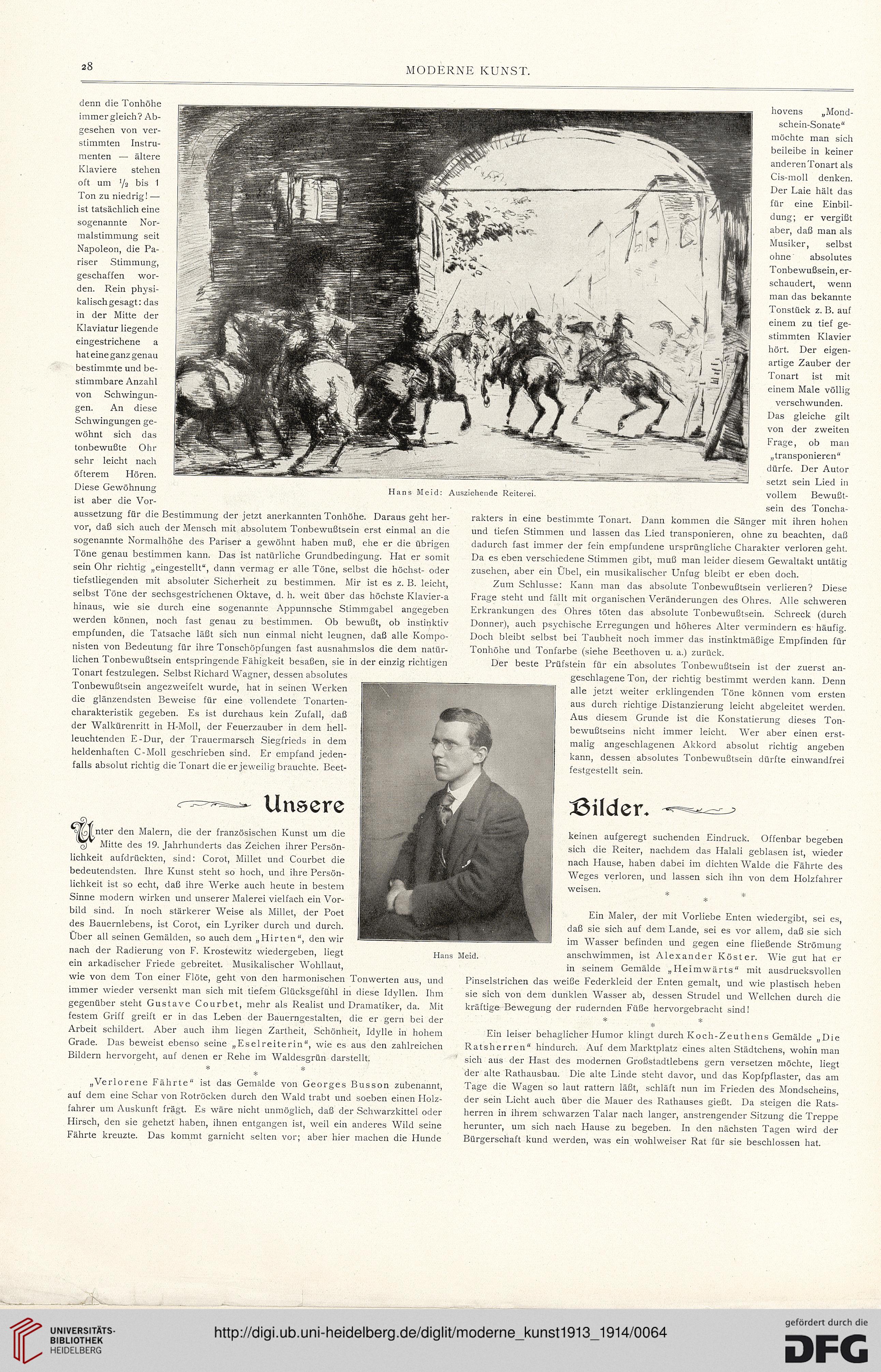28
MODERNE KUNST.
denn die Tonhöhe
immer gleich? Ab-
gesehen von ver-
stimmten Instru-
menten — ältere
Klaviere stehen
oft um Ya bis 1
Ton zu niedrig! —
ist tatsächlich eine
sogenannte Nor-
malstimmung seit
Napoleon, die Pa-
riser Stimmung,
geschaffen wor-
den. Rein physi-
kalischgesagt: das
in der Mitte der
Klaviatur liegende
eingestrichene a
hat eine ganz genau
bestimmte und be-
stimmbare Anzahl
von Schwingun-
gen. An diese
Schwingungen ge-
wöhnt sich das
tonbewußte Ohr
sehr leicht nach
öfterem Hören.
Diese Gewöhnung Hans Meid:
ist aber die Vor-
aussetzung für die Bestimmung der jetzt anerkannten Tonhöhe. Daraus geht her-
vor, daß sich auch der Mensch mit absolutem Tonbewußtsein erst einmal an die
sogenannte Normalhöhe des Pariser a gewöhnt haben muß, ehe er die übrigen
Töne genau bestimmen kann. Das ist natürliche Grundbedingung. Plat er somit
sein Ohr richtig „eingestellt“, dann vermag er alle Töne, selbst die höchst- oder
tiefstliegenden mit absoluter Sicherheit zu bestimmen. Mir ist es z. B. leicht,
selbst Töne der sechsgestrichenen Oktave, d. h. weit über das höchste Klavier-a
hinaus, wie sie durch eine sogenannte Appunnsche Stimmgabel angegeben
werden können, noch fast genau zu bestimmen. Ob bewußt, ob instinktiv
empfunden, die Tatsache läßt sich nun einmal nicht leugnen, daß alle Kompo-
nisten von Bedeutung für ihre Tonschöpfungen fast ausnahmslos die dem natür-
lichen Tonbewußtsein entspringende Fähigkeit besaßen, sie in der einzig richtigen
Tonart festzulegen. Selbst Richard Wagner, dessen absolutes
Tonbewußtsein angezweifelt wurde, hat in seinen Werken
die glänzendsten Beweise für eine vollendete Tonarten-
charakteristik gegeben. Es ist durchaus kein Zufall, daß
der Walkürenritt in H-Moll, der Feuerzauber in dem hell-
leuchtenden E-Dur, der Trauermarsch Siegfrieds in dem
heldenhaften C-Moll geschrieben sind. Er empfand jeden-
falls absolut richtig die Tonart die er jeweilig brauchte. Beet-
hovens „Mond-
schein-Sonate“
möchte man sich
beileibe in keiner
anderen Tonart als
Cis-moll denken.
Der Laie hält das
für eine Einbil-
dung; er vergißt
aber, daß man als
Musiker, selbst
ohne absolutes
Tonbewußsein, er-
schaudert, wenn
man das bekannte
Tonstück z. B. auf
einem zu tief ge-
stimmten Klavier
hört. Der eigen-
artige Zauber der
Tonart ist mit
einem Male völlig
verschwunden.
Das gleiche gilt
von der zweiten
Frage, ob man
„transponieren“
dürfe. Der Autor
setzt sein Lied in
Reiterei. vollem Bewußt-
sein des Toncha-
rakters in eine bestimmte Tonart. Dann kommen die Sänger mit ihren hohen
und tiefen Stimmen und lassen das Lied transponieren, ohne zu beachten, daß
dadurch fast immer der fein empfundene ursprüngliche Charakter verloren geht.
Da es eben verschiedene Stimmen gibt, muß man leider diesem Gewaltakt untätig
Zusehen, aber ein Übel, ein musikalischer Unfug bleibt er eben doch.
Zum Schlüsse: Kann man das absolute Tonbewußtsein verlieren? Diese
Frage steht und fällt mit organischen Veränderungen des Ohres. Alle schweren
Erkrankungen des Ohres töten das absolute Tonbewußtsein. Schreck (durch
Donner), auch psychische Erregungen und höheres Alter vermindern es häufig.
Doch bleibt selbst bei Taubheit noch immer das instinktmäßige Empfinden für
Tonhöhe und Tonfarbe (siehe Beethoven u. a.) zurück.
Der beste Prüfstein für ein absolutes Tonbewußtsein ist der zuerst an-
geschlagene Ton, der richtig bestimmt werden kann. Denn
alle jetzt weiter erklingenden Töne können vom ersten
aus durch richtige Distanzierung leicht abgeleitet werden.
Aus diesem Grunde ist die Konstatierung dieses Ton-
bewußtseins nicht immer leicht. Wer aber einen erst-
malig angeschlagenen Akkord absolut richtig angeben
kann, dessen absolutes Tonbewußtsein dürfte einwandfrei
festgestellt sein.
Ausziehende
Unsere
©ilder.
yÄrJnter den Malern, die der französischen Kunst um die
o) Mitte des 19. Jahrhunderts das Zeichen ihrer Persön-
lichkeit aufdrückten, sind: Corot, Millet und Courbet die
bedeutendsten. Ihre Kunst steht so hoch, und ihre Persön-
lichkeit ist so echt, daß ihre Werke auch heute in bestem
Sinne modern wirken und unserer Malerei vielfach ein Vor-
bild sind. In noch stärkerer Weise als Millet, der Poet
des Bauernlebens, ist Corot, ein Lyriker durch und durch.
Über all seinen Gemälden, so auch dem „Hirten“, den wir
nach der Radierung von F. Krostewitz wiedergeben, liegt Hans
ein arkadischer Friede gebreitet. Musikalischer Wohllaut,
wie von dem Ton einer Flöte, geht von den harmonischen Tonwerten aus, und
immer wieder versenkt man sich mit tiefem Glücksgefühl in diese Idyllen. Ihm
gegenüber steht Gustave Courbet, mehr als Realist und Dramatiker, da. Mit
festem Griff greift er in das Leben der Bauerngestalten, die er gern bei der
Arbeit schildert. Aber auch ihm liegen Zartheit, Schönheit, Idylle in hohem
Grade. Das beweist ebenso seine „Eselreiterin“, wie es aus den zahlreichen
Bildern hervorgeht, auf denen er Rehe im Waldesgrün darstellt.
* *
*
„Verlorene Fährte“ ist das Gemälde von Georges Busson zubenannt,
auf dem eine Schar von Rotröcken durch den Wald trabt und soeben einen Holz-
fahrer um Auskunft frägt. Es wäre nicht unmöglich, daß der Schwarzkittel oder
Hirsch, den sie gehetzt haben, ihnen entgangen ist, weil ein anderes Wild seine
Fährte kreuzte. Das kommt garnicht selten vor; aber hier machen die Hunde
Ein Maler, der mit Vorliebe Enten wiedergibt, sei es,
daß sie sich auf dem Lande, sei es vor allem, daß sie sich
im Wasser befinden und gegen eine fließende Strömung
Meid. anschwimmen, ist Alexander Köster. Wie gut hat er
in seinem Gemälde „Heimwärts“ mit ausdrucksvollen
Pinselstrichen das weiße Federkleid der Enten gemalt, und wie plastisch heben
sie sich von dem dunklen Wasser ab, dessen Strudel und Weilchen durch die
kräftige Bewegung der rudernden Füße hervorgebracht sind!
* tfc
*
Ein leiser behaglicher Flumor klingt durch Koch-Zeuthens Gemälde „Die
Ratsherren“ hindurch. Auf dem Marktplatz eines alten Städtchens, wohin man
sich aus der Hast des modernen Großstadtlebens gern versetzen möchte, liegt
der alte Rathausbau. Die alte Linde steht davor, und das Kopfpflaster, das am
Tage die Wagen so laut rattern läßt, schläft nun im Frieden des Mondscheins,
der sein Licht auch über die Mauer des Rathauses gießt. Da steigen die Rats-
herren in ihrem schwarzen Talar nach langer, anstrengender Sitzung die Treppe
herunter, um sich nach Hause zu begeben. In den nächsten Tagen wird der
Bürgerschaft kund werden, was ein wohlweiser Rat für sie beschlossen hat.
keinen aufgeregt suchenden Eindruck. Offenbar begeben
sich die Reiter, nachdem das Halali geblasen ist, wieder
nach Hause, haben dabei im dichten Walde die Fährte des
Weges verloren, und lassen sich ihn von dem Holzfahrer
weisen. a.
*
MODERNE KUNST.
denn die Tonhöhe
immer gleich? Ab-
gesehen von ver-
stimmten Instru-
menten — ältere
Klaviere stehen
oft um Ya bis 1
Ton zu niedrig! —
ist tatsächlich eine
sogenannte Nor-
malstimmung seit
Napoleon, die Pa-
riser Stimmung,
geschaffen wor-
den. Rein physi-
kalischgesagt: das
in der Mitte der
Klaviatur liegende
eingestrichene a
hat eine ganz genau
bestimmte und be-
stimmbare Anzahl
von Schwingun-
gen. An diese
Schwingungen ge-
wöhnt sich das
tonbewußte Ohr
sehr leicht nach
öfterem Hören.
Diese Gewöhnung Hans Meid:
ist aber die Vor-
aussetzung für die Bestimmung der jetzt anerkannten Tonhöhe. Daraus geht her-
vor, daß sich auch der Mensch mit absolutem Tonbewußtsein erst einmal an die
sogenannte Normalhöhe des Pariser a gewöhnt haben muß, ehe er die übrigen
Töne genau bestimmen kann. Das ist natürliche Grundbedingung. Plat er somit
sein Ohr richtig „eingestellt“, dann vermag er alle Töne, selbst die höchst- oder
tiefstliegenden mit absoluter Sicherheit zu bestimmen. Mir ist es z. B. leicht,
selbst Töne der sechsgestrichenen Oktave, d. h. weit über das höchste Klavier-a
hinaus, wie sie durch eine sogenannte Appunnsche Stimmgabel angegeben
werden können, noch fast genau zu bestimmen. Ob bewußt, ob instinktiv
empfunden, die Tatsache läßt sich nun einmal nicht leugnen, daß alle Kompo-
nisten von Bedeutung für ihre Tonschöpfungen fast ausnahmslos die dem natür-
lichen Tonbewußtsein entspringende Fähigkeit besaßen, sie in der einzig richtigen
Tonart festzulegen. Selbst Richard Wagner, dessen absolutes
Tonbewußtsein angezweifelt wurde, hat in seinen Werken
die glänzendsten Beweise für eine vollendete Tonarten-
charakteristik gegeben. Es ist durchaus kein Zufall, daß
der Walkürenritt in H-Moll, der Feuerzauber in dem hell-
leuchtenden E-Dur, der Trauermarsch Siegfrieds in dem
heldenhaften C-Moll geschrieben sind. Er empfand jeden-
falls absolut richtig die Tonart die er jeweilig brauchte. Beet-
hovens „Mond-
schein-Sonate“
möchte man sich
beileibe in keiner
anderen Tonart als
Cis-moll denken.
Der Laie hält das
für eine Einbil-
dung; er vergißt
aber, daß man als
Musiker, selbst
ohne absolutes
Tonbewußsein, er-
schaudert, wenn
man das bekannte
Tonstück z. B. auf
einem zu tief ge-
stimmten Klavier
hört. Der eigen-
artige Zauber der
Tonart ist mit
einem Male völlig
verschwunden.
Das gleiche gilt
von der zweiten
Frage, ob man
„transponieren“
dürfe. Der Autor
setzt sein Lied in
Reiterei. vollem Bewußt-
sein des Toncha-
rakters in eine bestimmte Tonart. Dann kommen die Sänger mit ihren hohen
und tiefen Stimmen und lassen das Lied transponieren, ohne zu beachten, daß
dadurch fast immer der fein empfundene ursprüngliche Charakter verloren geht.
Da es eben verschiedene Stimmen gibt, muß man leider diesem Gewaltakt untätig
Zusehen, aber ein Übel, ein musikalischer Unfug bleibt er eben doch.
Zum Schlüsse: Kann man das absolute Tonbewußtsein verlieren? Diese
Frage steht und fällt mit organischen Veränderungen des Ohres. Alle schweren
Erkrankungen des Ohres töten das absolute Tonbewußtsein. Schreck (durch
Donner), auch psychische Erregungen und höheres Alter vermindern es häufig.
Doch bleibt selbst bei Taubheit noch immer das instinktmäßige Empfinden für
Tonhöhe und Tonfarbe (siehe Beethoven u. a.) zurück.
Der beste Prüfstein für ein absolutes Tonbewußtsein ist der zuerst an-
geschlagene Ton, der richtig bestimmt werden kann. Denn
alle jetzt weiter erklingenden Töne können vom ersten
aus durch richtige Distanzierung leicht abgeleitet werden.
Aus diesem Grunde ist die Konstatierung dieses Ton-
bewußtseins nicht immer leicht. Wer aber einen erst-
malig angeschlagenen Akkord absolut richtig angeben
kann, dessen absolutes Tonbewußtsein dürfte einwandfrei
festgestellt sein.
Ausziehende
Unsere
©ilder.
yÄrJnter den Malern, die der französischen Kunst um die
o) Mitte des 19. Jahrhunderts das Zeichen ihrer Persön-
lichkeit aufdrückten, sind: Corot, Millet und Courbet die
bedeutendsten. Ihre Kunst steht so hoch, und ihre Persön-
lichkeit ist so echt, daß ihre Werke auch heute in bestem
Sinne modern wirken und unserer Malerei vielfach ein Vor-
bild sind. In noch stärkerer Weise als Millet, der Poet
des Bauernlebens, ist Corot, ein Lyriker durch und durch.
Über all seinen Gemälden, so auch dem „Hirten“, den wir
nach der Radierung von F. Krostewitz wiedergeben, liegt Hans
ein arkadischer Friede gebreitet. Musikalischer Wohllaut,
wie von dem Ton einer Flöte, geht von den harmonischen Tonwerten aus, und
immer wieder versenkt man sich mit tiefem Glücksgefühl in diese Idyllen. Ihm
gegenüber steht Gustave Courbet, mehr als Realist und Dramatiker, da. Mit
festem Griff greift er in das Leben der Bauerngestalten, die er gern bei der
Arbeit schildert. Aber auch ihm liegen Zartheit, Schönheit, Idylle in hohem
Grade. Das beweist ebenso seine „Eselreiterin“, wie es aus den zahlreichen
Bildern hervorgeht, auf denen er Rehe im Waldesgrün darstellt.
* *
*
„Verlorene Fährte“ ist das Gemälde von Georges Busson zubenannt,
auf dem eine Schar von Rotröcken durch den Wald trabt und soeben einen Holz-
fahrer um Auskunft frägt. Es wäre nicht unmöglich, daß der Schwarzkittel oder
Hirsch, den sie gehetzt haben, ihnen entgangen ist, weil ein anderes Wild seine
Fährte kreuzte. Das kommt garnicht selten vor; aber hier machen die Hunde
Ein Maler, der mit Vorliebe Enten wiedergibt, sei es,
daß sie sich auf dem Lande, sei es vor allem, daß sie sich
im Wasser befinden und gegen eine fließende Strömung
Meid. anschwimmen, ist Alexander Köster. Wie gut hat er
in seinem Gemälde „Heimwärts“ mit ausdrucksvollen
Pinselstrichen das weiße Federkleid der Enten gemalt, und wie plastisch heben
sie sich von dem dunklen Wasser ab, dessen Strudel und Weilchen durch die
kräftige Bewegung der rudernden Füße hervorgebracht sind!
* tfc
*
Ein leiser behaglicher Flumor klingt durch Koch-Zeuthens Gemälde „Die
Ratsherren“ hindurch. Auf dem Marktplatz eines alten Städtchens, wohin man
sich aus der Hast des modernen Großstadtlebens gern versetzen möchte, liegt
der alte Rathausbau. Die alte Linde steht davor, und das Kopfpflaster, das am
Tage die Wagen so laut rattern läßt, schläft nun im Frieden des Mondscheins,
der sein Licht auch über die Mauer des Rathauses gießt. Da steigen die Rats-
herren in ihrem schwarzen Talar nach langer, anstrengender Sitzung die Treppe
herunter, um sich nach Hause zu begeben. In den nächsten Tagen wird der
Bürgerschaft kund werden, was ein wohlweiser Rat für sie beschlossen hat.
keinen aufgeregt suchenden Eindruck. Offenbar begeben
sich die Reiter, nachdem das Halali geblasen ist, wieder
nach Hause, haben dabei im dichten Walde die Fährte des
Weges verloren, und lassen sich ihn von dem Holzfahrer
weisen. a.
*