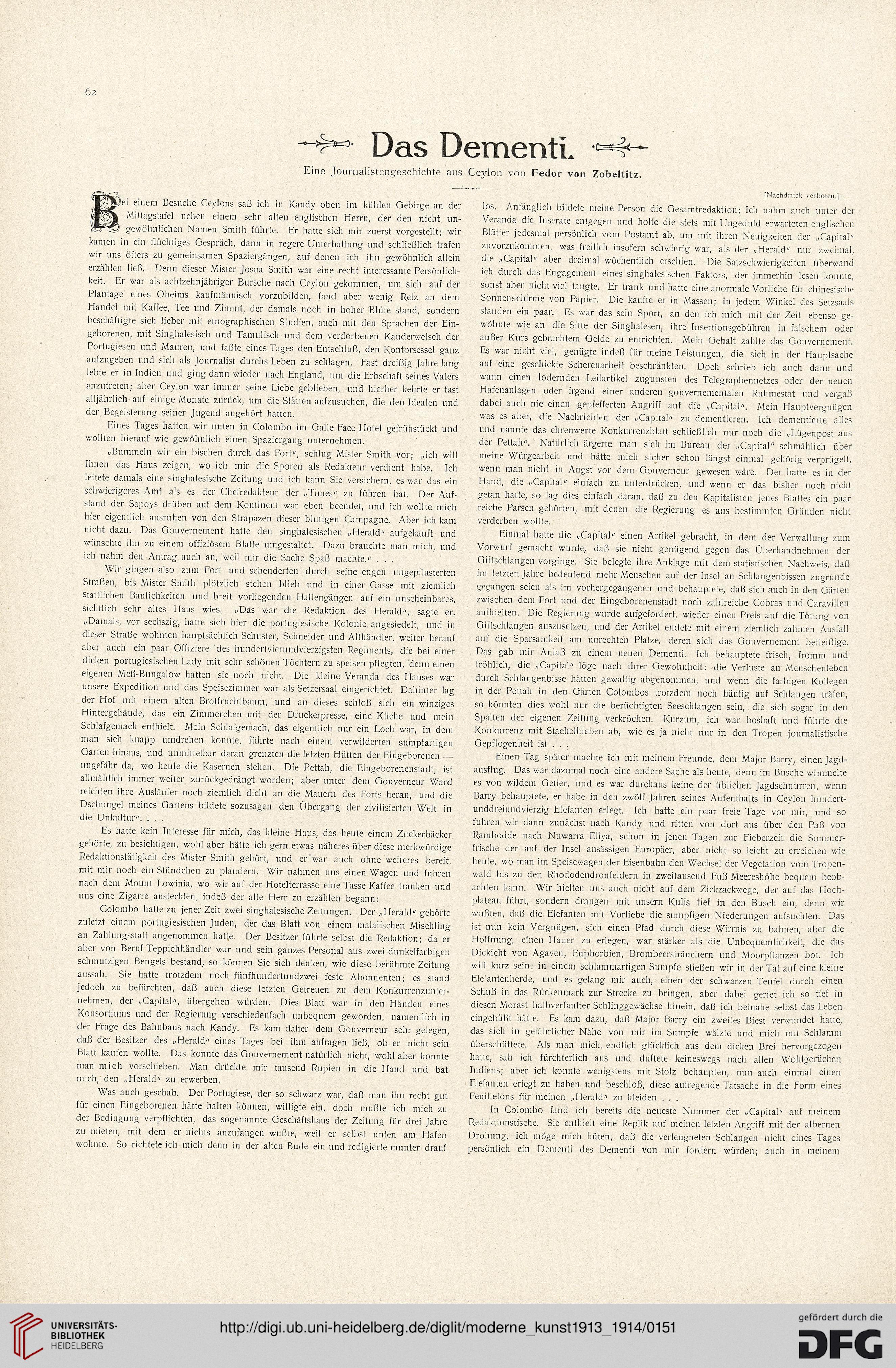62
-4« Das Dementi.
Eine Journalistengeschichte aus Ceylon von Pedor von Zobeltitz.
einem Besuche Ceylons saß ich in Kandy oben im kühlen Gebirge an der
littagstafel neben einem sehr alten englischen Herrn, der den nicht un-
ewöhnüchen Namen Smith führte. Er hatte sich mir zuerst vorgestellt; wir
kamen in ein flüchtiges Gespräch, dann in regere Unterhaltung und schließlich trafen
wir uns öfters zu gemeinsamen Spaziergängen, auf denen ich ihn gewöhnlich allein
erzählen ließ. Denn dieser Mister Josua Smith war eine recht interessante Persönlich-
keit. Er war als achtzehnjähriger Bursche nach Ceylon gekommen, um sich auf der
Plantage eines Oheims kaufmännisch vorzubilden, fand aber wenig Reiz an dem
Handel mit Kaffee, Tee und Zimmt, der damals noch in hoher Blüte stand, sondern
beschäftigte sich lieber mit etnographischen Studien, auch mit den Sprachen der Ein-
geborenen, mit Singhalesisch und Tamulisch und dem verdorbenen Kauderwelsch der
Portugiesen und Mauren, und faßte eines Tages den Entschluß, den Kontorsessel ganz
aufzugeben und sich als Journalist durchs Leben zu schlagen. Fast dreißig Jahre lang
lebte er in Indien und ging dann wieder nach England, um die Erbschaft seines Vaters
anzutreten; aber Ceylon war immer seine Liebe geblieben, und hierher kehrte er fast
alljährlich auf einige Monate zurück, um die Stätten aufzusuchen, die den Idealen und
der Begeisterung seiner Jugend angehört hatten.
Eines Tages hatten wir unten in Colombo im Galle Face Hotel gefrühstückt und
wollten hierauf wie gewöhnlich einen Spaziergang unternehmen.
„Bummeln wir ein bischen durch das Fort“, schlug Mister Smith vor; „ich will
Ihnen das Haus zeigen, wo ich mir die Sporen als Redakteur verdient habe. Ich
leitete damals eine singhalesische Zeitung und ich kann Sie versichern, es war das ein
schwierigeres Amt als es der Chefredakteur der „Times" zu führen hat. Der Auf-
stand der Sapoys drüben auf dem Kontinent war eben beendet, und ich wollte mich
hier eigentlich ausruhen von den Strapazen dieser blutigen Campagne. Aber ich kam
nicht dazu. Das Gouvernement hatte den singhalesischen „Herald" aufgekauft und
wünschte ihn zu einem offiziösem Blatte umgestaltet. Dazu brauchte man mich, und
ich nahm den Antrag auch an, weil mir die Sache Spaß machte." . . .
Wir gingen also zum Fort und schenderten durch seine engen ungepflasterten
Straßen, bis Mister Smith plötzlich stehen blieb und in einer Gasse mit ziemlich
stattlichen Baulichkeiten und breit vorliegenden Hallengängen auf ein unscheinbares,
sichtlich sehr altes Haus wies. „Das war die Redaktion des Flerald", sagte er.
„Damals, vor sechszig, hatte sich hier die portugiesische Kolonie angesiedelt, und in
dieser Straße wohnten hauptsächlich Schuster, Schneider und Althändler, weiter herauf
aber auch ein paar Offiziere des hundertvierundvierzigsten Regiments, die bei einer
dicken portugiesischen Lady mit sehr schönen Töchtern zu speisen pflegten, denn einen
eigenen Meß-Bungalow hatten sie noch nicht. Die kleine Veranda des Hauses war
unsere Expedition und das Speisezimmer war als Setzersaal eingerichtet. Dahinter lag
der Hof mit einem alten Brotfruchtbaum, und an dieses schloß sich ein winziges
Hintergebäude, das ein Zimmerchen mit der Druckerpresse, eine Küche und mein
Schlafgemach enthielt. Mein Schlafgemach, das eigentlich nur ein Loch war, in dem
man sich knapp umdrehen konnte, führte nach einem verwilderten sumpfartigen
Garten hinaus, und unmittelbar daran grenzten die letzten Hütten der Eingeborenen —
ungefähr da, wo heute die Kasernen stehen. Die Pettah, die Eingeborenenstadt, ist
allmählich immer weiter zurückgedrängt worden; aber unter dem Gouverneur Ward
reichten ihre Ausläufer noch ziemlich dicht an die Mauern des Forts heran, und die
Dschungel meines Gartens bildete sozusagen den Übergang der zivilisierten Welt in
die Unkultur“. . . .
Es hatte kein Interesse für mich, das kleine Haus, das heute einem Zuckerbäcker
gehörte, zu besichtigen, wohl aber hätte ich gern etwas näheres über diese merkwürdige
Redaktionstätigkeit des Mister Smith gehört, und er war auch ohne weiteres bereit,
mit mir noch ein Stündchen zu plaudern. Wir nahmen uns einen Wagen und fuhren
nach dem Mount Lowinia, wo wir auf der Hotelterrasse eine Tasse Kaffee tranken und
uns eine Zigarre ansteckten, indeß der alte Herr zu erzählen begann:
Colombo hatte zu jener Zeit zwei singhalesische Zeitungen. Der „Herald" gehörte
zuletzt einem portugiesischen Juden, der das Blatt von einem malaiischen Mischling
an Zahlungsstatt angenommen hatte. Der Besitzer führte selbst die Redaktion; da er
aber von Beruf Teppichhändler war und sein ganzes Personal aus zwei dunkelfarbigen
schmutzigen Bengels bestand, so können Sie sich denken, wie diese berühmte Zeitung
aussah. Sie hatte trotzdem noch fünfhundertundzwei feste Abonnenten; es stand
jedoch zu befürchten, daß auch diese letzten Getreuen zu dem Konkurrenzunter-
nehmen, der „Capital", übergehen würden. Dies Blatt war in den Händen eines
Konsortiums und der Regierung verschiedenfach unbequem geworden, namentlich in
der Frage des Bahnbaus nach Kandy. Es kam daher dem Gouverneur sehr gelegen,
daß der Besitzer des „Herald“ eines Tages bei ihm anfragen ließ, ob er nicht sein
Blatt kaufen wollte. Das konnte das Gouvernement natürlich nicht, wohl aber konnte
man mich vorschieben. Man drückte mir tausend Rupien in die Hand und bat
mich, den „Herald“ zu erwerben.
Was auch geschah. Der Portugiese, der so schwarz war, daß man ihn recht gut
für einen Eingeborenen hätte halten können, willigte ein, doch mußte ich mich zu
der Bedingung verpflichten, das sogenannte Geschäftshaus der Zeitung für drei Jahre
zu mieten, mit dem er nichts anzufangen wußte, weil er selbst unten am Hafen
wohnte. So richtete ich mich denn in der alten Bude ein und redigierte munter drauf
[Nachdruck verboten.]
los. Anfänglich bildete meine Person die Gesamtredaktion; ich nahm auch unter der
Veranda die Inserate entgegen und holte die stets mit Ungeduld erwarteten englischen
Blätter jedesmal persönlich vom Postamt ab, um mit ihren Neuigkeiten der „Capital“
zuvorzukommen, was freilich insofern schwierig war, als der „Herald" nur zweimal,
die „Capital" aber dreimal wöchentlich erschien. Die Satzschwierigkeiten überwand
ich durch das Engagement eines singhalesischen Faktors, der immerhin lesen konnte,
sonst aber nicht viel taugte. Er trank und hatte eine anormale Vorliebe für chinesische
Sonnenschirme von Papier. Die kaufte er in Massen; in jedem Winkel des Setzsaals
standen ein paar. Es war das sein Sport, an den ich mich mit der Zeit ebenso ge-
wöhnte wie an die Sitte der Singhalesen, ihre Insertionsgebühren in falschem oder
außer Kurs gebrachtem Gelde zu entrichten. Mein Gehalt zahlte das Gouvernement.
Es war nicht viel, genügte indeß für meine Leistungen, die sich in der Hauptsache
auf eine geschickte Scherenarbeit beschränkten. Doch schrieb ich auch dann und
wann einen lodernden Leitartikel zugunsten des Telegraphennetzes oder der neuen
Hafenanlagen oder irgend einer anderen gouvernementalen Ruhmestat und vergaß
dabei auch nie einen gepfefferter. Angriff auf die „Capital". Mein Hauptvergnügen
was es aber, die Nachrichten der „Capital" zu dementieren. Ich dementierte alles
und nannte das ehrenwerte Konkurrenzblatt schließlich nur noch die „Lügenpost aus
der Pettah". Natürlich ärgerte man sich im Bureau der „Capital“ schmählich über
meine Würgearbeit und hätte mich sicher schon längst einmal gehörig verprügelt,
wenn man nicht in Angst vor dem Gouverneur gewesen wäre. Der hatte es in der
Hand, die „Capital“ einfach zu unterdrücken, und wenn er das bisher noch nicht
getan hatte, so lag dies einfach daran, daß zu den Kapitalisten jenes Blattes ein paar
reiche Parsen gehörten, mit denen die Regierung es aus bestimmten Gründen nicht
verderben wollte.
Einmal hatte die „Capital“ einen Artikel gebracht, in dem der Verwaltung zum
Vorwurf gemacht wurde, daß sie nicht genügend gegen das Überhandnehmen der
Giftschlangen vorginge. Sie belegte ihre Anklage mit dem statistischen Nachweis, daß
im letzten Jahre bedeutend mehr Menschen auf der Insel an Schlangenbissen zugrunde
gegangen seien als im vorhergegangenen und behauptete, daß sich auch in den Gärten
zwischen dem Fort und der Eingeborenenstadt noch zahlreiche Cobras und Caravillen
aufhielten. Die Regierung wurde aufgefordert, wieder einen Preis auf die Tötung von
Giftschlangen auszusetzen, und der Artikel endete’ mit einem ziemlich zahmen Ausfall
auf die Sparsamkeit am Unrechten Platze, deren sich das Gouvernement befleißige.
Das gab mir Anlaß zu einem neuen Dementi. Ich behauptete frisch, fromm und
fröhlich, die „Capital“ löge nach ihrer Gewohnheit: die Verluste an Menschenleben
durch Schlangenbisse hätten gewaltig abgenommen, und wenn die farbigen Kollegen
in der Pettah in den Gärten Colombos trotzdem noch häufig auf Schlangen träfen,
so könnten dies wohl nur die berüchtigten Seeschlangen sein, die sich sogar in den
Spalten der eigenen Zeitung verkröchen. Kurzum, ich war boshaft und führte die
Konkurrenz mit Stachelhieben ab, wie es ja nicht nur in den Tropen journalistische
Gepflogenheit ist . . .
Einen Tag später machte ich mit meinem Freunde, dem Major Barry, einen Jagd-
ausflug. Das war dazumal noch eine andere Sache als heute, denn im Busche wimmelte
es von wildem Getier, und es war durchaus keine der üblichen Jagdschnurren, wenn
Barry behauptete, er habe in den zwölf Jahren seines Aufenthalts in Ceylon hundert-
unddreiundvierzig Elefanten erlegt. Ich hatte ein paar freie Tage vor mir, und so
fuhren wir dann zunächst nach Kandy und ritten von dort aus über den Paß von
Rambodde nach Nuwarra Eliya, schon in jenen Tagen zur Fieberzeit die Sommer-
frische der auf der Insel ansässigen Europäer, aber nicht so leicht zu erreichen wie
heute, wo man im Speisewagen der Eisenbahn den Wechsel der Vegetation vom Tropen-
wald bis zu den Rhododendronfeldern in zweitausend Fuß Meereshöhe bequem beob-
achten kann. Wir hielten uns auch nicht auf dem Zickzackwege, der auf das Hoch-
plateau führt, sondern drangen mit unsern Kulis tief in den Busch ein, denn wir
wußten, daß die Elefanten mit Vorliebe die sumpfigen Niederungen aufsuchten. Das
ist nun kein Vergnügen, sich einen Pfad durch diese Wirrnis zu bahnen, aber die
Hoffnung, einen Hauer zu erlegen, war stärker als die Unbequemlichkeit, die das
Dickicht von Agaven, Euphorbien, Brombeersträuchern und Moorpflanzen bot. Ich
will kurz sein: in einem schlammartigen Sumpfe stießen wir in der Tat auf eine kleine
Ele'antenherde, und es gelang mir auch, einen der schwarzen Teufel durch einen
Schuß in das Rückenmark zur Strecke zu bringen, aber dabei geriet ich so tief in
diesen Morast halbverfaulter Schlinggewächse hinein, daß ich beinahe selbst das Leben
eingebüßt hätte. Es kam dazu, daß Major Barry ein zweites Biest verwundet hatte,
das sich in gefährlicher Nähe von mir im Sumpfe wälzte und mich mit Schlamm
überschüttete. Als man mich, endlich glücklich aus dem dicken Brei hervorgezogen
hatte, sah ich fürchterlich aus und duftete keineswegs nach allen Wohlgerüchen
Indiens; aber ich konnte wenigstens mit Stolz behaupten, nun auch einmal einen
Elefanten erlegt zu haben und beschloß, diese aufregende Tatsache in die Form eines
Feuilletons für meinen „Herald“ zu kleiden . . .
In Colombo fand ich bereits die neueste Nummer der „Capital" auf meinem
Redaktionstische. Sie enthielt eine Replik auf meinen letzten Angriff mit der albernen
Drohung, ich möge mich hüten, daß die verleugneten Schlangen nicht eines Tages
persönlich ein Dementi des Dementi von mir fordern würden; auch in meinem
-4« Das Dementi.
Eine Journalistengeschichte aus Ceylon von Pedor von Zobeltitz.
einem Besuche Ceylons saß ich in Kandy oben im kühlen Gebirge an der
littagstafel neben einem sehr alten englischen Herrn, der den nicht un-
ewöhnüchen Namen Smith führte. Er hatte sich mir zuerst vorgestellt; wir
kamen in ein flüchtiges Gespräch, dann in regere Unterhaltung und schließlich trafen
wir uns öfters zu gemeinsamen Spaziergängen, auf denen ich ihn gewöhnlich allein
erzählen ließ. Denn dieser Mister Josua Smith war eine recht interessante Persönlich-
keit. Er war als achtzehnjähriger Bursche nach Ceylon gekommen, um sich auf der
Plantage eines Oheims kaufmännisch vorzubilden, fand aber wenig Reiz an dem
Handel mit Kaffee, Tee und Zimmt, der damals noch in hoher Blüte stand, sondern
beschäftigte sich lieber mit etnographischen Studien, auch mit den Sprachen der Ein-
geborenen, mit Singhalesisch und Tamulisch und dem verdorbenen Kauderwelsch der
Portugiesen und Mauren, und faßte eines Tages den Entschluß, den Kontorsessel ganz
aufzugeben und sich als Journalist durchs Leben zu schlagen. Fast dreißig Jahre lang
lebte er in Indien und ging dann wieder nach England, um die Erbschaft seines Vaters
anzutreten; aber Ceylon war immer seine Liebe geblieben, und hierher kehrte er fast
alljährlich auf einige Monate zurück, um die Stätten aufzusuchen, die den Idealen und
der Begeisterung seiner Jugend angehört hatten.
Eines Tages hatten wir unten in Colombo im Galle Face Hotel gefrühstückt und
wollten hierauf wie gewöhnlich einen Spaziergang unternehmen.
„Bummeln wir ein bischen durch das Fort“, schlug Mister Smith vor; „ich will
Ihnen das Haus zeigen, wo ich mir die Sporen als Redakteur verdient habe. Ich
leitete damals eine singhalesische Zeitung und ich kann Sie versichern, es war das ein
schwierigeres Amt als es der Chefredakteur der „Times" zu führen hat. Der Auf-
stand der Sapoys drüben auf dem Kontinent war eben beendet, und ich wollte mich
hier eigentlich ausruhen von den Strapazen dieser blutigen Campagne. Aber ich kam
nicht dazu. Das Gouvernement hatte den singhalesischen „Herald" aufgekauft und
wünschte ihn zu einem offiziösem Blatte umgestaltet. Dazu brauchte man mich, und
ich nahm den Antrag auch an, weil mir die Sache Spaß machte." . . .
Wir gingen also zum Fort und schenderten durch seine engen ungepflasterten
Straßen, bis Mister Smith plötzlich stehen blieb und in einer Gasse mit ziemlich
stattlichen Baulichkeiten und breit vorliegenden Hallengängen auf ein unscheinbares,
sichtlich sehr altes Haus wies. „Das war die Redaktion des Flerald", sagte er.
„Damals, vor sechszig, hatte sich hier die portugiesische Kolonie angesiedelt, und in
dieser Straße wohnten hauptsächlich Schuster, Schneider und Althändler, weiter herauf
aber auch ein paar Offiziere des hundertvierundvierzigsten Regiments, die bei einer
dicken portugiesischen Lady mit sehr schönen Töchtern zu speisen pflegten, denn einen
eigenen Meß-Bungalow hatten sie noch nicht. Die kleine Veranda des Hauses war
unsere Expedition und das Speisezimmer war als Setzersaal eingerichtet. Dahinter lag
der Hof mit einem alten Brotfruchtbaum, und an dieses schloß sich ein winziges
Hintergebäude, das ein Zimmerchen mit der Druckerpresse, eine Küche und mein
Schlafgemach enthielt. Mein Schlafgemach, das eigentlich nur ein Loch war, in dem
man sich knapp umdrehen konnte, führte nach einem verwilderten sumpfartigen
Garten hinaus, und unmittelbar daran grenzten die letzten Hütten der Eingeborenen —
ungefähr da, wo heute die Kasernen stehen. Die Pettah, die Eingeborenenstadt, ist
allmählich immer weiter zurückgedrängt worden; aber unter dem Gouverneur Ward
reichten ihre Ausläufer noch ziemlich dicht an die Mauern des Forts heran, und die
Dschungel meines Gartens bildete sozusagen den Übergang der zivilisierten Welt in
die Unkultur“. . . .
Es hatte kein Interesse für mich, das kleine Haus, das heute einem Zuckerbäcker
gehörte, zu besichtigen, wohl aber hätte ich gern etwas näheres über diese merkwürdige
Redaktionstätigkeit des Mister Smith gehört, und er war auch ohne weiteres bereit,
mit mir noch ein Stündchen zu plaudern. Wir nahmen uns einen Wagen und fuhren
nach dem Mount Lowinia, wo wir auf der Hotelterrasse eine Tasse Kaffee tranken und
uns eine Zigarre ansteckten, indeß der alte Herr zu erzählen begann:
Colombo hatte zu jener Zeit zwei singhalesische Zeitungen. Der „Herald" gehörte
zuletzt einem portugiesischen Juden, der das Blatt von einem malaiischen Mischling
an Zahlungsstatt angenommen hatte. Der Besitzer führte selbst die Redaktion; da er
aber von Beruf Teppichhändler war und sein ganzes Personal aus zwei dunkelfarbigen
schmutzigen Bengels bestand, so können Sie sich denken, wie diese berühmte Zeitung
aussah. Sie hatte trotzdem noch fünfhundertundzwei feste Abonnenten; es stand
jedoch zu befürchten, daß auch diese letzten Getreuen zu dem Konkurrenzunter-
nehmen, der „Capital", übergehen würden. Dies Blatt war in den Händen eines
Konsortiums und der Regierung verschiedenfach unbequem geworden, namentlich in
der Frage des Bahnbaus nach Kandy. Es kam daher dem Gouverneur sehr gelegen,
daß der Besitzer des „Herald“ eines Tages bei ihm anfragen ließ, ob er nicht sein
Blatt kaufen wollte. Das konnte das Gouvernement natürlich nicht, wohl aber konnte
man mich vorschieben. Man drückte mir tausend Rupien in die Hand und bat
mich, den „Herald“ zu erwerben.
Was auch geschah. Der Portugiese, der so schwarz war, daß man ihn recht gut
für einen Eingeborenen hätte halten können, willigte ein, doch mußte ich mich zu
der Bedingung verpflichten, das sogenannte Geschäftshaus der Zeitung für drei Jahre
zu mieten, mit dem er nichts anzufangen wußte, weil er selbst unten am Hafen
wohnte. So richtete ich mich denn in der alten Bude ein und redigierte munter drauf
[Nachdruck verboten.]
los. Anfänglich bildete meine Person die Gesamtredaktion; ich nahm auch unter der
Veranda die Inserate entgegen und holte die stets mit Ungeduld erwarteten englischen
Blätter jedesmal persönlich vom Postamt ab, um mit ihren Neuigkeiten der „Capital“
zuvorzukommen, was freilich insofern schwierig war, als der „Herald" nur zweimal,
die „Capital" aber dreimal wöchentlich erschien. Die Satzschwierigkeiten überwand
ich durch das Engagement eines singhalesischen Faktors, der immerhin lesen konnte,
sonst aber nicht viel taugte. Er trank und hatte eine anormale Vorliebe für chinesische
Sonnenschirme von Papier. Die kaufte er in Massen; in jedem Winkel des Setzsaals
standen ein paar. Es war das sein Sport, an den ich mich mit der Zeit ebenso ge-
wöhnte wie an die Sitte der Singhalesen, ihre Insertionsgebühren in falschem oder
außer Kurs gebrachtem Gelde zu entrichten. Mein Gehalt zahlte das Gouvernement.
Es war nicht viel, genügte indeß für meine Leistungen, die sich in der Hauptsache
auf eine geschickte Scherenarbeit beschränkten. Doch schrieb ich auch dann und
wann einen lodernden Leitartikel zugunsten des Telegraphennetzes oder der neuen
Hafenanlagen oder irgend einer anderen gouvernementalen Ruhmestat und vergaß
dabei auch nie einen gepfefferter. Angriff auf die „Capital". Mein Hauptvergnügen
was es aber, die Nachrichten der „Capital" zu dementieren. Ich dementierte alles
und nannte das ehrenwerte Konkurrenzblatt schließlich nur noch die „Lügenpost aus
der Pettah". Natürlich ärgerte man sich im Bureau der „Capital“ schmählich über
meine Würgearbeit und hätte mich sicher schon längst einmal gehörig verprügelt,
wenn man nicht in Angst vor dem Gouverneur gewesen wäre. Der hatte es in der
Hand, die „Capital“ einfach zu unterdrücken, und wenn er das bisher noch nicht
getan hatte, so lag dies einfach daran, daß zu den Kapitalisten jenes Blattes ein paar
reiche Parsen gehörten, mit denen die Regierung es aus bestimmten Gründen nicht
verderben wollte.
Einmal hatte die „Capital“ einen Artikel gebracht, in dem der Verwaltung zum
Vorwurf gemacht wurde, daß sie nicht genügend gegen das Überhandnehmen der
Giftschlangen vorginge. Sie belegte ihre Anklage mit dem statistischen Nachweis, daß
im letzten Jahre bedeutend mehr Menschen auf der Insel an Schlangenbissen zugrunde
gegangen seien als im vorhergegangenen und behauptete, daß sich auch in den Gärten
zwischen dem Fort und der Eingeborenenstadt noch zahlreiche Cobras und Caravillen
aufhielten. Die Regierung wurde aufgefordert, wieder einen Preis auf die Tötung von
Giftschlangen auszusetzen, und der Artikel endete’ mit einem ziemlich zahmen Ausfall
auf die Sparsamkeit am Unrechten Platze, deren sich das Gouvernement befleißige.
Das gab mir Anlaß zu einem neuen Dementi. Ich behauptete frisch, fromm und
fröhlich, die „Capital“ löge nach ihrer Gewohnheit: die Verluste an Menschenleben
durch Schlangenbisse hätten gewaltig abgenommen, und wenn die farbigen Kollegen
in der Pettah in den Gärten Colombos trotzdem noch häufig auf Schlangen träfen,
so könnten dies wohl nur die berüchtigten Seeschlangen sein, die sich sogar in den
Spalten der eigenen Zeitung verkröchen. Kurzum, ich war boshaft und führte die
Konkurrenz mit Stachelhieben ab, wie es ja nicht nur in den Tropen journalistische
Gepflogenheit ist . . .
Einen Tag später machte ich mit meinem Freunde, dem Major Barry, einen Jagd-
ausflug. Das war dazumal noch eine andere Sache als heute, denn im Busche wimmelte
es von wildem Getier, und es war durchaus keine der üblichen Jagdschnurren, wenn
Barry behauptete, er habe in den zwölf Jahren seines Aufenthalts in Ceylon hundert-
unddreiundvierzig Elefanten erlegt. Ich hatte ein paar freie Tage vor mir, und so
fuhren wir dann zunächst nach Kandy und ritten von dort aus über den Paß von
Rambodde nach Nuwarra Eliya, schon in jenen Tagen zur Fieberzeit die Sommer-
frische der auf der Insel ansässigen Europäer, aber nicht so leicht zu erreichen wie
heute, wo man im Speisewagen der Eisenbahn den Wechsel der Vegetation vom Tropen-
wald bis zu den Rhododendronfeldern in zweitausend Fuß Meereshöhe bequem beob-
achten kann. Wir hielten uns auch nicht auf dem Zickzackwege, der auf das Hoch-
plateau führt, sondern drangen mit unsern Kulis tief in den Busch ein, denn wir
wußten, daß die Elefanten mit Vorliebe die sumpfigen Niederungen aufsuchten. Das
ist nun kein Vergnügen, sich einen Pfad durch diese Wirrnis zu bahnen, aber die
Hoffnung, einen Hauer zu erlegen, war stärker als die Unbequemlichkeit, die das
Dickicht von Agaven, Euphorbien, Brombeersträuchern und Moorpflanzen bot. Ich
will kurz sein: in einem schlammartigen Sumpfe stießen wir in der Tat auf eine kleine
Ele'antenherde, und es gelang mir auch, einen der schwarzen Teufel durch einen
Schuß in das Rückenmark zur Strecke zu bringen, aber dabei geriet ich so tief in
diesen Morast halbverfaulter Schlinggewächse hinein, daß ich beinahe selbst das Leben
eingebüßt hätte. Es kam dazu, daß Major Barry ein zweites Biest verwundet hatte,
das sich in gefährlicher Nähe von mir im Sumpfe wälzte und mich mit Schlamm
überschüttete. Als man mich, endlich glücklich aus dem dicken Brei hervorgezogen
hatte, sah ich fürchterlich aus und duftete keineswegs nach allen Wohlgerüchen
Indiens; aber ich konnte wenigstens mit Stolz behaupten, nun auch einmal einen
Elefanten erlegt zu haben und beschloß, diese aufregende Tatsache in die Form eines
Feuilletons für meinen „Herald“ zu kleiden . . .
In Colombo fand ich bereits die neueste Nummer der „Capital" auf meinem
Redaktionstische. Sie enthielt eine Replik auf meinen letzten Angriff mit der albernen
Drohung, ich möge mich hüten, daß die verleugneten Schlangen nicht eines Tages
persönlich ein Dementi des Dementi von mir fordern würden; auch in meinem