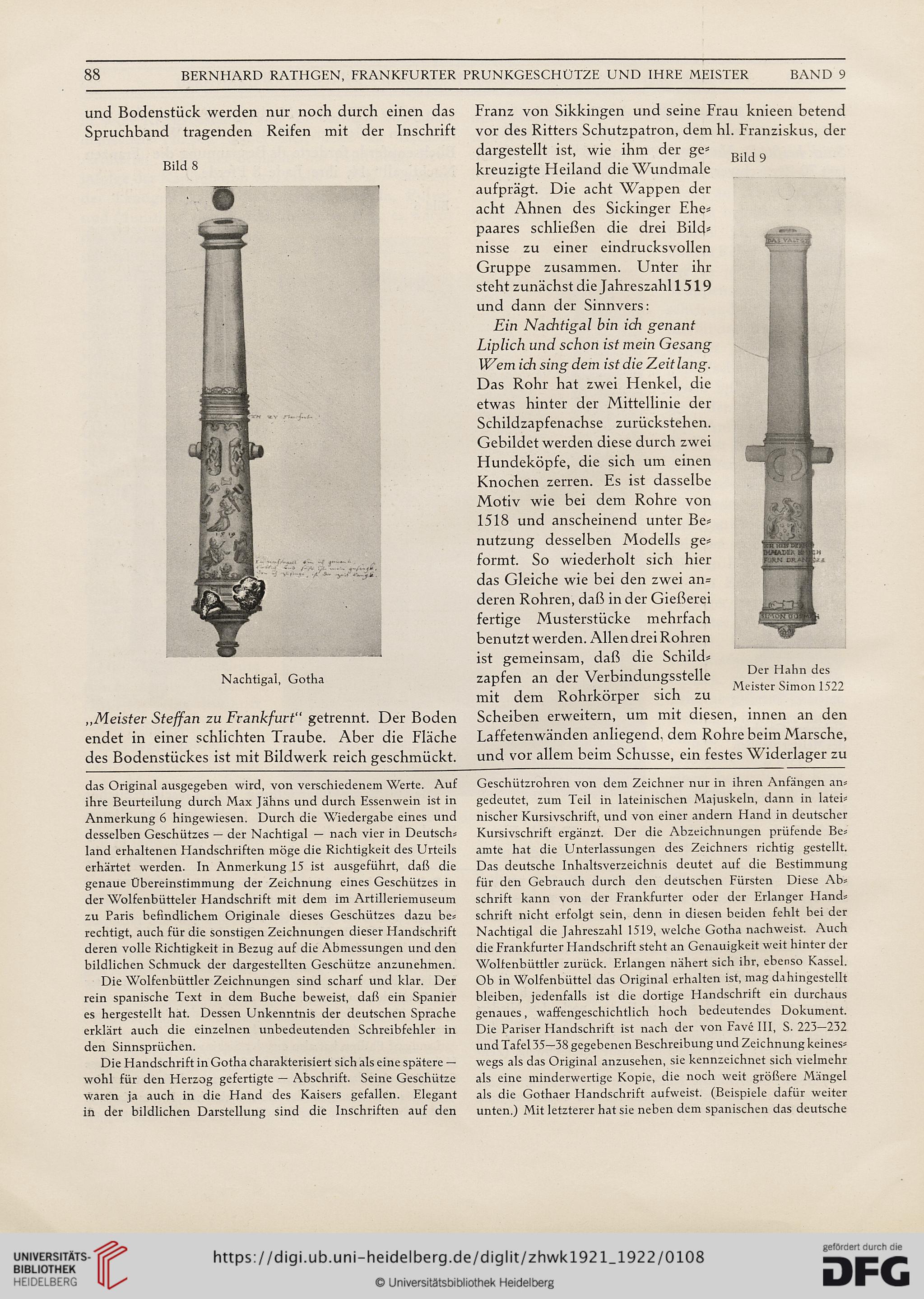BERNHARD RATHGEN, FRANKFURTER PRUNKGESCHÜTZE UND IHRE MEISTER
88
BAND 9
und Bodenstück werden nur noch durch einen das
Spruchband tragenden Reifen mit der Inschrift
Bild 8
V
Nachtigal, Gotha
„Meister Steffan zu Frankfurt“ getrennt. Der Boden
endet in einer schlichten Traube. Aber die Fläche
des Bodenstückes ist mit Bildwerk reich geschmückt,
das Original ausgegeben wird, von verschiedenem Werte. Auf
ihre Beurteilung durch Max Jähns und durch Essenwein ist in
Anmerkung 6 hingewiesen. Durch die Wiedergabe eines und
desselben Geschützes — der Nachtigal — nach vier in Deutschs
land erhaltenen Handschriften möge die Richtigkeit des Urteils
erhärtet werden. In Anmerkung 15 ist ausgeführt, daß die
genaue Übereinstimmung der Zeichnung eines Geschützes in
der Wolfenbütteier Handschrift mit dem im Artilleriemuseum
zu Paris befindlichem Originale dieses Geschützes dazu be*
rechtigt, auch für die sonstigen Zeichnungen dieser Handschrift
deren volle Richtigkeit in Bezug auf die Abmessungen und den
bildlichen Schmuck der dargestellten Geschütze anzunehmen.
Die Wolfenbüttler Zeichnungen sind scharf und klar. Der
rein spanische Text in dem Buche beweist, daß ein Spanier
es hergestellt hat. Dessen Unkenntnis der deutschen Sprache
erklärt auch die einzelnen unbedeutenden Schreibfehler in
den Sinnsprüchen.
Die Handschrift in Gotha charakterisiert sich als eine spätere —
wohl für den Herzog gefertigte — Abschrift. Seine Geschütze
waren ja auch in die Hand des Kaisers gefallen. Elegant
in der bildlichen Darstellung sind die Inschriften auf den
Franz von Sikkingen und seine Frau knieen betend
vor des Ritters Schutzpatron, dem hl. Franziskus, der
dargestellt ist, wie ihm der ge*
kreuzigte Heiland die Wundmale
aufprägt. Die acht Wappen der
acht Ahnen des Sickinger Ehe*
paares schließen die drei Bild®
nisse zu einer eindrucksvollen
Gruppe zusammen. Unter ihr
steht zunächst die Jahreszahl 1519
und dann der Sinnvers:
Ein Nachtigal bin ich genant
Liplich und schon ist mein Gesang
Wem ich sing dem ist die Zeitlang.
Das Rohr hat zwei Henkel, die
etwas hinter der Mittellinie der
Schildzapfenachse zurückstehen.
Gebildet werden diese durch zwei
Hundeköpfe, die sich um einen
Knochen zerren. Es ist dasselbe
Motiv wie bei dem Rohre von
1518 und anscheinend unter Be*
nutzung desselben Modells ge*
formt. So wiederholt sich hier
das Gleiche wie bei den zwei an-
deren Rohren, daß in der Gießerei
fertige Musterstücke mehrfach
benutzt werden. Allen drei Rohren
ist gemeinsam, daß die Schild*
zapfen an der Verbindungsstelle
mit dem Rohrkörper sich zu
Scheiben erweitern, um mit diesen, innen an den
Laffetenwänden anliegend, dem Rohre beim Marsche,
und vor allem beim Schüsse, ein festes Widerlager zu
Geschützrohren von dem Zeichner nur in ihren Anfängen an*
gedeutet, zum Teil in lateinischen Majuskeln, dann in latei*
nischer Kursivschrift, und von einer andern Hand in deutscher
Kursivschrift ergänzt. Der die Abzeichnungen prüfende Be*
amte hat die Unterlassungen des Zeichners richtig gestellt.
Das deutsche Inhaltsverzeichnis deutet auf die Bestimmung
für den Gebrauch durch den deutschen Fürsten Diese Ab*
schrift kann von der Frankfurter oder der Erlanger Hand*
Schrift nicht erfolgt sein, denn in diesen beiden fehlt bei der
Nachtigal die Jahreszahl 1519, welche Gotha nachweist. Auch
die Frankfurter Handschrift steht an Genauigkeit weit hinter der
Wolfenbüttler zurück. Erlangen nähert sich ihr, ebenso Kassel.
Ob in Wolfenbüttel das Original erhalten ist, mag dahingestellt
bleiben, jedenfalls ist die dortige Handschrift ein durchaus
genaues, waffengeschichtlich hoch bedeutendes Dokument.
Die Pariser Handschrift ist nach der von Fave III, S. 223—232
und Tafel 35—38 gegebenen Beschreibung und Zeichnung keines*
wegs als das Original anzusehen, sie kennzeichnet sich vielmehr
als eine minderwertige Kopie, die noch weit größere Mängel
als die Gothaer Handschrift aufweist. (Beispiele dafür weiter
unten.) Mit letzterer hat sie neben dem spanischen das deutsche
Bild 9
V .
I .
I
I:
Der Hahn des
Meister Simon 1522
88
BAND 9
und Bodenstück werden nur noch durch einen das
Spruchband tragenden Reifen mit der Inschrift
Bild 8
V
Nachtigal, Gotha
„Meister Steffan zu Frankfurt“ getrennt. Der Boden
endet in einer schlichten Traube. Aber die Fläche
des Bodenstückes ist mit Bildwerk reich geschmückt,
das Original ausgegeben wird, von verschiedenem Werte. Auf
ihre Beurteilung durch Max Jähns und durch Essenwein ist in
Anmerkung 6 hingewiesen. Durch die Wiedergabe eines und
desselben Geschützes — der Nachtigal — nach vier in Deutschs
land erhaltenen Handschriften möge die Richtigkeit des Urteils
erhärtet werden. In Anmerkung 15 ist ausgeführt, daß die
genaue Übereinstimmung der Zeichnung eines Geschützes in
der Wolfenbütteier Handschrift mit dem im Artilleriemuseum
zu Paris befindlichem Originale dieses Geschützes dazu be*
rechtigt, auch für die sonstigen Zeichnungen dieser Handschrift
deren volle Richtigkeit in Bezug auf die Abmessungen und den
bildlichen Schmuck der dargestellten Geschütze anzunehmen.
Die Wolfenbüttler Zeichnungen sind scharf und klar. Der
rein spanische Text in dem Buche beweist, daß ein Spanier
es hergestellt hat. Dessen Unkenntnis der deutschen Sprache
erklärt auch die einzelnen unbedeutenden Schreibfehler in
den Sinnsprüchen.
Die Handschrift in Gotha charakterisiert sich als eine spätere —
wohl für den Herzog gefertigte — Abschrift. Seine Geschütze
waren ja auch in die Hand des Kaisers gefallen. Elegant
in der bildlichen Darstellung sind die Inschriften auf den
Franz von Sikkingen und seine Frau knieen betend
vor des Ritters Schutzpatron, dem hl. Franziskus, der
dargestellt ist, wie ihm der ge*
kreuzigte Heiland die Wundmale
aufprägt. Die acht Wappen der
acht Ahnen des Sickinger Ehe*
paares schließen die drei Bild®
nisse zu einer eindrucksvollen
Gruppe zusammen. Unter ihr
steht zunächst die Jahreszahl 1519
und dann der Sinnvers:
Ein Nachtigal bin ich genant
Liplich und schon ist mein Gesang
Wem ich sing dem ist die Zeitlang.
Das Rohr hat zwei Henkel, die
etwas hinter der Mittellinie der
Schildzapfenachse zurückstehen.
Gebildet werden diese durch zwei
Hundeköpfe, die sich um einen
Knochen zerren. Es ist dasselbe
Motiv wie bei dem Rohre von
1518 und anscheinend unter Be*
nutzung desselben Modells ge*
formt. So wiederholt sich hier
das Gleiche wie bei den zwei an-
deren Rohren, daß in der Gießerei
fertige Musterstücke mehrfach
benutzt werden. Allen drei Rohren
ist gemeinsam, daß die Schild*
zapfen an der Verbindungsstelle
mit dem Rohrkörper sich zu
Scheiben erweitern, um mit diesen, innen an den
Laffetenwänden anliegend, dem Rohre beim Marsche,
und vor allem beim Schüsse, ein festes Widerlager zu
Geschützrohren von dem Zeichner nur in ihren Anfängen an*
gedeutet, zum Teil in lateinischen Majuskeln, dann in latei*
nischer Kursivschrift, und von einer andern Hand in deutscher
Kursivschrift ergänzt. Der die Abzeichnungen prüfende Be*
amte hat die Unterlassungen des Zeichners richtig gestellt.
Das deutsche Inhaltsverzeichnis deutet auf die Bestimmung
für den Gebrauch durch den deutschen Fürsten Diese Ab*
schrift kann von der Frankfurter oder der Erlanger Hand*
Schrift nicht erfolgt sein, denn in diesen beiden fehlt bei der
Nachtigal die Jahreszahl 1519, welche Gotha nachweist. Auch
die Frankfurter Handschrift steht an Genauigkeit weit hinter der
Wolfenbüttler zurück. Erlangen nähert sich ihr, ebenso Kassel.
Ob in Wolfenbüttel das Original erhalten ist, mag dahingestellt
bleiben, jedenfalls ist die dortige Handschrift ein durchaus
genaues, waffengeschichtlich hoch bedeutendes Dokument.
Die Pariser Handschrift ist nach der von Fave III, S. 223—232
und Tafel 35—38 gegebenen Beschreibung und Zeichnung keines*
wegs als das Original anzusehen, sie kennzeichnet sich vielmehr
als eine minderwertige Kopie, die noch weit größere Mängel
als die Gothaer Handschrift aufweist. (Beispiele dafür weiter
unten.) Mit letzterer hat sie neben dem spanischen das deutsche
Bild 9
V .
I .
I
I:
Der Hahn des
Meister Simon 1522