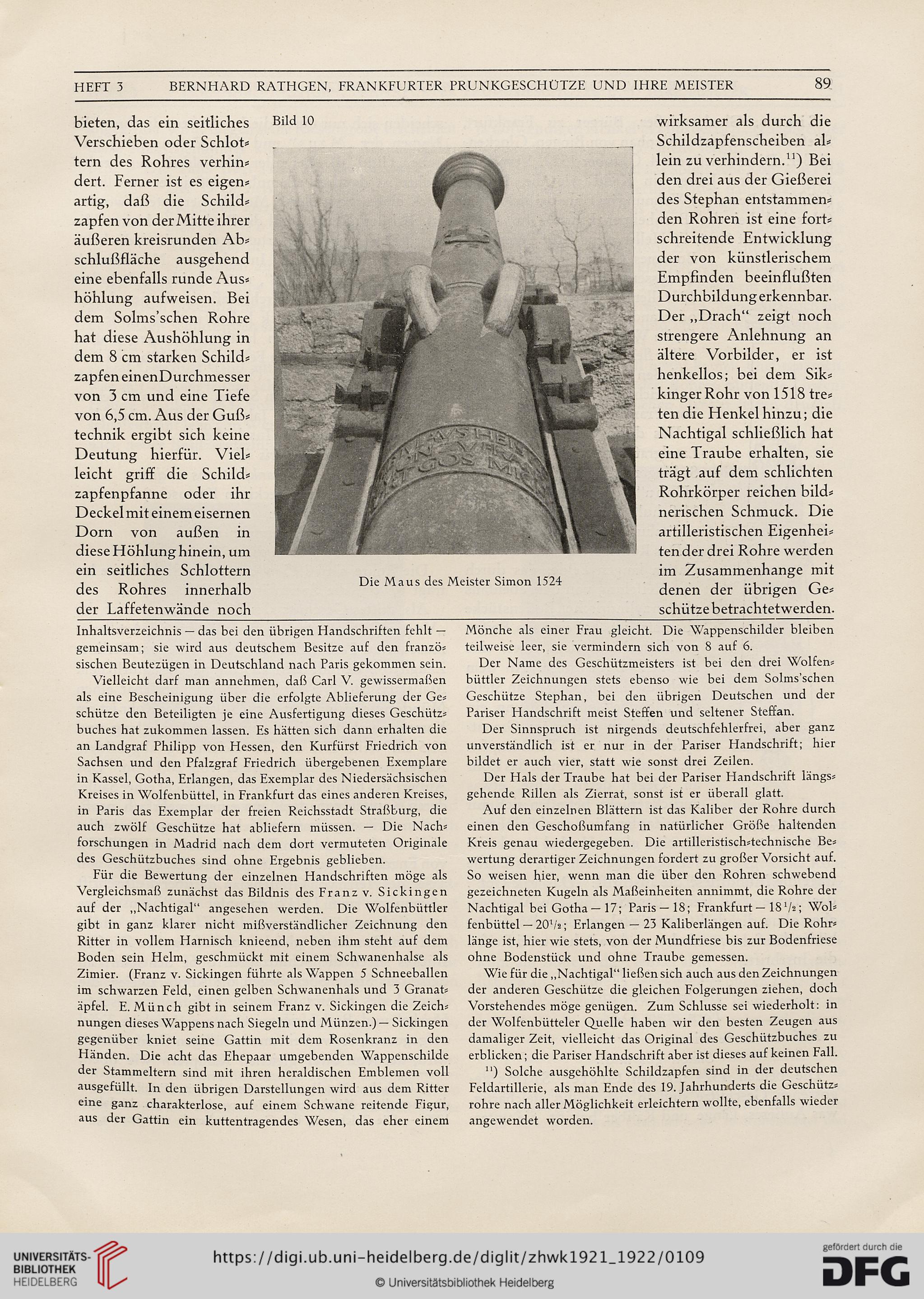HEFT 3
BERNHARD RATHGEN, FRANKFURTER PRUNKGESCHÜTZE UND IHRE MEISTER
89
bieten, das ein seitliches
Verschieben oder Schlot*
tern des Rohres verhin*
dert. Ferner ist es eigen*
artig, daß die Schild*
zapfen von der Mitte ihrer
äußeren kreisrunden Ab*
schlußfläche ausgehend
eine ebenfalls runde Aus*
höhlung aufweisen. Bei
dem Solms’schen Rohre
hat diese Aushöhlung in
dem 8 cm starken Schild*
zapfen einenDurchmesser
von 3 cm und eine Tiefe
von 6,5 cm. Aus der Guß*
technik ergibt sich keine
Deutung hierfür. Viel*
leicht griff die Schild*
zapfenpfanne oder ihr
Deckel mit einem eisernen
Dorn von außen in
dieseHöhlunghinein, um
ein seitliches Schlottern
des Rohres innerhalb
der Laffetenwände noch
Bild 10
Die Maus des Meister Simon 1524
wirksamer als durch die
Schildzapfenscheiben al*
lein zu verhindern.11) Bei
den drei aus der Gießerei
des Stephan entstammen*
den Rohren ist eine fort*
schreitende Entwicklung
der von künstlerischem
Empfinden beeinflußten
Durchbildungerkennbar.
Der „Drach“ zeigt noch
strengere Anlehnung an
ältere Vorbilder, er ist
henkellos; bei dem Sik*
kinger Rohr von 1518 tre*
ten die Henkel hinzu; die
Nachtigal schließlich hat
eine Traube erhalten, sie
trägt auf dem schlichten
Rohrkörper reichen bild*
nerischen Schmuck. Die
artilleristischen Eigenhei*
ten der drei Rohre werden
im Zusammenhänge mit
denen der übrigen Ge*
schütze betrachtetwerden.
Inhaltsverzeichnis — das bei den übrigen Handschriften fehlt —
gemeinsam; sie wird aus deutschem Besitze auf den franzö*
sischen Beutezügen in Deutschland nach Paris gekommen sein.
Vielleicht darf man annehmen, daß Carl V. gewissermaßen
als eine Bescheinigung über die erfolgte Ablieferung der Ge*
schütze den Beteiligten je eine Ausfertigung dieses Geschütz*
buches hat zukommen lassen. Es hätten sich dann erhalten die
an Landgraf Philipp von Hessen, den Kurfürst Friedrich von
Sachsen und den Pfalzgraf Friedrich übergebenen Exemplare
in Kassel, Gotha, Erlangen, das Exemplar des Niedersächsischen
Kreises in Wolfenbüttel, in Frankfurt das eines anderen Kreises,
in Paris das Exemplar der freien Reichsstadt Straßburg, die
auch zwölf Geschütze hat abliefern müssen. — Die Nach*
forschungen in Madrid nach dem dort vermuteten Originale
des Geschützbuches sind ohne Ergebnis geblieben.
Für die Bewertung der einzelnen Handschriften möge als
Vergleichsmaß zunächst das Bildnis des Franz v. Sickingen
auf der „Nachtigal“ angesehen werden. Die Wolfenbüttler
gibt in ganz klarer nicht mißverständlicher Zeichnung den
Ritter in vollem Harnisch knieend, neben ihm steht auf dem
Boden sein Helm, geschmückt mit einem Schwanenhalse als
Zimier. (Franz v. Sickingen führte als Wappen 5 Schneeballen
im schwarzen Feld, einen gelben Schwanenhals und 3 Granat*
äpfel. E. Münch gibt in seinem Franz v. Sickingen die Zeich*
nungen dieses Wappens nach Siegeln und Münzen.) — Sickingen
gegenüber kniet seine Gattin mit dem Rosenkranz in den
Händen. Die acht das Ehepaar umgebenden Wappenschilde
der Stammeltern sind mit ihren heraldischen Emblemen voll
ausgefüllt. In den übrigen Darstellungen wird aus dem Ritter
eine ganz charakterlose, auf einem Schwane reitende Figur,
aus der Gattin ein kuttentragendes Wesen, das eher einem
Mönche als einer Frau gleicht. Die Wappenschilder bleiben
teilweise leer, sie vermindern sich von 8 auf 6.
Der Name des Geschützmeisters ist bei den drei Wolfen*
büttler Zeichnungen stets ebenso wie bei dem Solms’schen
Geschütze Stephan, bei den übrigen Deutschen und der
Pariser Handschrift meist Steffen und seltener Steffan.
Der Sinnspruch ist nirgends deutschfehlerfrei, aber ganz
unverständlich ist er nur in der Pariser Handschrift; hier
bildet er auch vier, statt wie sonst drei Zeilen.
Der Hals der Traube hat bei der Pariser Handschrift längs*
gehende Rillen als Zierrat, sonst ist er überall glatt.
Auf den einzelnen Blättern ist das Kaliber der Rohre durch
einen den Geschoßumfang in natürlicher Größe haltenden
Kreis genau wiedergegeben. Die artilleristisch*technische Be*
wertung derartiger Zeichnungen fordert zu großer Vorsicht auf.
So weisen hier, wenn man die über den Rohren schwebend
gezeichneten Kugeln als Maßeinheiten annimmt, die Rohre der
Nachtigal bei Gotha—17; Paris —18; Frankfurt—18’/s; Wol*
fenbüttel — 2O'/s; Erlangen — 23 Kaliberlängen auf. Die Rohr*
länge ist, hier wie stets, von der Mundfriese bis zur Bodenfriese
ohne Bodenstück und ohne Traube gemessen.
Wie für die „Nachtigal“ ließen sich auch aus den Zeichnungen
der anderen Geschütze die gleichen Folgerungen ziehen, doch
Vorstehendes möge genügen. Zum Schlüsse sei wiederholt: in
der Wolfenbütteier Quelle haben wir den besten Zeugen aus
damaliger Zeit, vielleicht das Original des Geschützbuches zu
erblicken; die Pariser Handschrift aber ist dieses auf keinen Fall.
’*) Solche ausgehöhlte Schildzapfen sind in der deutschen
Feldartillerie, als man Ende des 19. Jahrhunderts die Geschütz*
rohre nach aller Möglichkeit erleichtern wollte, ebenfalls wieder
angewendet worden.
BERNHARD RATHGEN, FRANKFURTER PRUNKGESCHÜTZE UND IHRE MEISTER
89
bieten, das ein seitliches
Verschieben oder Schlot*
tern des Rohres verhin*
dert. Ferner ist es eigen*
artig, daß die Schild*
zapfen von der Mitte ihrer
äußeren kreisrunden Ab*
schlußfläche ausgehend
eine ebenfalls runde Aus*
höhlung aufweisen. Bei
dem Solms’schen Rohre
hat diese Aushöhlung in
dem 8 cm starken Schild*
zapfen einenDurchmesser
von 3 cm und eine Tiefe
von 6,5 cm. Aus der Guß*
technik ergibt sich keine
Deutung hierfür. Viel*
leicht griff die Schild*
zapfenpfanne oder ihr
Deckel mit einem eisernen
Dorn von außen in
dieseHöhlunghinein, um
ein seitliches Schlottern
des Rohres innerhalb
der Laffetenwände noch
Bild 10
Die Maus des Meister Simon 1524
wirksamer als durch die
Schildzapfenscheiben al*
lein zu verhindern.11) Bei
den drei aus der Gießerei
des Stephan entstammen*
den Rohren ist eine fort*
schreitende Entwicklung
der von künstlerischem
Empfinden beeinflußten
Durchbildungerkennbar.
Der „Drach“ zeigt noch
strengere Anlehnung an
ältere Vorbilder, er ist
henkellos; bei dem Sik*
kinger Rohr von 1518 tre*
ten die Henkel hinzu; die
Nachtigal schließlich hat
eine Traube erhalten, sie
trägt auf dem schlichten
Rohrkörper reichen bild*
nerischen Schmuck. Die
artilleristischen Eigenhei*
ten der drei Rohre werden
im Zusammenhänge mit
denen der übrigen Ge*
schütze betrachtetwerden.
Inhaltsverzeichnis — das bei den übrigen Handschriften fehlt —
gemeinsam; sie wird aus deutschem Besitze auf den franzö*
sischen Beutezügen in Deutschland nach Paris gekommen sein.
Vielleicht darf man annehmen, daß Carl V. gewissermaßen
als eine Bescheinigung über die erfolgte Ablieferung der Ge*
schütze den Beteiligten je eine Ausfertigung dieses Geschütz*
buches hat zukommen lassen. Es hätten sich dann erhalten die
an Landgraf Philipp von Hessen, den Kurfürst Friedrich von
Sachsen und den Pfalzgraf Friedrich übergebenen Exemplare
in Kassel, Gotha, Erlangen, das Exemplar des Niedersächsischen
Kreises in Wolfenbüttel, in Frankfurt das eines anderen Kreises,
in Paris das Exemplar der freien Reichsstadt Straßburg, die
auch zwölf Geschütze hat abliefern müssen. — Die Nach*
forschungen in Madrid nach dem dort vermuteten Originale
des Geschützbuches sind ohne Ergebnis geblieben.
Für die Bewertung der einzelnen Handschriften möge als
Vergleichsmaß zunächst das Bildnis des Franz v. Sickingen
auf der „Nachtigal“ angesehen werden. Die Wolfenbüttler
gibt in ganz klarer nicht mißverständlicher Zeichnung den
Ritter in vollem Harnisch knieend, neben ihm steht auf dem
Boden sein Helm, geschmückt mit einem Schwanenhalse als
Zimier. (Franz v. Sickingen führte als Wappen 5 Schneeballen
im schwarzen Feld, einen gelben Schwanenhals und 3 Granat*
äpfel. E. Münch gibt in seinem Franz v. Sickingen die Zeich*
nungen dieses Wappens nach Siegeln und Münzen.) — Sickingen
gegenüber kniet seine Gattin mit dem Rosenkranz in den
Händen. Die acht das Ehepaar umgebenden Wappenschilde
der Stammeltern sind mit ihren heraldischen Emblemen voll
ausgefüllt. In den übrigen Darstellungen wird aus dem Ritter
eine ganz charakterlose, auf einem Schwane reitende Figur,
aus der Gattin ein kuttentragendes Wesen, das eher einem
Mönche als einer Frau gleicht. Die Wappenschilder bleiben
teilweise leer, sie vermindern sich von 8 auf 6.
Der Name des Geschützmeisters ist bei den drei Wolfen*
büttler Zeichnungen stets ebenso wie bei dem Solms’schen
Geschütze Stephan, bei den übrigen Deutschen und der
Pariser Handschrift meist Steffen und seltener Steffan.
Der Sinnspruch ist nirgends deutschfehlerfrei, aber ganz
unverständlich ist er nur in der Pariser Handschrift; hier
bildet er auch vier, statt wie sonst drei Zeilen.
Der Hals der Traube hat bei der Pariser Handschrift längs*
gehende Rillen als Zierrat, sonst ist er überall glatt.
Auf den einzelnen Blättern ist das Kaliber der Rohre durch
einen den Geschoßumfang in natürlicher Größe haltenden
Kreis genau wiedergegeben. Die artilleristisch*technische Be*
wertung derartiger Zeichnungen fordert zu großer Vorsicht auf.
So weisen hier, wenn man die über den Rohren schwebend
gezeichneten Kugeln als Maßeinheiten annimmt, die Rohre der
Nachtigal bei Gotha—17; Paris —18; Frankfurt—18’/s; Wol*
fenbüttel — 2O'/s; Erlangen — 23 Kaliberlängen auf. Die Rohr*
länge ist, hier wie stets, von der Mundfriese bis zur Bodenfriese
ohne Bodenstück und ohne Traube gemessen.
Wie für die „Nachtigal“ ließen sich auch aus den Zeichnungen
der anderen Geschütze die gleichen Folgerungen ziehen, doch
Vorstehendes möge genügen. Zum Schlüsse sei wiederholt: in
der Wolfenbütteier Quelle haben wir den besten Zeugen aus
damaliger Zeit, vielleicht das Original des Geschützbuches zu
erblicken; die Pariser Handschrift aber ist dieses auf keinen Fall.
’*) Solche ausgehöhlte Schildzapfen sind in der deutschen
Feldartillerie, als man Ende des 19. Jahrhunderts die Geschütz*
rohre nach aller Möglichkeit erleichtern wollte, ebenfalls wieder
angewendet worden.