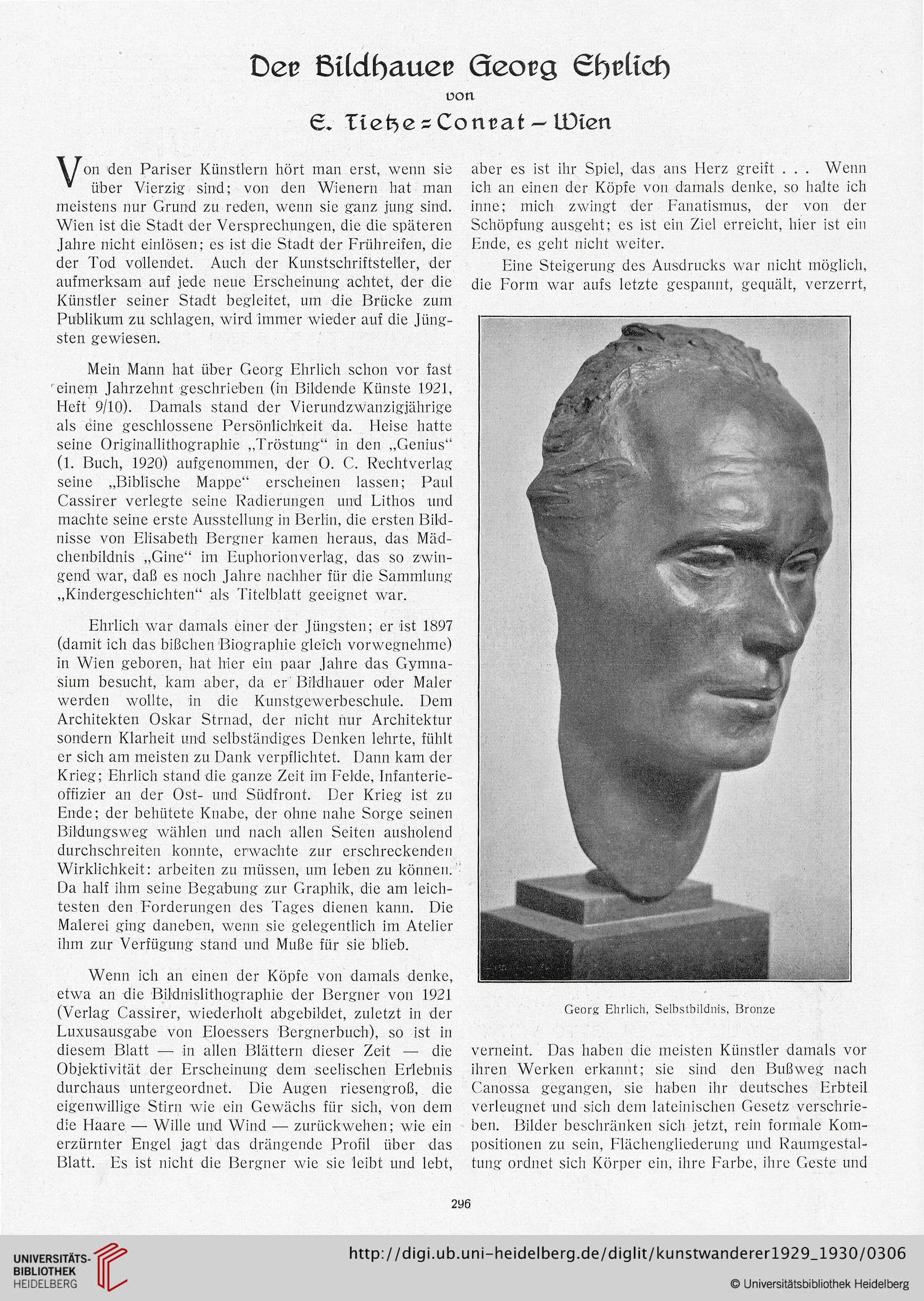Der Bildhauer Qeocg Cbclicf)
üou
6. Tiet^c s Cont’at — IDicn
\ I on den Pariser Künstlern hört man erst, wenn sie
v über Vierzig sind; von den Wienern hat man
meistens nur Grund zu reden, wenn sie ganz jung sind.
Wien ist die Stadt der Versprechungen, die die späteren
Jahre nicht einlösen; es ist die Stadt der Frühreifen, die
der Tod vollendet. Auch der Kunstschriftsteller, der
aufmerksam auf jede neue Erscheinung achtet, der die
Künstler seiner Stadt begleitet, um die Brücke zum
Publikum zu schlagen, wird immer wieder auf die Jüng-
sten gewiesen.
Mein Mann hat über Georg Ehrlich schon vor fast
einem Jahrzehnt geschrieben (in Bildende Künste 1921,
Heft 9/10). Damals stand der Vicrundzwanzigjährige
als eine geschlossene Persönlichkeit da. Heise hatte
seine Originallithographie „Tröstung“ in den „Genius“
(1. Buch, 1920) aufgenommen, der O. C. Rechtverlag
seine „Biblische Mappe“ erscheinen lassen; Paul
Cassirer verlegte seine Radierungen und Lithos und
machte seine erste Ausstellung in Berlin, die ersten Bild-
nisse von Elisabeth Bcrgner kamen heraus, das Mäd-
chenbildnis „Gine“ im Euphorionverlag, das so zwin-
gend war, daß es noch Jahre nachher für die Sammlung
„Kindergeschichten“ als Titelblatt geeignet war.
Ehrlich war damals einer der Jüngsten; er ist 1897
(damit ich das bißchen Biographie gleich vorwegnehme)
in Wien geboren, hat hier ein paar Jahre das Gymna-
sium besucht, kam aber, da er Bildhauer oder Maler
werden wollte, in die Kunstgewerbeschule. Dem
Architekten Oskar Strnacl, der nicht nur Architektur
sondern Klarheit und selbständiges Denken lehrte, fühlt
er sich am meisten zu Dank verpflichtet. Dann kam der
Krieg; Ehrlich stand die ganze Zeit im Felde, Infanterie-
offizier an der Ost- und Südfront. Der Krieg ist zu
Ende; der behütete Knabe, der ohne nahe Sorge seinen
Bildungsweg wählen und nach allen Seiten ausholend
durchschreiten konnte, erwachte zur erschreckenden
Wirklichkeit: arbeiten zu müssen, um leben zu können.
Da half ihm seine Begabung zur Graphik, die am leich-
testen den Forderungen des Tages dienen kann. Die
Malerei ging daneben, wenn sie gelegentlich im Atelier
ihm zur Verfügung stand und Muße für sie blieb.
Wenn ich an einen der Köpfe von damals denke,
etwa an die Bildnislithographie der Bergner von 1921
(Verlag Cassirer, wiederholt abgebildet, zuletzt in der
Luxusausgabe von Eloesscrs Bergnerbuch), so ist in
diesem Blatt — in allen Blättern dieser Zeit — die
Objektivität der Erscheinung dem seelischen Erlebnis
durchaus untergeordnet. Die Augen riesengroß, die
eigenwillige Stirn wie ein Gewächs für sich, von dem
die Haare —- Wille und Wind —- zurückwehen; wie ein
erzürnter Engel jagt das drängende Profil über das
Blatt. Es ist nicht die Bergner wie sie leibt und lebt,
aber es ist ihr Spiel, das ans Herz greift . . . Wenn
ich an einen der Köpfe von damals denke, so halte ich
inne; mich zwingt der Fanatismus, der von der
Schöpfung ausgeht; es ist ein Ziel erreicht, hier ist ein
Ende, es geht nicht weiter.
Eine Steigerung des Ausdrucks war nicht möglich,
die Form war aufs letzte gespannt, gequält, verzerrt,
Georg Ehrlich, Selbstbildnis, Bronze
verneint. Das haben die meisten Künstler damals vor
ihren Werken erkannt; sie sind den Bußweg nach
Canossa gegangen, sie haben ihr deutsches Erbteil
verleugnet und sich dem lateinischen Gesetz verschrie-
ben. Bilder beschränken sich jetzt, rein formale Kom-
positionen zu sein, Flächengliederung und Raumgestal-
tung ordnet sich Körper ein, ihre Farbe, ihre Geste und
296
üou
6. Tiet^c s Cont’at — IDicn
\ I on den Pariser Künstlern hört man erst, wenn sie
v über Vierzig sind; von den Wienern hat man
meistens nur Grund zu reden, wenn sie ganz jung sind.
Wien ist die Stadt der Versprechungen, die die späteren
Jahre nicht einlösen; es ist die Stadt der Frühreifen, die
der Tod vollendet. Auch der Kunstschriftsteller, der
aufmerksam auf jede neue Erscheinung achtet, der die
Künstler seiner Stadt begleitet, um die Brücke zum
Publikum zu schlagen, wird immer wieder auf die Jüng-
sten gewiesen.
Mein Mann hat über Georg Ehrlich schon vor fast
einem Jahrzehnt geschrieben (in Bildende Künste 1921,
Heft 9/10). Damals stand der Vicrundzwanzigjährige
als eine geschlossene Persönlichkeit da. Heise hatte
seine Originallithographie „Tröstung“ in den „Genius“
(1. Buch, 1920) aufgenommen, der O. C. Rechtverlag
seine „Biblische Mappe“ erscheinen lassen; Paul
Cassirer verlegte seine Radierungen und Lithos und
machte seine erste Ausstellung in Berlin, die ersten Bild-
nisse von Elisabeth Bcrgner kamen heraus, das Mäd-
chenbildnis „Gine“ im Euphorionverlag, das so zwin-
gend war, daß es noch Jahre nachher für die Sammlung
„Kindergeschichten“ als Titelblatt geeignet war.
Ehrlich war damals einer der Jüngsten; er ist 1897
(damit ich das bißchen Biographie gleich vorwegnehme)
in Wien geboren, hat hier ein paar Jahre das Gymna-
sium besucht, kam aber, da er Bildhauer oder Maler
werden wollte, in die Kunstgewerbeschule. Dem
Architekten Oskar Strnacl, der nicht nur Architektur
sondern Klarheit und selbständiges Denken lehrte, fühlt
er sich am meisten zu Dank verpflichtet. Dann kam der
Krieg; Ehrlich stand die ganze Zeit im Felde, Infanterie-
offizier an der Ost- und Südfront. Der Krieg ist zu
Ende; der behütete Knabe, der ohne nahe Sorge seinen
Bildungsweg wählen und nach allen Seiten ausholend
durchschreiten konnte, erwachte zur erschreckenden
Wirklichkeit: arbeiten zu müssen, um leben zu können.
Da half ihm seine Begabung zur Graphik, die am leich-
testen den Forderungen des Tages dienen kann. Die
Malerei ging daneben, wenn sie gelegentlich im Atelier
ihm zur Verfügung stand und Muße für sie blieb.
Wenn ich an einen der Köpfe von damals denke,
etwa an die Bildnislithographie der Bergner von 1921
(Verlag Cassirer, wiederholt abgebildet, zuletzt in der
Luxusausgabe von Eloesscrs Bergnerbuch), so ist in
diesem Blatt — in allen Blättern dieser Zeit — die
Objektivität der Erscheinung dem seelischen Erlebnis
durchaus untergeordnet. Die Augen riesengroß, die
eigenwillige Stirn wie ein Gewächs für sich, von dem
die Haare —- Wille und Wind —- zurückwehen; wie ein
erzürnter Engel jagt das drängende Profil über das
Blatt. Es ist nicht die Bergner wie sie leibt und lebt,
aber es ist ihr Spiel, das ans Herz greift . . . Wenn
ich an einen der Köpfe von damals denke, so halte ich
inne; mich zwingt der Fanatismus, der von der
Schöpfung ausgeht; es ist ein Ziel erreicht, hier ist ein
Ende, es geht nicht weiter.
Eine Steigerung des Ausdrucks war nicht möglich,
die Form war aufs letzte gespannt, gequält, verzerrt,
Georg Ehrlich, Selbstbildnis, Bronze
verneint. Das haben die meisten Künstler damals vor
ihren Werken erkannt; sie sind den Bußweg nach
Canossa gegangen, sie haben ihr deutsches Erbteil
verleugnet und sich dem lateinischen Gesetz verschrie-
ben. Bilder beschränken sich jetzt, rein formale Kom-
positionen zu sein, Flächengliederung und Raumgestal-
tung ordnet sich Körper ein, ihre Farbe, ihre Geste und
296