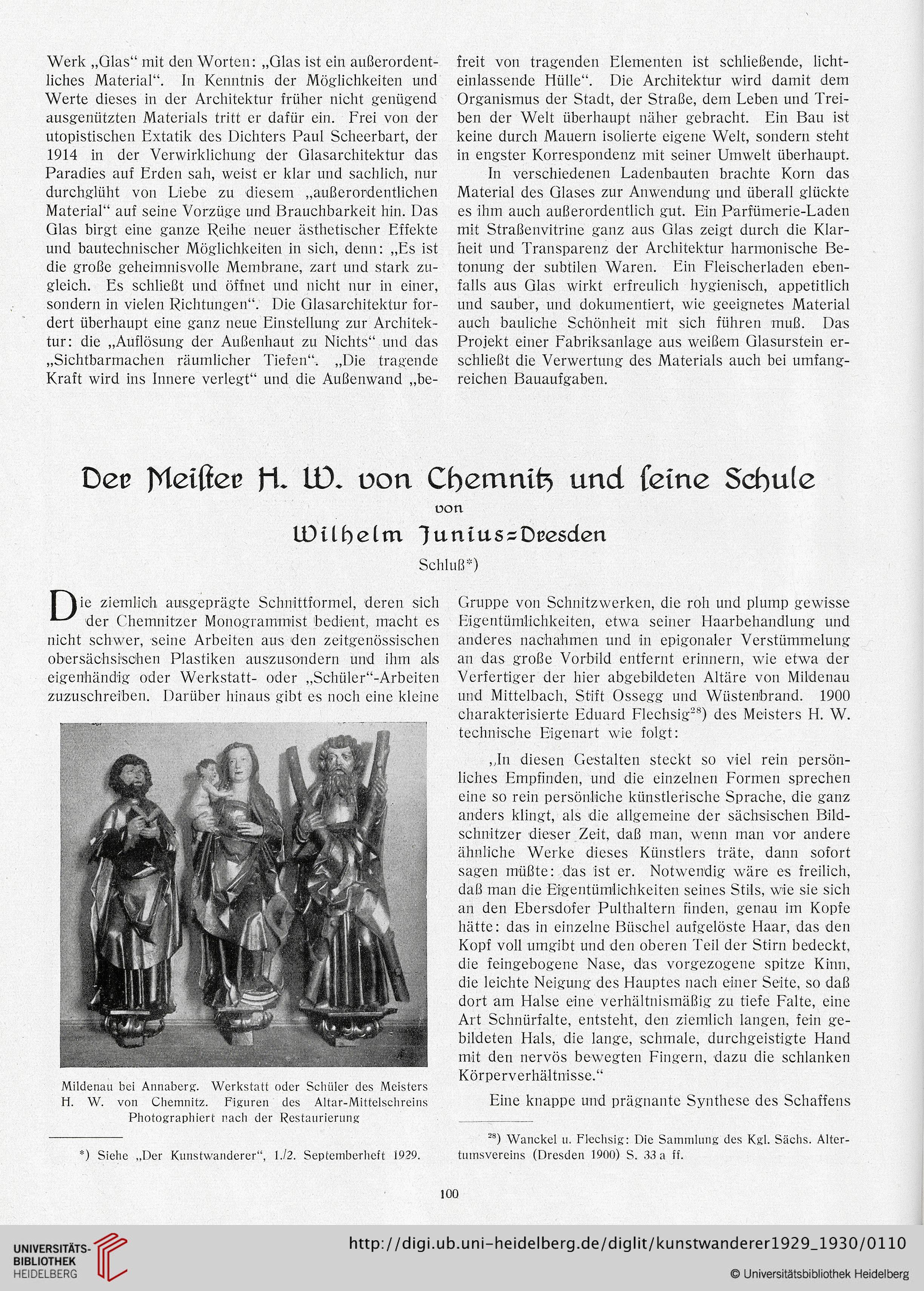Werk „Glas“ mit den Worten: „Glas ist ein außerordent-
liches Material“. In Kenntnis der Möglichkeiten und
Werte dieses in der Architektur früher nicht genügend
ausgenützten Materials tritt er dafür ein. Frei von der
utopistischen Extatik des Dichters Paul Scheerbart, der
1914 in der Verwirklichung der Glasarchitektur das
Paradies auf Erden sah, weist er klar und sachlich, nur
durchglüht von Liebe zu diesem „außerordentlichen
Material“ auf seine Vorzüge und Brauchbarkeit hin. Das
Glas birgt eine ganze Reihe neuer ästhetischer Effekte
und bautechnischer Möglichkeiten in sich, denn: „Es ist
die große geheimnisvolle Membrane, zart und stark zu-
gleich. Es schließt und öffnet und nicht nur in einer,
sondern in vielen Richtungen“. Die Glasarchitektur for-
dert überhaupt eine ganz neue Einstellung zur Architek-
tur: die „Auflösung der Außenhaut zu Nichts“ und das
„Sichtbarmachen räumlicher Tiefen“. „Die tragende
Kraft wird ins Innere verlegt“ und die Außenwand „be-
freit von tragenden Elementen ist schließende, licht-
einlassende Hülle“. Die Architektur wird damit dem
Organismus der Stadt, der Straße, dem Leben und Trei-
ben der Welt überhaupt näher gebracht. Ein Bau ist
keine durch Mauern isolierte eigene Welt, sondern steht
in engster Korrespondenz mit seiner Umwelt überhaupt.
In verschiedenen Ladenbauten brachte Korn das
Material des Glases zur Anwendung und überall glückte
es ihm auch außerordentlich gut. Ein Parfümerie-Laden
mit Straßenvitrine ganz aus Glas zeigt durch die Klar-
heit und Transparenz der Architektur harmonische Be-
tonung der subtilen Waren. Ein Fleischerladen eben-
falls aus Glas wirkt erfreulich hygienisch, appetitlich
und sauber, und dokumentiert, wie geeignetes Material
auch bauliche Schönheit mit sich führen muß. Das
Projekt einer Fabriksanlage aus weißem Glasurstein er-
schließt die Verwertung des Materials auch bei umfang-
reichen Bauaufgaben.
Der Meiftßc H- ID. oon CbernniK und feine Schute
oon
IDUbeltn lutrittszDresden
Schluß*)
jie ziemlich ausgeprägte Schnittformel, deren sich
^ der Chemnitzer Monogrammist bedient, macht es
nicht schwer, seine Arbeiten aus den zeitgenössischen
obersächsi'schen Plastiken auszusondern und ihm als
eigenhändig oder Werkstatt- oder „Schüler“-Arbeiten
zuzuschreiben. Darüber hinaus gibt es noch eine kleine
Mildenau bei Annaberg. Werkstatt oder Schüler des Meisters
H. W. von Chemnitz. Figuren des Altar-Mittelschreins
Photographiert nach der Restaurierung
*) Siehe „Der Kunstwanderer“, 1.12. Septemberheft 1929.
Gruppe von Schnitzwerken, die roh und plump gewisse
Eigentümlichkeiten, etwa seiner Haarbehandlung und
anderes nachahmen und in epigonaler Verstümmelung
an das große Vorbild entfernt erinnern, wie etwa der
Verfertiger der hier abgebildeten Altäre von Mildenau
und Mittelbach, Stift Ossegg und Wüsterfbrand. 1900
charakterisierte Eduard Flechsig28) des Meisters H. W.
technische Eigenart wie folgt:
„In diesen Gestalten steckt so viel rein persön-
liches Empfinden, und die einzelnen Formen sprechen
eine so rein persönliche künstlerische Sprache, die ganz
anders klingt, als die allgemeine der sächsischen Bild-
schnitzer dieser Zeit, daß man, wenn man vor andere
ähnliche Werke dieses Künstlers träte, dann sofort
sagen müßte: das ist er. Notwendig wäre es freilich,
daß man die Eigentümlichkeiten seines Stils, wie sie sich
an den Ebersdofer Pulthaltern finden, genau im Kopfe
hätte: das in einzelne Büschel aufgelöste Haar, das den
Kopf voll umgibt und den oberen Teil der Stirn bedeckt,
die feingebogene Nase, das vorgezogene spitze Kinn,
die leichte Neigung des Hauptes nach einer Seite, so daß
dort am Halse eine verhältnismäßig zu tiefe Falte, eine
Art Schnürfalte, entsteht, den ziemlich langen, fein ge-
bildeten Hals, die lange, schmale, durchgeistigte Hand
mit den nervös bewegten Fingern, dazu die schlanken
Körperverhältnisse.“
Eine knappe und prägnante Synthese des Schaffens
28) Wanckel u. Flechsig: Die Sammlung des Kgl. Sächs. Alter-
tumsvereins (Dresden 1900) S. 33 a ff.
100
liches Material“. In Kenntnis der Möglichkeiten und
Werte dieses in der Architektur früher nicht genügend
ausgenützten Materials tritt er dafür ein. Frei von der
utopistischen Extatik des Dichters Paul Scheerbart, der
1914 in der Verwirklichung der Glasarchitektur das
Paradies auf Erden sah, weist er klar und sachlich, nur
durchglüht von Liebe zu diesem „außerordentlichen
Material“ auf seine Vorzüge und Brauchbarkeit hin. Das
Glas birgt eine ganze Reihe neuer ästhetischer Effekte
und bautechnischer Möglichkeiten in sich, denn: „Es ist
die große geheimnisvolle Membrane, zart und stark zu-
gleich. Es schließt und öffnet und nicht nur in einer,
sondern in vielen Richtungen“. Die Glasarchitektur for-
dert überhaupt eine ganz neue Einstellung zur Architek-
tur: die „Auflösung der Außenhaut zu Nichts“ und das
„Sichtbarmachen räumlicher Tiefen“. „Die tragende
Kraft wird ins Innere verlegt“ und die Außenwand „be-
freit von tragenden Elementen ist schließende, licht-
einlassende Hülle“. Die Architektur wird damit dem
Organismus der Stadt, der Straße, dem Leben und Trei-
ben der Welt überhaupt näher gebracht. Ein Bau ist
keine durch Mauern isolierte eigene Welt, sondern steht
in engster Korrespondenz mit seiner Umwelt überhaupt.
In verschiedenen Ladenbauten brachte Korn das
Material des Glases zur Anwendung und überall glückte
es ihm auch außerordentlich gut. Ein Parfümerie-Laden
mit Straßenvitrine ganz aus Glas zeigt durch die Klar-
heit und Transparenz der Architektur harmonische Be-
tonung der subtilen Waren. Ein Fleischerladen eben-
falls aus Glas wirkt erfreulich hygienisch, appetitlich
und sauber, und dokumentiert, wie geeignetes Material
auch bauliche Schönheit mit sich führen muß. Das
Projekt einer Fabriksanlage aus weißem Glasurstein er-
schließt die Verwertung des Materials auch bei umfang-
reichen Bauaufgaben.
Der Meiftßc H- ID. oon CbernniK und feine Schute
oon
IDUbeltn lutrittszDresden
Schluß*)
jie ziemlich ausgeprägte Schnittformel, deren sich
^ der Chemnitzer Monogrammist bedient, macht es
nicht schwer, seine Arbeiten aus den zeitgenössischen
obersächsi'schen Plastiken auszusondern und ihm als
eigenhändig oder Werkstatt- oder „Schüler“-Arbeiten
zuzuschreiben. Darüber hinaus gibt es noch eine kleine
Mildenau bei Annaberg. Werkstatt oder Schüler des Meisters
H. W. von Chemnitz. Figuren des Altar-Mittelschreins
Photographiert nach der Restaurierung
*) Siehe „Der Kunstwanderer“, 1.12. Septemberheft 1929.
Gruppe von Schnitzwerken, die roh und plump gewisse
Eigentümlichkeiten, etwa seiner Haarbehandlung und
anderes nachahmen und in epigonaler Verstümmelung
an das große Vorbild entfernt erinnern, wie etwa der
Verfertiger der hier abgebildeten Altäre von Mildenau
und Mittelbach, Stift Ossegg und Wüsterfbrand. 1900
charakterisierte Eduard Flechsig28) des Meisters H. W.
technische Eigenart wie folgt:
„In diesen Gestalten steckt so viel rein persön-
liches Empfinden, und die einzelnen Formen sprechen
eine so rein persönliche künstlerische Sprache, die ganz
anders klingt, als die allgemeine der sächsischen Bild-
schnitzer dieser Zeit, daß man, wenn man vor andere
ähnliche Werke dieses Künstlers träte, dann sofort
sagen müßte: das ist er. Notwendig wäre es freilich,
daß man die Eigentümlichkeiten seines Stils, wie sie sich
an den Ebersdofer Pulthaltern finden, genau im Kopfe
hätte: das in einzelne Büschel aufgelöste Haar, das den
Kopf voll umgibt und den oberen Teil der Stirn bedeckt,
die feingebogene Nase, das vorgezogene spitze Kinn,
die leichte Neigung des Hauptes nach einer Seite, so daß
dort am Halse eine verhältnismäßig zu tiefe Falte, eine
Art Schnürfalte, entsteht, den ziemlich langen, fein ge-
bildeten Hals, die lange, schmale, durchgeistigte Hand
mit den nervös bewegten Fingern, dazu die schlanken
Körperverhältnisse.“
Eine knappe und prägnante Synthese des Schaffens
28) Wanckel u. Flechsig: Die Sammlung des Kgl. Sächs. Alter-
tumsvereins (Dresden 1900) S. 33 a ff.
100