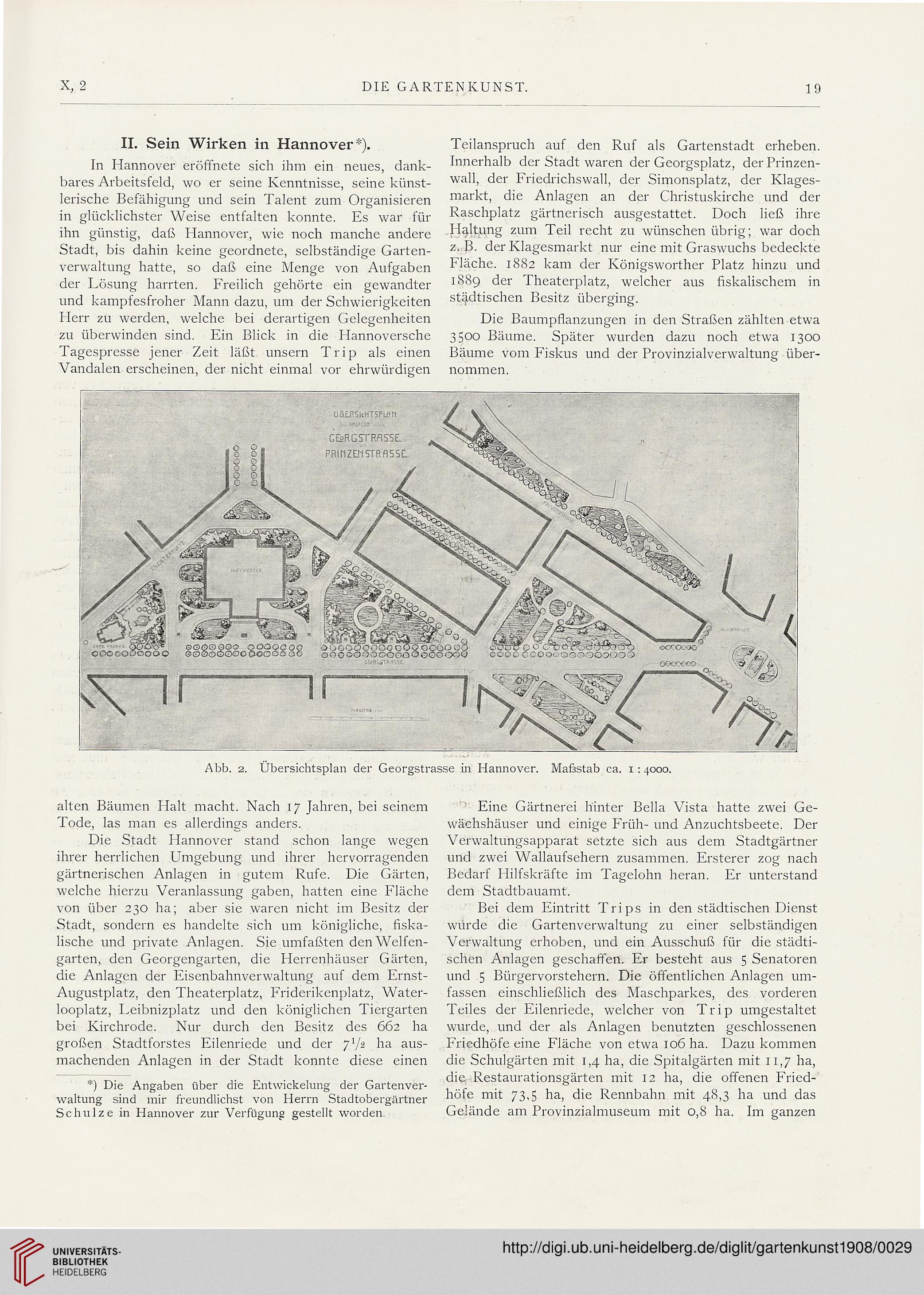X, 2
DIE GARTENKUNST.
19
II. Sein Wirken in Hannover*).
In Hannover eröffnete sich ihm ein neues, dank-
bares Arbeitsfeld, wo er seine Kenntnisse, seine künst-
lerische Befähigung und sein Talent zum Organisieren
in glücklichster Weise entfalten konnte. Es war für
ihn günstig, daß Hannover, wie noch manche andere
Stadt, bis dahin keine geordnete, selbständige Garten-
verwaltung hatte, so daß eine Menge von Aufgaben
der Lösung harrten. Freilich gehörte ein gewandter
und kampfesfroher Mann dazu, um der Schwierigkeiten
Herr zu werden, welche bei derartigen Gelegenheiten
zu überwinden sind. Ein Blick in die Hannoversche
Tagespresse jener Zeit läßt unsern Trip als einen
Vandalen erscheinen, der nicht einmal vor ehrwürdigen
Teilanspruch auf den Ruf als Gartenstadt erheben.
Innerhalb der Stadt waren der Georgsplatz, der Prinzen-
wall, der Friedrichswall, der Simonsplatz, der Klages-
markt, die Anlagen an der Christuskirche und der
Raschplatz gärtnerisch ausgestattet. Doch ließ ihre
Haltung zum Teil recht zu wünschen übrig; war doch
z. B. der Klagesmarkt nur eine mit Graswuchs bedeckte
Fläche. 1882 kam der Königsworther Platz hinzu und
1889 der Theaterplatz, welcher aus fiskalischem in
städtischen Besitz überging.
Die Baumpflanzungen in den Straßen zählten etwa
3500 Bäume. Später wurden dazu noch etwa 1300
Bäume vom Fiskus und der Provinzialverwaltung über-
nommen.
Abb. 2. Übersichtsplan der Georgstrasse in Hannover. Maßstab ca. 1:4000.
alten Bäumen Halt macht. Nach 17 Jahren, bei seinem
Tode, las man es allerdings anders.
Die Stadt Hannover stand schon lange wegen
ihrer herrlichen Umgebung und ihrer hervorragenden
gärtnerischen Anlagen in gutem Rufe. Die Gärten,
welche hierzu Veranlassung gaben, hatten eine Fläche
von über 230 ha; aber sie waren nicht im Besitz der
Stadt, sondern es handelte sich um königliche, fiska-
lische und private Anlagen. Sie umfaßten den Weifen-
garten, den Georgengarten, die Herrenhäuser Gärten,
die Anlagen der Eisenbahnverwaltung auf dem Ernst-
Augustplatz, den Theaterplatz, Friderikenplatz, Water-
looplatz, Leibnizplatz und den königlichen Tiergarten
bei Kirchrode. Nur durch den Besitz des 662 ha
großen Stadtforstes Eilenriede und der 71/2 ha aus-
machenden Anlagen in der Stadt konnte diese einen
*) Die Angaben über die Entwickelung der Gartenver-
waltung sind mir freundlichst von Herrn Stadtobergärtner
Schulze in Hannover zur Verfügung gestellt worden.
Eine Gärtnerei hinter Bella Vista hatte zwei Ge-
wächshäuser und einige Früh- und Anzuchtsbeete. Der
Verwaltungsapparat setzte sich aus dem Stadtgärtner
und zwei Wallaufsehern zusammen. Ersterer zog nach
Bedarf Hilfskräfte im Tagelohn heran. Er unterstand
dem Stadtbauamt.
Bei dem Eintritt Trips in den städtischen Dienst
würde die Gartenverwaltung zu einer selbständigen
Verwaltung erhoben, und ein Ausschuß für die städti-
schen Anlagen geschaffen. Er besteht aus 5 Senatoren
und 5 Bürgervorstehern. Die öffentlichen Anlagen um-
fassen einschließlich des Maschparkes, des vorderen
Teiles der Eilenriede, welcher von Trip umgestaltet
wurde, und der als Anlagen benutzten geschlossenen
Friedhöfe eine Fläche von etwa 106 ha. Dazu kommen
die Schulgärten mit 1,4 ha, die Spitalgärten mit 11,7 ha,
die Restaurationsgärten mit 12 ha, die offenen Fried-
höfe mit 73,5 ha, die Rennbahn mit 48,3 ha und das
Gelände am Provinzialmuseum mit 0,8 ha. Im ganzen
DIE GARTENKUNST.
19
II. Sein Wirken in Hannover*).
In Hannover eröffnete sich ihm ein neues, dank-
bares Arbeitsfeld, wo er seine Kenntnisse, seine künst-
lerische Befähigung und sein Talent zum Organisieren
in glücklichster Weise entfalten konnte. Es war für
ihn günstig, daß Hannover, wie noch manche andere
Stadt, bis dahin keine geordnete, selbständige Garten-
verwaltung hatte, so daß eine Menge von Aufgaben
der Lösung harrten. Freilich gehörte ein gewandter
und kampfesfroher Mann dazu, um der Schwierigkeiten
Herr zu werden, welche bei derartigen Gelegenheiten
zu überwinden sind. Ein Blick in die Hannoversche
Tagespresse jener Zeit läßt unsern Trip als einen
Vandalen erscheinen, der nicht einmal vor ehrwürdigen
Teilanspruch auf den Ruf als Gartenstadt erheben.
Innerhalb der Stadt waren der Georgsplatz, der Prinzen-
wall, der Friedrichswall, der Simonsplatz, der Klages-
markt, die Anlagen an der Christuskirche und der
Raschplatz gärtnerisch ausgestattet. Doch ließ ihre
Haltung zum Teil recht zu wünschen übrig; war doch
z. B. der Klagesmarkt nur eine mit Graswuchs bedeckte
Fläche. 1882 kam der Königsworther Platz hinzu und
1889 der Theaterplatz, welcher aus fiskalischem in
städtischen Besitz überging.
Die Baumpflanzungen in den Straßen zählten etwa
3500 Bäume. Später wurden dazu noch etwa 1300
Bäume vom Fiskus und der Provinzialverwaltung über-
nommen.
Abb. 2. Übersichtsplan der Georgstrasse in Hannover. Maßstab ca. 1:4000.
alten Bäumen Halt macht. Nach 17 Jahren, bei seinem
Tode, las man es allerdings anders.
Die Stadt Hannover stand schon lange wegen
ihrer herrlichen Umgebung und ihrer hervorragenden
gärtnerischen Anlagen in gutem Rufe. Die Gärten,
welche hierzu Veranlassung gaben, hatten eine Fläche
von über 230 ha; aber sie waren nicht im Besitz der
Stadt, sondern es handelte sich um königliche, fiska-
lische und private Anlagen. Sie umfaßten den Weifen-
garten, den Georgengarten, die Herrenhäuser Gärten,
die Anlagen der Eisenbahnverwaltung auf dem Ernst-
Augustplatz, den Theaterplatz, Friderikenplatz, Water-
looplatz, Leibnizplatz und den königlichen Tiergarten
bei Kirchrode. Nur durch den Besitz des 662 ha
großen Stadtforstes Eilenriede und der 71/2 ha aus-
machenden Anlagen in der Stadt konnte diese einen
*) Die Angaben über die Entwickelung der Gartenver-
waltung sind mir freundlichst von Herrn Stadtobergärtner
Schulze in Hannover zur Verfügung gestellt worden.
Eine Gärtnerei hinter Bella Vista hatte zwei Ge-
wächshäuser und einige Früh- und Anzuchtsbeete. Der
Verwaltungsapparat setzte sich aus dem Stadtgärtner
und zwei Wallaufsehern zusammen. Ersterer zog nach
Bedarf Hilfskräfte im Tagelohn heran. Er unterstand
dem Stadtbauamt.
Bei dem Eintritt Trips in den städtischen Dienst
würde die Gartenverwaltung zu einer selbständigen
Verwaltung erhoben, und ein Ausschuß für die städti-
schen Anlagen geschaffen. Er besteht aus 5 Senatoren
und 5 Bürgervorstehern. Die öffentlichen Anlagen um-
fassen einschließlich des Maschparkes, des vorderen
Teiles der Eilenriede, welcher von Trip umgestaltet
wurde, und der als Anlagen benutzten geschlossenen
Friedhöfe eine Fläche von etwa 106 ha. Dazu kommen
die Schulgärten mit 1,4 ha, die Spitalgärten mit 11,7 ha,
die Restaurationsgärten mit 12 ha, die offenen Fried-
höfe mit 73,5 ha, die Rennbahn mit 48,3 ha und das
Gelände am Provinzialmuseum mit 0,8 ha. Im ganzen