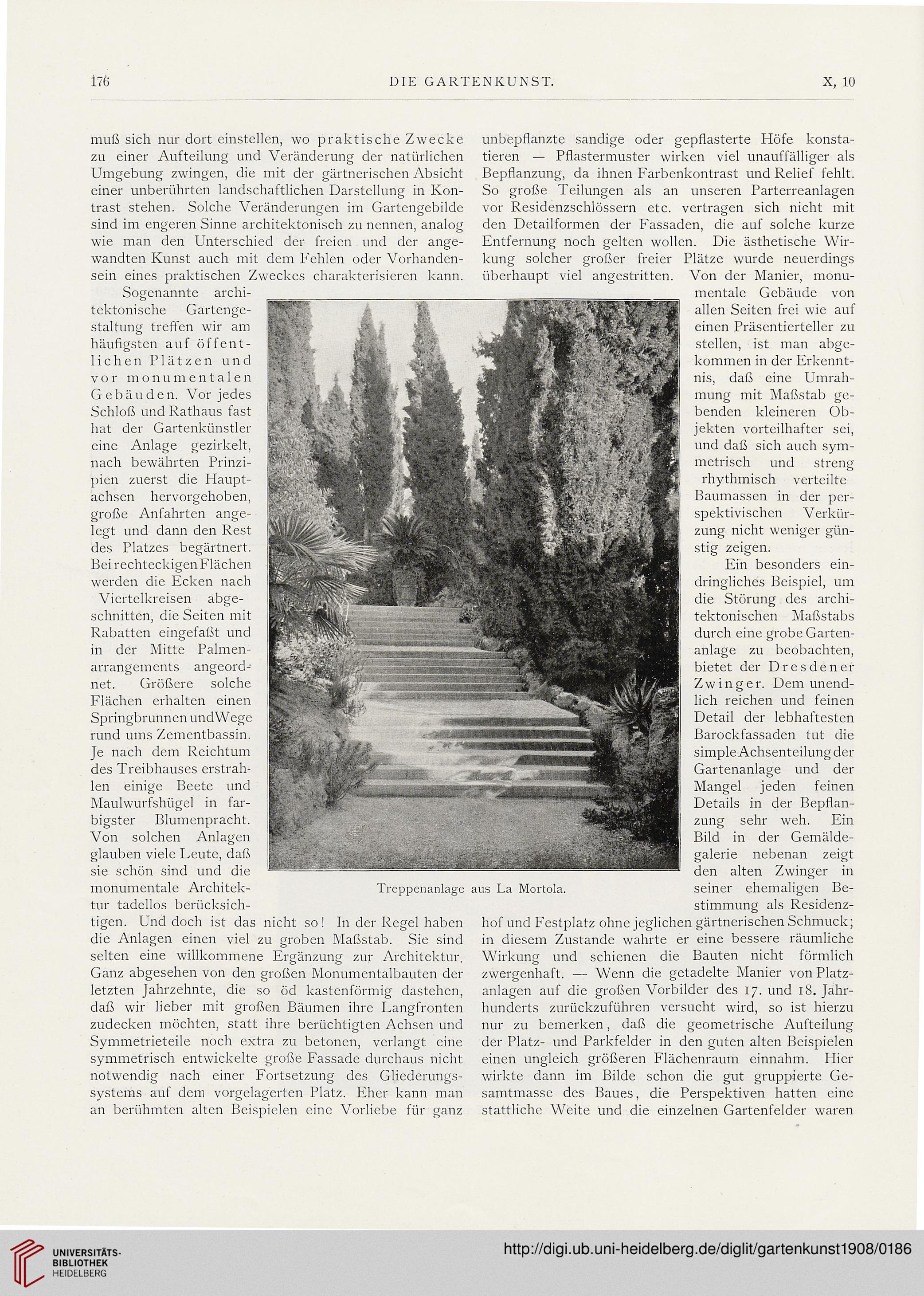176
DIE GARTENKUNST.
X, 10
muß sich nur dort einstellen, wo praktische Zwecke
zu einer Aufteilung und Veränderung der natürlichen
Umgebung zwingen, die mit der gärtnerischen Absicht
einer unberührten landschaftlichen Darstellung in Kon-
trast stehen. Solche Veränderungen im Gartengebilde
sind im engeren Sinne architektonisch zu nennen, analog
wie man den Unterschied der freien und der ange-
wandten Kunst auch mit dem Fehlen oder Vorhanden-
sein eines praktischen Zweckes charakterisieren kann.
Sogenannte archi-
tektonische Gartenge-
staltung treffen wir am
häufigsten auf öffent-
lichen Plätzen und
vor monumentalen
Gebäuden. Vor jedes
Schloß und Rathaus fast
hat der Gartenkünstler
eine Anlage gezirkelt,
nach bewährten Prinzi-
pien zuerst die Haupt-
achsen hervorgehoben,
große Anfahrten ange-
legt und dann den Rest
des Platzes begärtnert.
Bei rechteckigen Flächen
werden die Ecken nach
Viertelkreisen abge-
schnitten, die Seiten mit
Rabatten eingefaßt und
in der Mitte Palmen-
arrangements angeord-
net. Größere solche
Flächen erhalten einen
Springbrunnen und Wege
rund ums Zementbassin.
Je nach dem Reichtum
des Treibhauses erstrah-
len einige Beete und
Maulwurfshügel in far-
bigster Blumenpracht.
Von solchen Anlagen
glauben viele Leute, daß
sie schön sind und die
monumentale Architek-
tur tadellos berücksich-
tigen. Und doch ist das nicht so! In der Regel haben
die Anlagen einen viel zu groben Maßstab. Sie sind
selten eine willkommene Ergänzung zur Architektur.
Ganz abgesehen von den großen Monumentalbauten der
letzten Jahrzehnte, die so öd kastenförmig dastehen,
daß wir lieber mit großen Bäumen ihre Langfronten
zudecken möchten, statt ihre berüchtigten Achsen und
Symmetrieteile noch extra zu betonen, verlangt eine
symmetrisch entwickelte große Fassade durchaus nicht
notwendig nach einer Fortsetzung des Gliederungs-
systems auf dem vorgelagerten Platz. Eher kann man
an berühmten alten Beispielen eine Vorliebe für ganz
unbepflanzte sandige oder gepflasterte Höfe konsta-
tieren — Pflastermuster wirken viel unauffälliger als
Bepflanzung, da ihnen Farbenkontrast und Relief fehlt.
So große Teilungen als an unseren Parterreanlagen
vor Residenzschlössern etc. vertragen sich nicht mit
den Detailformen der Fassaden, die auf solche kurze
Entfernung noch gelten wollen. Die ästhetische Wir-
kung solcher großer freier Plätze wurde neuerdings
überhaupt viel angestritten. Von der Manier, monu-
mentale Gebäude von
allen Seiten frei wie auf
einen Präsentierteller zu
stellen, ist man abge-
kommen in der Erkennt-
nis, daß eine Umrah-
mung mit Maßstab ge-
benden kleineren Ob-
jekten vorteilhafter sei,
und daß sich auch sym-
metrisch und streng
rhythmisch verteilte
Baumassen in der per-
spektivischen Verkür-
zung nicht weniger gün-
stig zeigen.
Ein besonders ein-
dringliches Beispiel, um
die Störung des archi-
tektonischen Maßstabs
durch eine grobe Garten-
anlage zu beobachten,
bietet der Dresdener
Zwinger. Dem unend-
lich reichen und feinen
Detail der lebhaftesten
Barockfassaden tut die
simple Achsenteilung der
Gartenanlage und der
Mangel jeden feinen
Details in der Bepflan-
zung sehr weh. Ein
Bild in der Gemälde-
galerie nebenan zeigt
den alten Zwinger in
seiner ehemaligen Be-
stimmung als Residenz-
hof und Festplatz ohne jeglichen gärtnerischen Schmuck;
in diesem Zustande wahrte er eine bessere räumliche
Wirkung und schienen die Bauten nicht förmlich
zwergenhaft. — Wenn die getadelte Manier von Platz-
anlagen auf die großen Vorbilder des 17. und 18. Jahr-
hunderts zurückzuführen versucht wird, so ist hierzu
nur zu bemerken, daß die geometrische Aufteilung
der Platz- und Parkfelder in den guten alten Beispielen
einen ungleich größeren Flächenraum einnahm. Hier
wirkte dann im Bilde schon die gut gruppierte Ge-
samtmasse des Baues, die Perspektiven hatten eine
stattliche Weite und die einzelnen Gartenfelder waren
Treppenanlage aus La Mortola.
DIE GARTENKUNST.
X, 10
muß sich nur dort einstellen, wo praktische Zwecke
zu einer Aufteilung und Veränderung der natürlichen
Umgebung zwingen, die mit der gärtnerischen Absicht
einer unberührten landschaftlichen Darstellung in Kon-
trast stehen. Solche Veränderungen im Gartengebilde
sind im engeren Sinne architektonisch zu nennen, analog
wie man den Unterschied der freien und der ange-
wandten Kunst auch mit dem Fehlen oder Vorhanden-
sein eines praktischen Zweckes charakterisieren kann.
Sogenannte archi-
tektonische Gartenge-
staltung treffen wir am
häufigsten auf öffent-
lichen Plätzen und
vor monumentalen
Gebäuden. Vor jedes
Schloß und Rathaus fast
hat der Gartenkünstler
eine Anlage gezirkelt,
nach bewährten Prinzi-
pien zuerst die Haupt-
achsen hervorgehoben,
große Anfahrten ange-
legt und dann den Rest
des Platzes begärtnert.
Bei rechteckigen Flächen
werden die Ecken nach
Viertelkreisen abge-
schnitten, die Seiten mit
Rabatten eingefaßt und
in der Mitte Palmen-
arrangements angeord-
net. Größere solche
Flächen erhalten einen
Springbrunnen und Wege
rund ums Zementbassin.
Je nach dem Reichtum
des Treibhauses erstrah-
len einige Beete und
Maulwurfshügel in far-
bigster Blumenpracht.
Von solchen Anlagen
glauben viele Leute, daß
sie schön sind und die
monumentale Architek-
tur tadellos berücksich-
tigen. Und doch ist das nicht so! In der Regel haben
die Anlagen einen viel zu groben Maßstab. Sie sind
selten eine willkommene Ergänzung zur Architektur.
Ganz abgesehen von den großen Monumentalbauten der
letzten Jahrzehnte, die so öd kastenförmig dastehen,
daß wir lieber mit großen Bäumen ihre Langfronten
zudecken möchten, statt ihre berüchtigten Achsen und
Symmetrieteile noch extra zu betonen, verlangt eine
symmetrisch entwickelte große Fassade durchaus nicht
notwendig nach einer Fortsetzung des Gliederungs-
systems auf dem vorgelagerten Platz. Eher kann man
an berühmten alten Beispielen eine Vorliebe für ganz
unbepflanzte sandige oder gepflasterte Höfe konsta-
tieren — Pflastermuster wirken viel unauffälliger als
Bepflanzung, da ihnen Farbenkontrast und Relief fehlt.
So große Teilungen als an unseren Parterreanlagen
vor Residenzschlössern etc. vertragen sich nicht mit
den Detailformen der Fassaden, die auf solche kurze
Entfernung noch gelten wollen. Die ästhetische Wir-
kung solcher großer freier Plätze wurde neuerdings
überhaupt viel angestritten. Von der Manier, monu-
mentale Gebäude von
allen Seiten frei wie auf
einen Präsentierteller zu
stellen, ist man abge-
kommen in der Erkennt-
nis, daß eine Umrah-
mung mit Maßstab ge-
benden kleineren Ob-
jekten vorteilhafter sei,
und daß sich auch sym-
metrisch und streng
rhythmisch verteilte
Baumassen in der per-
spektivischen Verkür-
zung nicht weniger gün-
stig zeigen.
Ein besonders ein-
dringliches Beispiel, um
die Störung des archi-
tektonischen Maßstabs
durch eine grobe Garten-
anlage zu beobachten,
bietet der Dresdener
Zwinger. Dem unend-
lich reichen und feinen
Detail der lebhaftesten
Barockfassaden tut die
simple Achsenteilung der
Gartenanlage und der
Mangel jeden feinen
Details in der Bepflan-
zung sehr weh. Ein
Bild in der Gemälde-
galerie nebenan zeigt
den alten Zwinger in
seiner ehemaligen Be-
stimmung als Residenz-
hof und Festplatz ohne jeglichen gärtnerischen Schmuck;
in diesem Zustande wahrte er eine bessere räumliche
Wirkung und schienen die Bauten nicht förmlich
zwergenhaft. — Wenn die getadelte Manier von Platz-
anlagen auf die großen Vorbilder des 17. und 18. Jahr-
hunderts zurückzuführen versucht wird, so ist hierzu
nur zu bemerken, daß die geometrische Aufteilung
der Platz- und Parkfelder in den guten alten Beispielen
einen ungleich größeren Flächenraum einnahm. Hier
wirkte dann im Bilde schon die gut gruppierte Ge-
samtmasse des Baues, die Perspektiven hatten eine
stattliche Weite und die einzelnen Gartenfelder waren
Treppenanlage aus La Mortola.