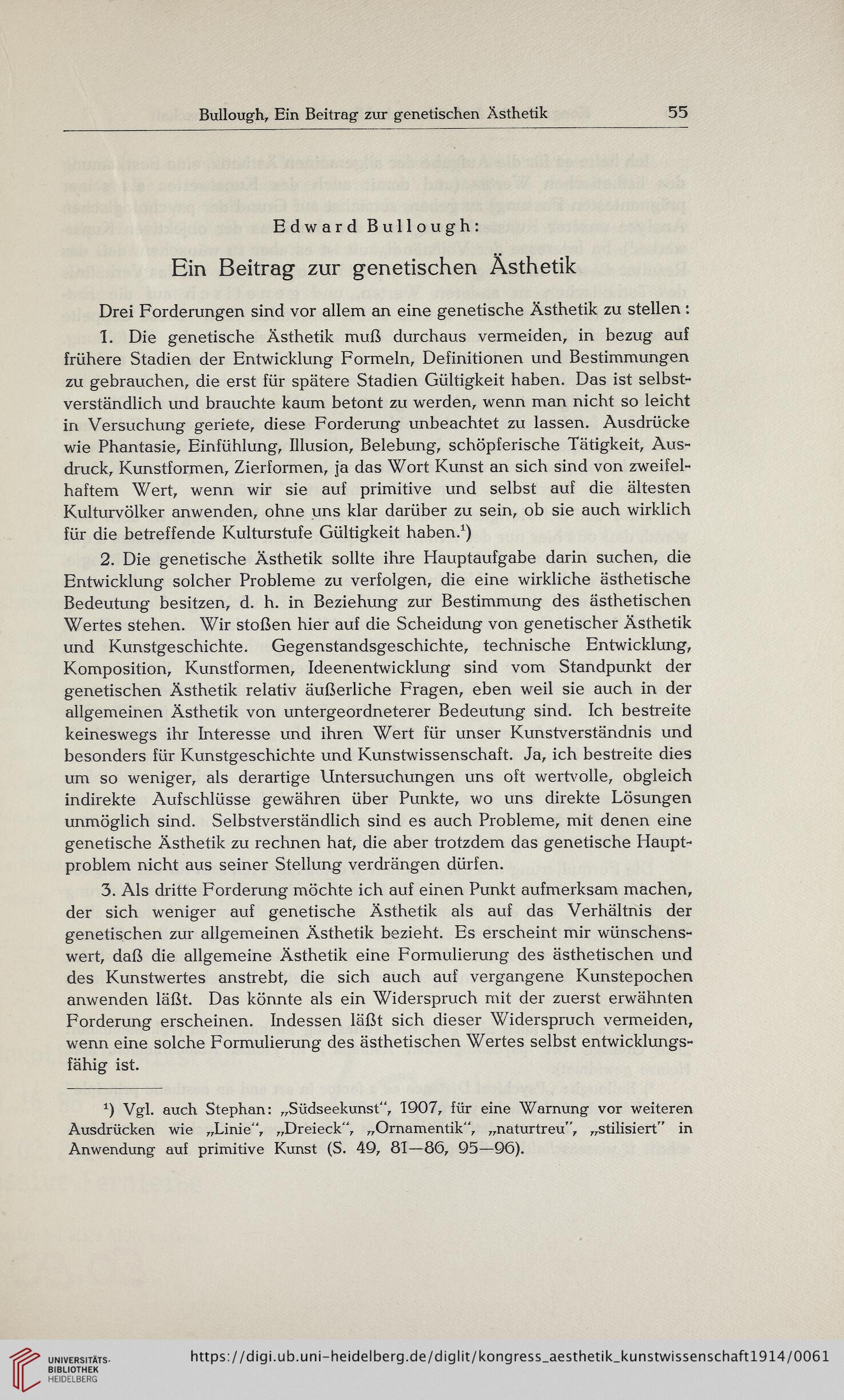Bullough, Ein Beitrag zur genetischen Ästhetik
55
Edward Bullough:
Ein Beitrag zur genetischen Ästhetik
Drei Forderungen sind vor allem an eine genetische Ästhetik zu stellen:
1. Die genetische Ästhetik muß durchaus vermeiden, in bezug auf
frühere Stadien der Entwicklung Formeln, Definitionen und Bestimmungen
zu gebrauchen, die erst für spätere Stadien Gültigkeit haben. Das ist selbst-
verständlich und brauchte kaum betont zu werden, wenn man nicht so leicht
in Versuchung geriete, diese Forderung unbeachtet zu lassen. Ausdrücke
wie Phantasie, Einfühlung, Illusion, Belebung, schöpferische Tätigkeit, Aus-
druck, Kunstformen, Zierformen, ja das Wort Kunst an sich sind von zweifel-
haftem Wert, wenn wir sie auf primitive und selbst auf die ältesten
Kulturvölker anwenden, ohne uns klar darüber zu sein, ob sie auch wirklich
für die betreffende Kulturstufe Gültigkeit haben.1)
2. Die genetische Ästhetik sollte ihre Hauptaufgabe darin suchen, die
Entwicklung solcher Probleme zu verfolgen, die eine wirkliche ästhetische
Bedeutung besitzen, d. h. in Beziehung zur Bestimmung des ästhetischen
Wertes stehen. Wir stoßen hier auf die Scheidung von genetischer Ästhetik
und Kunstgeschichte. Gegenstandsgeschichte, technische Entwicklung,
Komposition, Kunstformen, Ideenentwicklung sind vom Standpunkt der
genetischen Ästhetik relativ äußerliche Fragen, eben weil sie auch in der
allgemeinen Ästhetik von untergeordneterer Bedeutung sind. Ich bestreite
keineswegs ihr Interesse und ihren Wert für unser Kunstverständnis und
besonders für Kunstgeschichte und Kunstwissenschaft. Ja, ich bestreite dies
um so weniger, als derartige Untersuchungen uns oft wertvolle, obgleich
indirekte Aufschlüsse gewähren über Punkte, wo uns direkte Lösungen
unmöglich sind. Selbstverständlich sind es auch Probleme, mit denen eine
genetische Ästhetik zu rechnen hat, die aber trotzdem das genetische Haupt-
problem nicht aus seiner Stellung verdrängen dürfen.
3. Als dritte Forderung möchte ich auf einen Punkt aufmerksam machen,
der sich weniger auf genetische Ästhetik als auf das Verhältnis der
genetischen zur allgemeinen Ästhetik bezieht. Es erscheint mir wünschens-
wert, daß die allgemeine Ästhetik eine Formulierung des ästhetischen und
des Kunstwertes anstrebt, die sich auch auf vergangene Kunstepochen
anwenden läßt. Das könnte als ein Widerspruch mit der zuerst erwähnten
Forderung erscheinen. Indessen läßt sich dieser Widerspruch vermeiden,
wenn eine solche Formulierung des ästhetischen Wertes selbst entwicklungs-
fähig ist.
1) Vgl. auch Stephan: „Südseekunst“, 1907, für eine Warnung vor weiteren
Ausdrücken wie „Linie“, „Dreieck“, „Ornamentik“, „naturtreu”, „stilisiert” in
Anwendung auf primitive Kunst (S. 49, 81—86, 95—96).
55
Edward Bullough:
Ein Beitrag zur genetischen Ästhetik
Drei Forderungen sind vor allem an eine genetische Ästhetik zu stellen:
1. Die genetische Ästhetik muß durchaus vermeiden, in bezug auf
frühere Stadien der Entwicklung Formeln, Definitionen und Bestimmungen
zu gebrauchen, die erst für spätere Stadien Gültigkeit haben. Das ist selbst-
verständlich und brauchte kaum betont zu werden, wenn man nicht so leicht
in Versuchung geriete, diese Forderung unbeachtet zu lassen. Ausdrücke
wie Phantasie, Einfühlung, Illusion, Belebung, schöpferische Tätigkeit, Aus-
druck, Kunstformen, Zierformen, ja das Wort Kunst an sich sind von zweifel-
haftem Wert, wenn wir sie auf primitive und selbst auf die ältesten
Kulturvölker anwenden, ohne uns klar darüber zu sein, ob sie auch wirklich
für die betreffende Kulturstufe Gültigkeit haben.1)
2. Die genetische Ästhetik sollte ihre Hauptaufgabe darin suchen, die
Entwicklung solcher Probleme zu verfolgen, die eine wirkliche ästhetische
Bedeutung besitzen, d. h. in Beziehung zur Bestimmung des ästhetischen
Wertes stehen. Wir stoßen hier auf die Scheidung von genetischer Ästhetik
und Kunstgeschichte. Gegenstandsgeschichte, technische Entwicklung,
Komposition, Kunstformen, Ideenentwicklung sind vom Standpunkt der
genetischen Ästhetik relativ äußerliche Fragen, eben weil sie auch in der
allgemeinen Ästhetik von untergeordneterer Bedeutung sind. Ich bestreite
keineswegs ihr Interesse und ihren Wert für unser Kunstverständnis und
besonders für Kunstgeschichte und Kunstwissenschaft. Ja, ich bestreite dies
um so weniger, als derartige Untersuchungen uns oft wertvolle, obgleich
indirekte Aufschlüsse gewähren über Punkte, wo uns direkte Lösungen
unmöglich sind. Selbstverständlich sind es auch Probleme, mit denen eine
genetische Ästhetik zu rechnen hat, die aber trotzdem das genetische Haupt-
problem nicht aus seiner Stellung verdrängen dürfen.
3. Als dritte Forderung möchte ich auf einen Punkt aufmerksam machen,
der sich weniger auf genetische Ästhetik als auf das Verhältnis der
genetischen zur allgemeinen Ästhetik bezieht. Es erscheint mir wünschens-
wert, daß die allgemeine Ästhetik eine Formulierung des ästhetischen und
des Kunstwertes anstrebt, die sich auch auf vergangene Kunstepochen
anwenden läßt. Das könnte als ein Widerspruch mit der zuerst erwähnten
Forderung erscheinen. Indessen läßt sich dieser Widerspruch vermeiden,
wenn eine solche Formulierung des ästhetischen Wertes selbst entwicklungs-
fähig ist.
1) Vgl. auch Stephan: „Südseekunst“, 1907, für eine Warnung vor weiteren
Ausdrücken wie „Linie“, „Dreieck“, „Ornamentik“, „naturtreu”, „stilisiert” in
Anwendung auf primitive Kunst (S. 49, 81—86, 95—96).