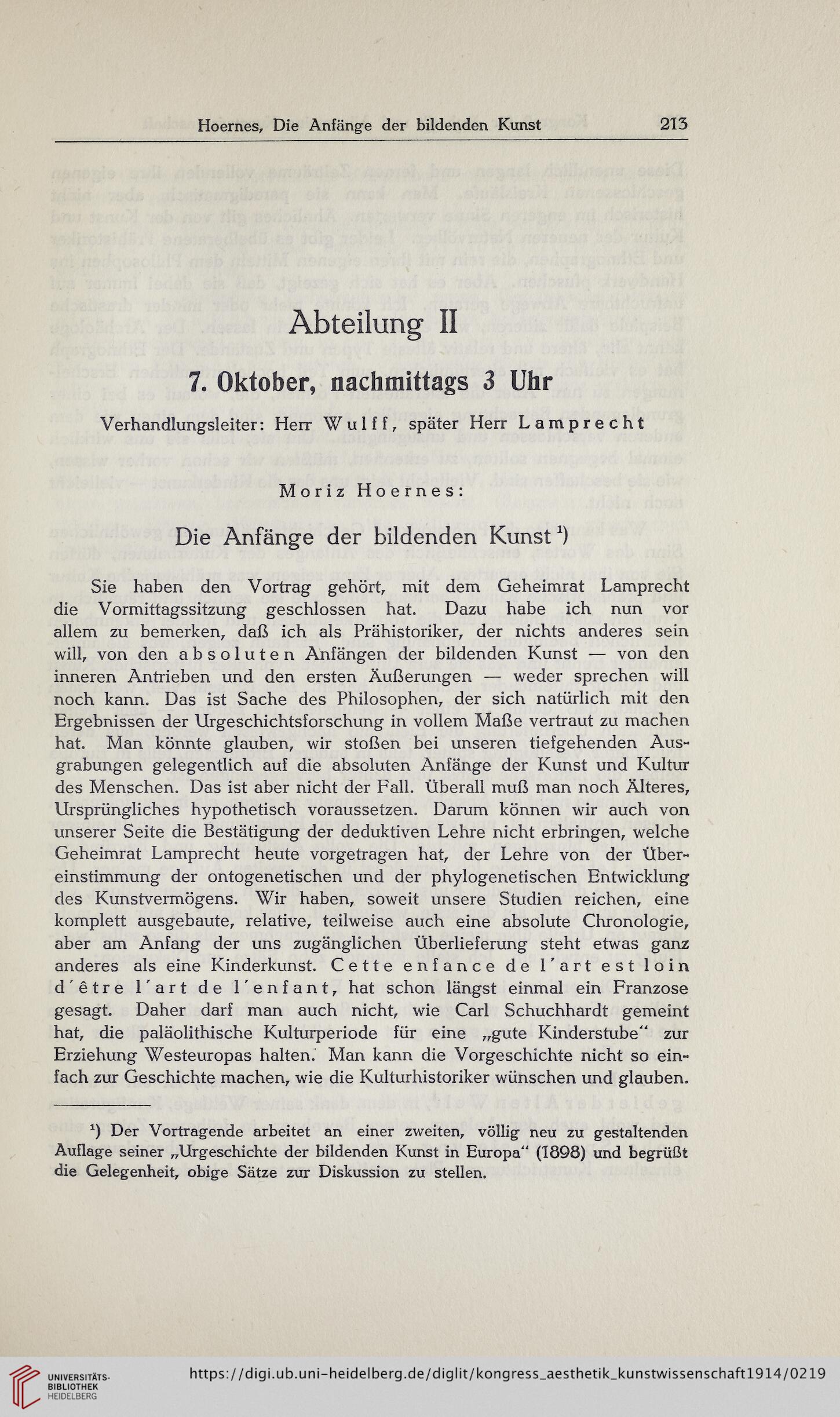Hoernes, Die Anfänge der bildenden Kunst
213
Abteilung II
7. Oktober, nachmittags 3 Uhr
Verhandlungsleiter: Herr Wulff, später Herr Lamprecht
Moriz Hoernes:
Die Anfänge der bildenden Kunst1)
Sie haben den Vortrag gehört, mit dem Geheimrat Lamprecht
die Vormittagssitzung geschlossen hat. Dazu habe ich nun vor
allem zu bemerken, daß ich als Prähistoriker, der nichts anderes sein
will, von den absoluten Anfängen der bildenden Kunst — von den
inneren Antrieben und den ersten Äußerungen — weder sprechen will
noch kann. Das ist Sache des Philosophen, der sich natürlich mit den
Ergebnissen der Urgeschichtsforschung in vollem Maße vertraut zu machen
hat. Man könnte glauben, wir stoßen bei unseren tiefgehenden Aus-
grabungen gelegentlich auf die absoluten Anfänge der Kunst und Kultur
des Menschen. Das ist aber nicht der Fall. Überall muß man noch Älteres,
Ursprüngliches hypothetisch voraussetzen. Darum können wir auch von
unserer Seite die Bestätigung der deduktiven Lehre nicht erbringen, welche
Geheimrat Lamprecht heute vorgetragen hat, der Lehre von der Über-
einstimmung der ontogenetischen und der phylogenetischen Entwicklung
des Kunstvermögens. Wir haben, soweit unsere Studien reichen, eine
komplett ausgebaute, relative, teilweise auch eine absolute Chronologie,
aber am Anfang der uns zugänglichen Überlieferung steht etwas ganz
anderes als eine Kinderkunst. Cette enfance de l'art est loin
d'etre l'art de l'enfant, hat schon längst einmal ein Franzose
gesagt. Daher darf man auch nicht, wie Carl Schuchhardt gemeint
hat, die paläolithische Kulturperiode für eine „gute Kinderstube“ zur
Erziehung Westeuropas halten. Man kann die Vorgeschichte nicht so ein-
fach zur Geschichte machen, wie die Kulturhistoriker wünschen und glauben.
1) Der Vortragende arbeitet an einer zweiten, völlig neu zu gestaltenden
Auflage seiner „Urgeschichte der bildenden Kunst in Europa“ (1898) und begrüßt
die Gelegenheit, obige Sätze zur Diskussion zu stellen.
213
Abteilung II
7. Oktober, nachmittags 3 Uhr
Verhandlungsleiter: Herr Wulff, später Herr Lamprecht
Moriz Hoernes:
Die Anfänge der bildenden Kunst1)
Sie haben den Vortrag gehört, mit dem Geheimrat Lamprecht
die Vormittagssitzung geschlossen hat. Dazu habe ich nun vor
allem zu bemerken, daß ich als Prähistoriker, der nichts anderes sein
will, von den absoluten Anfängen der bildenden Kunst — von den
inneren Antrieben und den ersten Äußerungen — weder sprechen will
noch kann. Das ist Sache des Philosophen, der sich natürlich mit den
Ergebnissen der Urgeschichtsforschung in vollem Maße vertraut zu machen
hat. Man könnte glauben, wir stoßen bei unseren tiefgehenden Aus-
grabungen gelegentlich auf die absoluten Anfänge der Kunst und Kultur
des Menschen. Das ist aber nicht der Fall. Überall muß man noch Älteres,
Ursprüngliches hypothetisch voraussetzen. Darum können wir auch von
unserer Seite die Bestätigung der deduktiven Lehre nicht erbringen, welche
Geheimrat Lamprecht heute vorgetragen hat, der Lehre von der Über-
einstimmung der ontogenetischen und der phylogenetischen Entwicklung
des Kunstvermögens. Wir haben, soweit unsere Studien reichen, eine
komplett ausgebaute, relative, teilweise auch eine absolute Chronologie,
aber am Anfang der uns zugänglichen Überlieferung steht etwas ganz
anderes als eine Kinderkunst. Cette enfance de l'art est loin
d'etre l'art de l'enfant, hat schon längst einmal ein Franzose
gesagt. Daher darf man auch nicht, wie Carl Schuchhardt gemeint
hat, die paläolithische Kulturperiode für eine „gute Kinderstube“ zur
Erziehung Westeuropas halten. Man kann die Vorgeschichte nicht so ein-
fach zur Geschichte machen, wie die Kulturhistoriker wünschen und glauben.
1) Der Vortragende arbeitet an einer zweiten, völlig neu zu gestaltenden
Auflage seiner „Urgeschichte der bildenden Kunst in Europa“ (1898) und begrüßt
die Gelegenheit, obige Sätze zur Diskussion zu stellen.