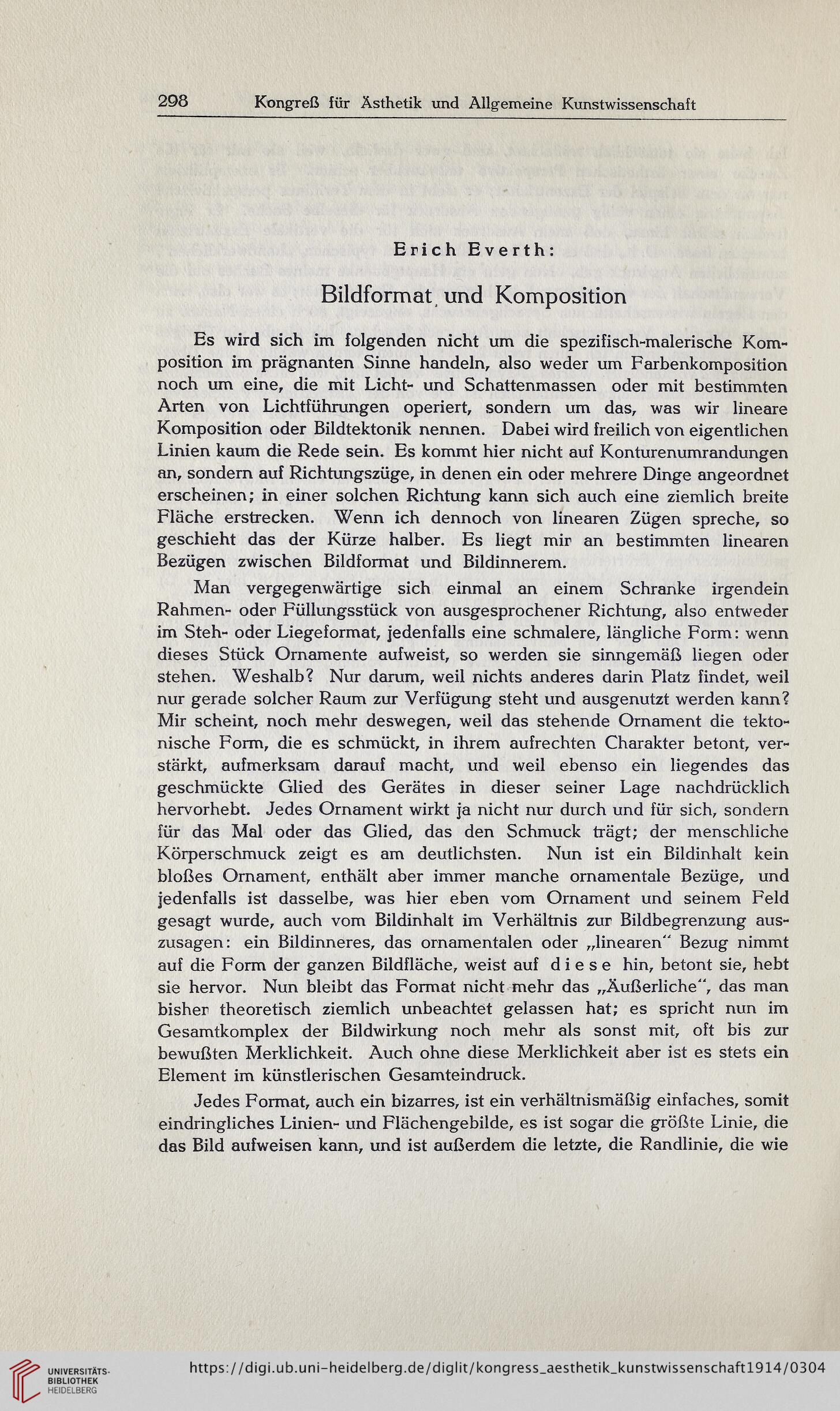298
Kongreß für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft
Erich Everth:
Bildformat, und Komposition
Es wird sich int folgenden nicht um die spezifisch-malerische Kom-
position im prägnanten Sinne handeln, also weder um Farbenkomposition
noch um eine, die mit Licht- und Schattenmassen oder mit bestimmten
Arten von Lichtführungen operiert, sondern um das, was wir lineare
Komposition oder Bildtektonik nennen. Dabei wird freilich von eigentlichen
Linien kaum die Rede sein. Es kommt hier nicht auf Konturenumrandungen
an, sondern auf Richtungszüge, in denen ein oder mehrere Dinge angeordnet
erscheinen; in einer solchen Richtung kann sich auch eine ziemlich breite
Fläche erstrecken. Wenn ich dennoch von linearen Zügen spreche, so
geschieht das der Kürze halber. Es liegt mir an bestimmten linearen
Bezügen zwischen Bildformat und Bildinnerem.
Man vergegenwärtige sich einmal an einem Schranke irgendein
Rahmen- oder Füllungsstück von ausgesprochener Richtung, also entweder
im Steh- oder Liegeformat, jedenfalls eine schmalere, längliche Form: wenn
dieses Stück Ornamente aufweist, so werden sie sinngemäß liegen oder
stehen. Weshalb? Nur darum, weil nichts anderes darin Platz findet, weil
nur gerade solcher Raum zur Verfügung steht und ausgenutzt werden kann?
Mir scheint, noch mehr deswegen, weil das stehende Ornament die tekto-
nische Form, die es schmückt, in ihrem aufrechten Charakter betont, ver-
stärkt, aufmerksam darauf macht, und weil ebenso ein liegendes das
geschmückte Glied des Gerätes in dieser seiner Lage nachdrücklich
hervorhebt. Jedes Ornament wirkt ja nicht nur durch und für sich, sondern
für das Mal oder das Glied, das den Schmuck trägt; der menschliche
Körperschmuck zeigt es am deutlichsten. Nun ist ein Bildinhalt kein
bloßes Ornament, enthält aber immer manche ornamentale Bezüge, und
jedenfalls ist dasselbe, was hier eben vom Ornament und seinem Feld
gesagt wurde, auch vom Bildinhalt im Verhältnis zur Bildbegrenzung aus-
zusagen: ein Bildinneres, das ornamentalen oder „linearen“ Bezug nimmt
auf die Form der ganzen Bildfläche, weist auf diese hin, betont sie, hebt
sie hervor. Nun bleibt das Format nicht mehr das „Äußerliche“, das man
bisher theoretisch ziemlich unbeachtet gelassen hat; es spricht nun im
Gesamtkomplex der Bildwirkung noch mehr als sonst mit, oft bis zur
bewußten Merklichkeit. Auch ohne diese Merklichkeit aber ist es stets ein
Element im künstlerischen Gesamteindruck.
Jedes Format, auch ein bizarres, ist ein verhältnismäßig einfaches, somit
eindringliches Linien- und Flächengebilde, es ist sogar die größte Linie, die
das Bild aufweisen kann, und ist außerdem die letzte, die Randlinie, die wie
Kongreß für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft
Erich Everth:
Bildformat, und Komposition
Es wird sich int folgenden nicht um die spezifisch-malerische Kom-
position im prägnanten Sinne handeln, also weder um Farbenkomposition
noch um eine, die mit Licht- und Schattenmassen oder mit bestimmten
Arten von Lichtführungen operiert, sondern um das, was wir lineare
Komposition oder Bildtektonik nennen. Dabei wird freilich von eigentlichen
Linien kaum die Rede sein. Es kommt hier nicht auf Konturenumrandungen
an, sondern auf Richtungszüge, in denen ein oder mehrere Dinge angeordnet
erscheinen; in einer solchen Richtung kann sich auch eine ziemlich breite
Fläche erstrecken. Wenn ich dennoch von linearen Zügen spreche, so
geschieht das der Kürze halber. Es liegt mir an bestimmten linearen
Bezügen zwischen Bildformat und Bildinnerem.
Man vergegenwärtige sich einmal an einem Schranke irgendein
Rahmen- oder Füllungsstück von ausgesprochener Richtung, also entweder
im Steh- oder Liegeformat, jedenfalls eine schmalere, längliche Form: wenn
dieses Stück Ornamente aufweist, so werden sie sinngemäß liegen oder
stehen. Weshalb? Nur darum, weil nichts anderes darin Platz findet, weil
nur gerade solcher Raum zur Verfügung steht und ausgenutzt werden kann?
Mir scheint, noch mehr deswegen, weil das stehende Ornament die tekto-
nische Form, die es schmückt, in ihrem aufrechten Charakter betont, ver-
stärkt, aufmerksam darauf macht, und weil ebenso ein liegendes das
geschmückte Glied des Gerätes in dieser seiner Lage nachdrücklich
hervorhebt. Jedes Ornament wirkt ja nicht nur durch und für sich, sondern
für das Mal oder das Glied, das den Schmuck trägt; der menschliche
Körperschmuck zeigt es am deutlichsten. Nun ist ein Bildinhalt kein
bloßes Ornament, enthält aber immer manche ornamentale Bezüge, und
jedenfalls ist dasselbe, was hier eben vom Ornament und seinem Feld
gesagt wurde, auch vom Bildinhalt im Verhältnis zur Bildbegrenzung aus-
zusagen: ein Bildinneres, das ornamentalen oder „linearen“ Bezug nimmt
auf die Form der ganzen Bildfläche, weist auf diese hin, betont sie, hebt
sie hervor. Nun bleibt das Format nicht mehr das „Äußerliche“, das man
bisher theoretisch ziemlich unbeachtet gelassen hat; es spricht nun im
Gesamtkomplex der Bildwirkung noch mehr als sonst mit, oft bis zur
bewußten Merklichkeit. Auch ohne diese Merklichkeit aber ist es stets ein
Element im künstlerischen Gesamteindruck.
Jedes Format, auch ein bizarres, ist ein verhältnismäßig einfaches, somit
eindringliches Linien- und Flächengebilde, es ist sogar die größte Linie, die
das Bild aufweisen kann, und ist außerdem die letzte, die Randlinie, die wie