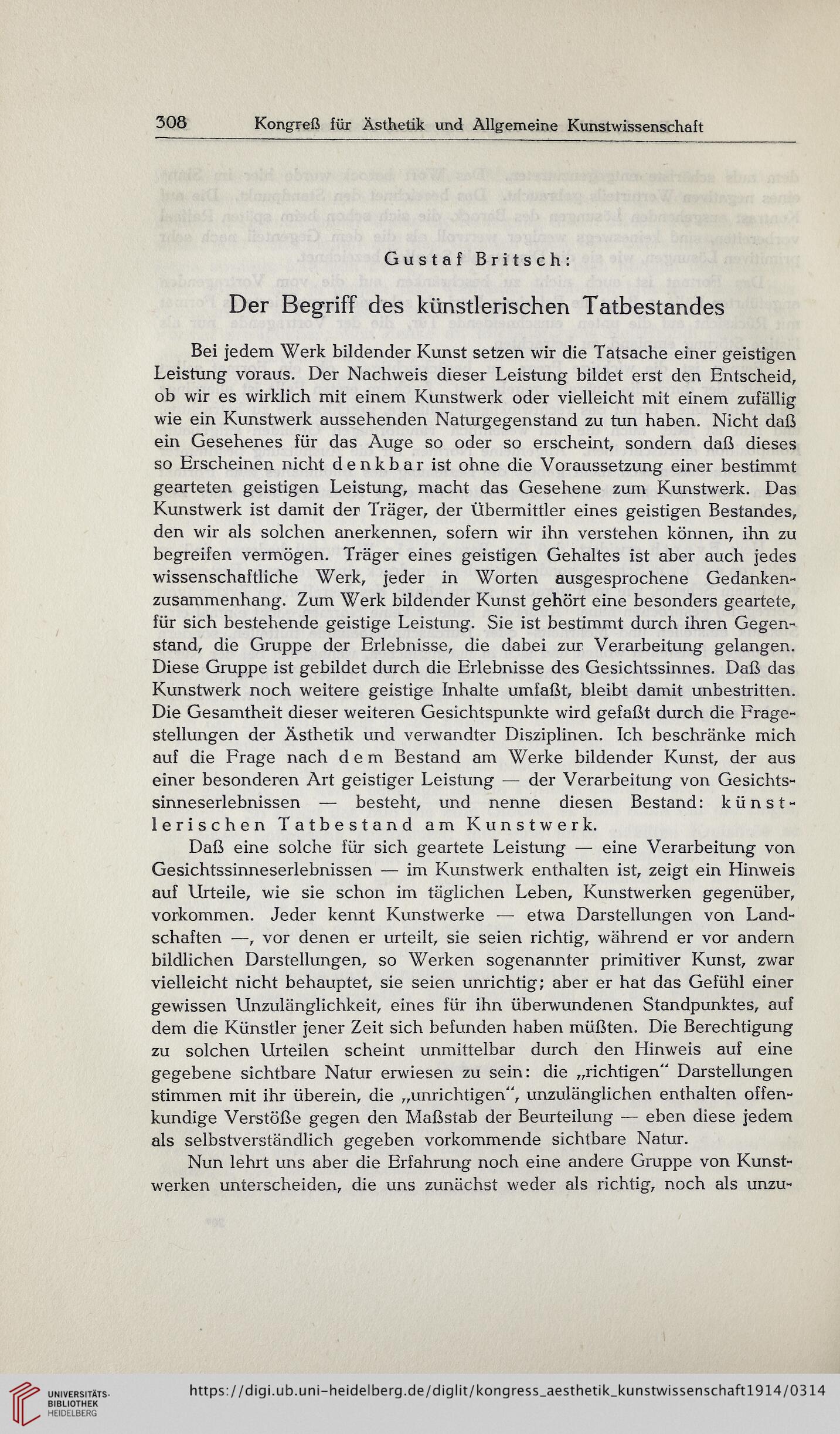308
Kongreß für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft
Gustaf Britsch:
Der Begriff des künstlerischen Tatbestandes
Bei jedem Werk bildender Kunst setzen wir die Tatsache einer geistigen
Leistung voraus. Der Nachweis dieser Leistung bildet erst den Entscheid,
ob wir es wirklich mit einem Kunstwerk oder vielleicht mit einem zufällig
wie ein Kunstwerk aussehenden Naturgegenstand zu tun haben. Nicht daß
ein Gesehenes für das Auge so oder so erscheint, sondern daß dieses
so Erscheinen nicht denkbar ist ohne die Voraussetzung einer bestimmt
gearteten geistigen Leistung, macht das Gesehene zum Kunstwerk. Das
Kunstwerk ist damit der Träger, der Übermittler eines geistigen Bestandes,
den wir als solchen anerkennen, sofern wir ihn verstehen können, ihn zu
begreifen vermögen. Träger eines geistigen Gehaltes ist aber auch jedes
wissenschaftliche Werk, jeder in Worten ausgesprochene Gedanken-
zusammenhang. Zum Werk bildender Kunst gehört eine besonders geartete,
für sich bestehende geistige Leistung. Sie ist bestimmt durch ihren Gegen-
stand, die Gruppe der Erlebnisse, die dabei zur Verarbeitung gelangen.
Diese Gruppe ist gebildet durch die Erlebnisse des Gesichtssinnes. Daß das
Kunstwerk noch weitere geistige Inhalte umfaßt, bleibt damit unbestritten.
Die Gesamtheit dieser weiteren Gesichtspunkte wird gefaßt durch die Frage-
stellungen der Ästhetik und verwandter Disziplinen. Ich beschränke mich
auf die Frage nach dem Bestand am Werke bildender Kunst, der aus
einer besonderen Art geistiger Leistung — der Verarbeitung von Gesichts-
sinneserlebnissen — besteht, und nenne diesen Bestand: künst-
lerischen Tatbestand am Kunstwerk.
Daß eine solche für sich geartete Leistung — eine Verarbeitung von
Gesichtssinneserlebnissen — im Kunstwerk enthalten ist, zeigt ein Hinweis
auf Urteile, wie sie schon im täglichen Leben, Kunstwerken gegenüber,
vorkommen. Jeder kennt Kunstwerke — etwa Darstellungen von Land-
schaften —, vor denen er urteilt, sie seien richtig, während er vor andern
bildlichen Darstellungen, so Werken sogenannter primitiver Kunst, zwar
vielleicht nicht behauptet, sie seien unrichtig; aber er hat das Gefühl einer
gewissen Unzulänglichkeit, eines für ihn überwundenen Standpunktes, auf
dem die Künstler jener Zeit sich befunden haben müßten. Die Berechtigung
zu solchen Urteilen scheint unmittelbar durch den Hinweis auf eine
gegebene sichtbare Natur erwiesen zu sein: die „richtigen“ Darstellungen
stimmen mit ihr überein, die „unrichtigen“, unzulänglichen enthalten offen-
kundige Verstöße gegen den Maßstab der Beurteilung — eben diese jedem
als selbstverständlich gegeben vorkommende sichtbare Natur.
Nun lehrt uns aber die Erfahrung noch eine andere Gruppe von Kunst-
werken unterscheiden, die uns zunächst weder als richtig, noch als unzu-
Kongreß für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft
Gustaf Britsch:
Der Begriff des künstlerischen Tatbestandes
Bei jedem Werk bildender Kunst setzen wir die Tatsache einer geistigen
Leistung voraus. Der Nachweis dieser Leistung bildet erst den Entscheid,
ob wir es wirklich mit einem Kunstwerk oder vielleicht mit einem zufällig
wie ein Kunstwerk aussehenden Naturgegenstand zu tun haben. Nicht daß
ein Gesehenes für das Auge so oder so erscheint, sondern daß dieses
so Erscheinen nicht denkbar ist ohne die Voraussetzung einer bestimmt
gearteten geistigen Leistung, macht das Gesehene zum Kunstwerk. Das
Kunstwerk ist damit der Träger, der Übermittler eines geistigen Bestandes,
den wir als solchen anerkennen, sofern wir ihn verstehen können, ihn zu
begreifen vermögen. Träger eines geistigen Gehaltes ist aber auch jedes
wissenschaftliche Werk, jeder in Worten ausgesprochene Gedanken-
zusammenhang. Zum Werk bildender Kunst gehört eine besonders geartete,
für sich bestehende geistige Leistung. Sie ist bestimmt durch ihren Gegen-
stand, die Gruppe der Erlebnisse, die dabei zur Verarbeitung gelangen.
Diese Gruppe ist gebildet durch die Erlebnisse des Gesichtssinnes. Daß das
Kunstwerk noch weitere geistige Inhalte umfaßt, bleibt damit unbestritten.
Die Gesamtheit dieser weiteren Gesichtspunkte wird gefaßt durch die Frage-
stellungen der Ästhetik und verwandter Disziplinen. Ich beschränke mich
auf die Frage nach dem Bestand am Werke bildender Kunst, der aus
einer besonderen Art geistiger Leistung — der Verarbeitung von Gesichts-
sinneserlebnissen — besteht, und nenne diesen Bestand: künst-
lerischen Tatbestand am Kunstwerk.
Daß eine solche für sich geartete Leistung — eine Verarbeitung von
Gesichtssinneserlebnissen — im Kunstwerk enthalten ist, zeigt ein Hinweis
auf Urteile, wie sie schon im täglichen Leben, Kunstwerken gegenüber,
vorkommen. Jeder kennt Kunstwerke — etwa Darstellungen von Land-
schaften —, vor denen er urteilt, sie seien richtig, während er vor andern
bildlichen Darstellungen, so Werken sogenannter primitiver Kunst, zwar
vielleicht nicht behauptet, sie seien unrichtig; aber er hat das Gefühl einer
gewissen Unzulänglichkeit, eines für ihn überwundenen Standpunktes, auf
dem die Künstler jener Zeit sich befunden haben müßten. Die Berechtigung
zu solchen Urteilen scheint unmittelbar durch den Hinweis auf eine
gegebene sichtbare Natur erwiesen zu sein: die „richtigen“ Darstellungen
stimmen mit ihr überein, die „unrichtigen“, unzulänglichen enthalten offen-
kundige Verstöße gegen den Maßstab der Beurteilung — eben diese jedem
als selbstverständlich gegeben vorkommende sichtbare Natur.
Nun lehrt uns aber die Erfahrung noch eine andere Gruppe von Kunst-
werken unterscheiden, die uns zunächst weder als richtig, noch als unzu-