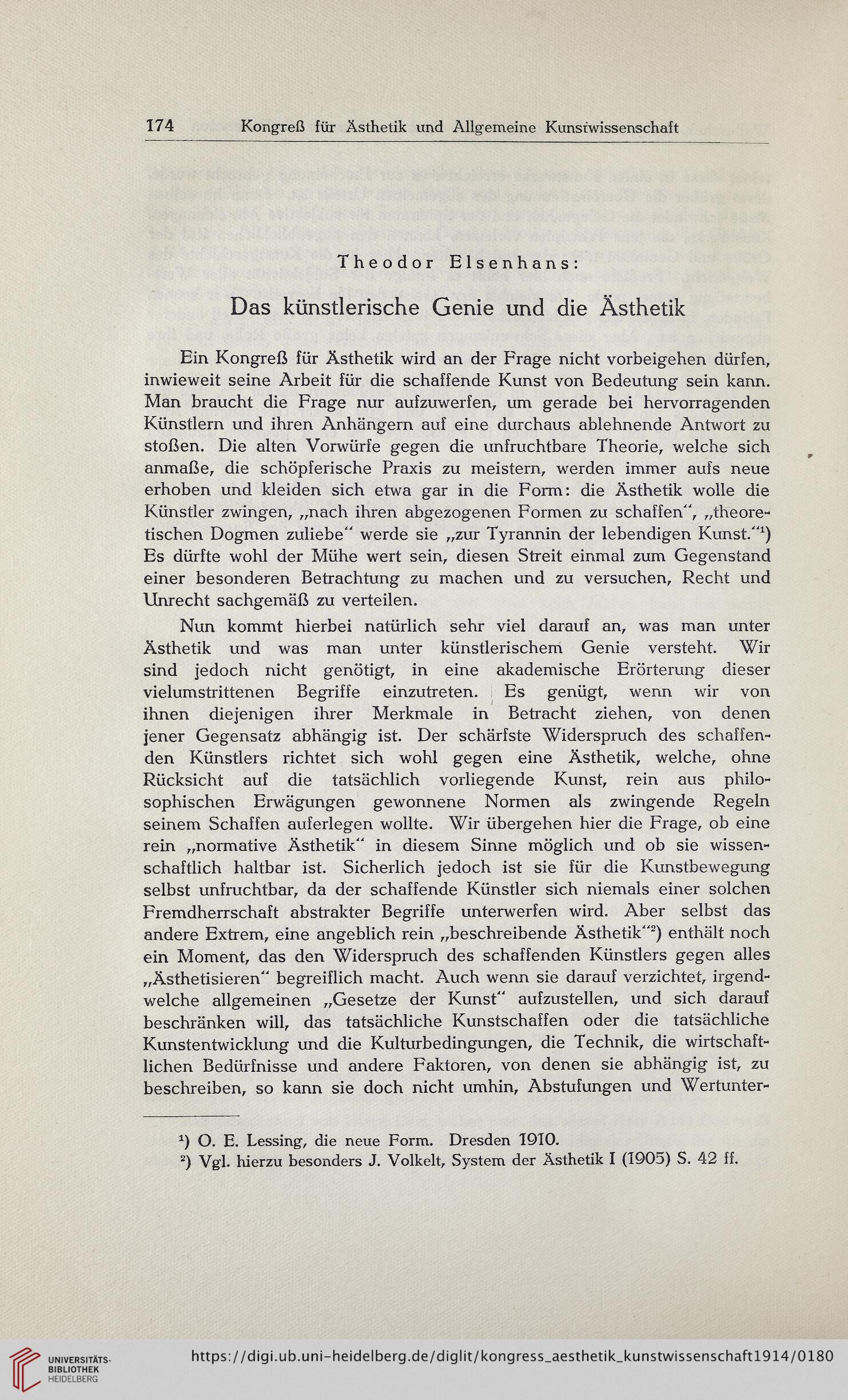174
Kongreß für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft
Theodor Elsenhans:
Das künstlerische Genie und die Ästhetik
Ein Kongreß für Ästhetik wird an der Frage nicht vorbeigehen dürfen,
inwieweit seine Arbeit für die schaffende Kunst von Bedeutung sein kann.
Man braucht die Frage nur aufzuwerfen, um gerade bei hervorragenden
Künstlern und ihren Anhängern auf eine durchaus ablehnende Antwort zu
stoßen. Die alten Vorwürfe gegen die unfruchtbare Theorie, welche sich
anmaße, die schöpferische Praxis zu meistern, werden immer aufs neue
erhoben und kleiden sich etwa gar in die Form: die Ästhetik wolle die
Künstler zwingen, „nach ihren abgezogenen Formen zu schaffen“, „theore-
tischen Dogmen zuliebe“ werde sie „zur Tyrannin der lebendigen Kunst.“1)
Es dürfte wohl der Mühe wert sein, diesen Streit einmal zum Gegenstand
einer besonderen Betrachtung zu machen und zu versuchen, Recht und
Unrecht sachgemäß zu verteilen.
Nun kommt hierbei natürlich sehr viel darauf an, was man unter
Ästhetik und was man unter künstlerischem Genie versteht. Wir
sind jedoch nicht genötigt, in eine akademische Erörterung dieser
vielumstrittenen Begriffe einzutreten. Es genügt, wenn wir von
ihnen diejenigen ihrer Merkmale in Betracht ziehen, von denen
jener Gegensatz abhängig ist. Der schärfste Widerspruch des schaffen-
den Künstlers richtet sich wohl gegen eine Ästhetik, welche, ohne
Rücksicht auf die tatsächlich vorliegende Kunst, rein aus philo-
sophischen Erwägungen gewonnene Normen als zwingende Regeln
seinem Schaffen auferlegen wollte. Wir übergehen hier die Frage, ob eine
rein „normative Ästhetik“ in diesem Sinne möglich und ob sie wissen-
schaftlich haltbar ist. Sicherlich jedoch ist sie für die Kunstbewegung
selbst unfruchtbar, da der schaffende Künstler sich niemals einer solchen
Fremdherrschaft abstrakter Begriffe unterwerfen wird. Aber selbst das
andere Extrem, eine angeblich rein „beschreibende Ästhetik“2) enthält noch
ein Moment, das den Widerspruch des schaffenden Künstlers gegen alles
„Ästhetisieren“ begreiflich macht. Auch wenn sie darauf verzichtet, irgend-
welche allgemeinen „Gesetze der Kunst“ aufzustellen, und sich darauf
beschränken will, das tatsächliche Kunstschaffen oder die tatsächliche
Kunstentwicklung und die Kulturbedingungen, die Technik, die wirtschaft-
lichen Bedürfnisse und andere Faktoren, von denen sie abhängig ist, zu
beschreiben, so kann sie doch nicht umhin, Abstufungen und Wertunter-
x) Ο. E. Lessing, die neue Form. Dresden 1910.
2) Vgl. hierzu besonders J. Volkelt, System der Ästhetik I (1905) S. 42 ff.
Kongreß für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft
Theodor Elsenhans:
Das künstlerische Genie und die Ästhetik
Ein Kongreß für Ästhetik wird an der Frage nicht vorbeigehen dürfen,
inwieweit seine Arbeit für die schaffende Kunst von Bedeutung sein kann.
Man braucht die Frage nur aufzuwerfen, um gerade bei hervorragenden
Künstlern und ihren Anhängern auf eine durchaus ablehnende Antwort zu
stoßen. Die alten Vorwürfe gegen die unfruchtbare Theorie, welche sich
anmaße, die schöpferische Praxis zu meistern, werden immer aufs neue
erhoben und kleiden sich etwa gar in die Form: die Ästhetik wolle die
Künstler zwingen, „nach ihren abgezogenen Formen zu schaffen“, „theore-
tischen Dogmen zuliebe“ werde sie „zur Tyrannin der lebendigen Kunst.“1)
Es dürfte wohl der Mühe wert sein, diesen Streit einmal zum Gegenstand
einer besonderen Betrachtung zu machen und zu versuchen, Recht und
Unrecht sachgemäß zu verteilen.
Nun kommt hierbei natürlich sehr viel darauf an, was man unter
Ästhetik und was man unter künstlerischem Genie versteht. Wir
sind jedoch nicht genötigt, in eine akademische Erörterung dieser
vielumstrittenen Begriffe einzutreten. Es genügt, wenn wir von
ihnen diejenigen ihrer Merkmale in Betracht ziehen, von denen
jener Gegensatz abhängig ist. Der schärfste Widerspruch des schaffen-
den Künstlers richtet sich wohl gegen eine Ästhetik, welche, ohne
Rücksicht auf die tatsächlich vorliegende Kunst, rein aus philo-
sophischen Erwägungen gewonnene Normen als zwingende Regeln
seinem Schaffen auferlegen wollte. Wir übergehen hier die Frage, ob eine
rein „normative Ästhetik“ in diesem Sinne möglich und ob sie wissen-
schaftlich haltbar ist. Sicherlich jedoch ist sie für die Kunstbewegung
selbst unfruchtbar, da der schaffende Künstler sich niemals einer solchen
Fremdherrschaft abstrakter Begriffe unterwerfen wird. Aber selbst das
andere Extrem, eine angeblich rein „beschreibende Ästhetik“2) enthält noch
ein Moment, das den Widerspruch des schaffenden Künstlers gegen alles
„Ästhetisieren“ begreiflich macht. Auch wenn sie darauf verzichtet, irgend-
welche allgemeinen „Gesetze der Kunst“ aufzustellen, und sich darauf
beschränken will, das tatsächliche Kunstschaffen oder die tatsächliche
Kunstentwicklung und die Kulturbedingungen, die Technik, die wirtschaft-
lichen Bedürfnisse und andere Faktoren, von denen sie abhängig ist, zu
beschreiben, so kann sie doch nicht umhin, Abstufungen und Wertunter-
x) Ο. E. Lessing, die neue Form. Dresden 1910.
2) Vgl. hierzu besonders J. Volkelt, System der Ästhetik I (1905) S. 42 ff.