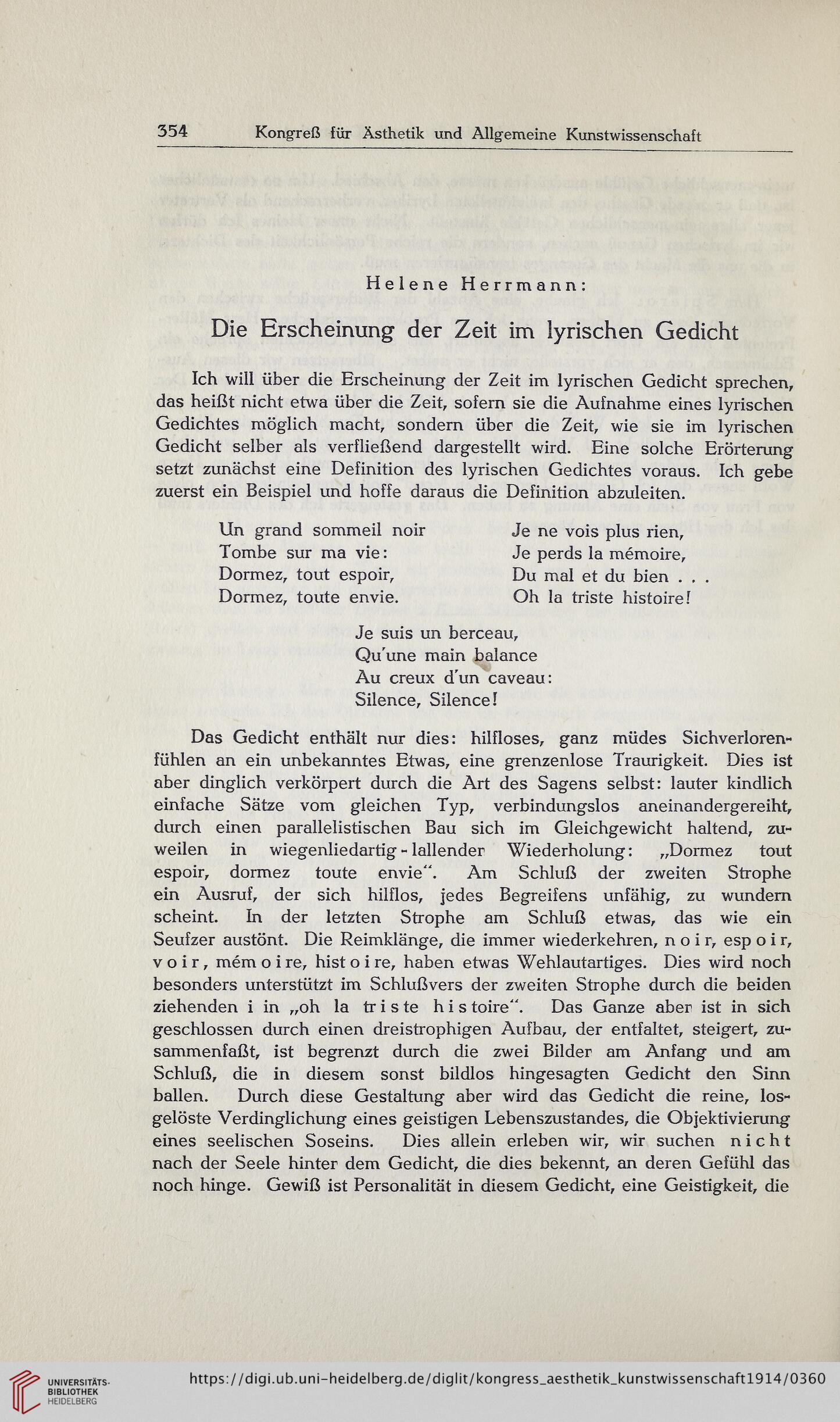354
Kongreß für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft
Helene Herrmann:
Die Erscheinung der Zeit im lyrischen Gedicht
Ich will über die Erscheinung der Zeit im lyrischen Gedicht sprechen,
das heißt nicht etwa über die Zeit, sofern sie die Aufnahme eines lyrischen
Gedichtes möglich macht, sondern über die Zeit, wie sie im lyrischen
Gedicht selber als verfließend dargestellt wird. Eine solche Erörterung
setzt zunächst eine Definition des lyrischen Gedichtes voraus. Ich gebe
zuerst ein Beispiel und hoffe daraus die Definition abzuleiten.
Un grand sommeil noir
Tombe sur ma vie:
Dormez, tout espoir,
Dormez, toute envie.
Je ne vois plus rien,
Je perds la memoire,
Du mal et du bien . ,
Oh la triste histoirel
Je suis un berceau,
Qu'une main balance
Au creux d'un caveau:
Silence, Silence!
Das Gedicht enthält nur dies: hilfloses, ganz müdes Sichverloren-
fühlen an ein unbekanntes Etwas, eine grenzenlose Traurigkeit. Dies ist
aber dinglich verkörpert durch die Art des Sagens selbst: lauter kindlich
einfache Sätze vom gleichen Typ, verbindungslos aneinandergereiht,
durch einen parallelistischen Bau sich im Gleichgewicht haltend, zu-
weilen in wiegenliedartig - lallender Wiederholung: „Dormez tout
espoir, dormez toute envie“. Am Schluß der zweiten Strophe
ein Ausruf, der sich hilflos, jedes Begreifens unfähig, zu wundem
scheint. In der letzten Strophe am Schluß etwas, das wie ein
Seufzer austönt. Die Reimklänge, die immer wiederkehren, noir, esp o i r,
v o i r, mem o i re, hist o i re, haben etwas Wehlautartiges. Dies wird noch
besonders unterstützt im Schlußvers der zweiten Strophe durch die beiden
ziehenden i in „oh la tr i s te h i s toire“. Das Ganze aber ist in sich
geschlossen durch einen dreistrophigen Aufbau, der entfaltet, steigert, zu-
sammenfaßt, ist begrenzt durch die zwei Bilder am Anfang und am
Schluß, die in diesem sonst bildlos hingesagten Gedicht den Sinn
ballen. Durch diese Gestaltung aber wird das Gedicht die reine, los-
gelöste Verdinglichung eines geistigen Lebenszustandes, die Objektivierung
eines seelischen Soseins. Dies allein erleben wir, wir suchen nicht
nach der Seele hinter dem Gedicht, die dies bekennt, an deren Gefühl das
noch hinge. Gewiß ist Personalität in diesem Gedicht, eine Geistigkeit, die
Kongreß für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft
Helene Herrmann:
Die Erscheinung der Zeit im lyrischen Gedicht
Ich will über die Erscheinung der Zeit im lyrischen Gedicht sprechen,
das heißt nicht etwa über die Zeit, sofern sie die Aufnahme eines lyrischen
Gedichtes möglich macht, sondern über die Zeit, wie sie im lyrischen
Gedicht selber als verfließend dargestellt wird. Eine solche Erörterung
setzt zunächst eine Definition des lyrischen Gedichtes voraus. Ich gebe
zuerst ein Beispiel und hoffe daraus die Definition abzuleiten.
Un grand sommeil noir
Tombe sur ma vie:
Dormez, tout espoir,
Dormez, toute envie.
Je ne vois plus rien,
Je perds la memoire,
Du mal et du bien . ,
Oh la triste histoirel
Je suis un berceau,
Qu'une main balance
Au creux d'un caveau:
Silence, Silence!
Das Gedicht enthält nur dies: hilfloses, ganz müdes Sichverloren-
fühlen an ein unbekanntes Etwas, eine grenzenlose Traurigkeit. Dies ist
aber dinglich verkörpert durch die Art des Sagens selbst: lauter kindlich
einfache Sätze vom gleichen Typ, verbindungslos aneinandergereiht,
durch einen parallelistischen Bau sich im Gleichgewicht haltend, zu-
weilen in wiegenliedartig - lallender Wiederholung: „Dormez tout
espoir, dormez toute envie“. Am Schluß der zweiten Strophe
ein Ausruf, der sich hilflos, jedes Begreifens unfähig, zu wundem
scheint. In der letzten Strophe am Schluß etwas, das wie ein
Seufzer austönt. Die Reimklänge, die immer wiederkehren, noir, esp o i r,
v o i r, mem o i re, hist o i re, haben etwas Wehlautartiges. Dies wird noch
besonders unterstützt im Schlußvers der zweiten Strophe durch die beiden
ziehenden i in „oh la tr i s te h i s toire“. Das Ganze aber ist in sich
geschlossen durch einen dreistrophigen Aufbau, der entfaltet, steigert, zu-
sammenfaßt, ist begrenzt durch die zwei Bilder am Anfang und am
Schluß, die in diesem sonst bildlos hingesagten Gedicht den Sinn
ballen. Durch diese Gestaltung aber wird das Gedicht die reine, los-
gelöste Verdinglichung eines geistigen Lebenszustandes, die Objektivierung
eines seelischen Soseins. Dies allein erleben wir, wir suchen nicht
nach der Seele hinter dem Gedicht, die dies bekennt, an deren Gefühl das
noch hinge. Gewiß ist Personalität in diesem Gedicht, eine Geistigkeit, die