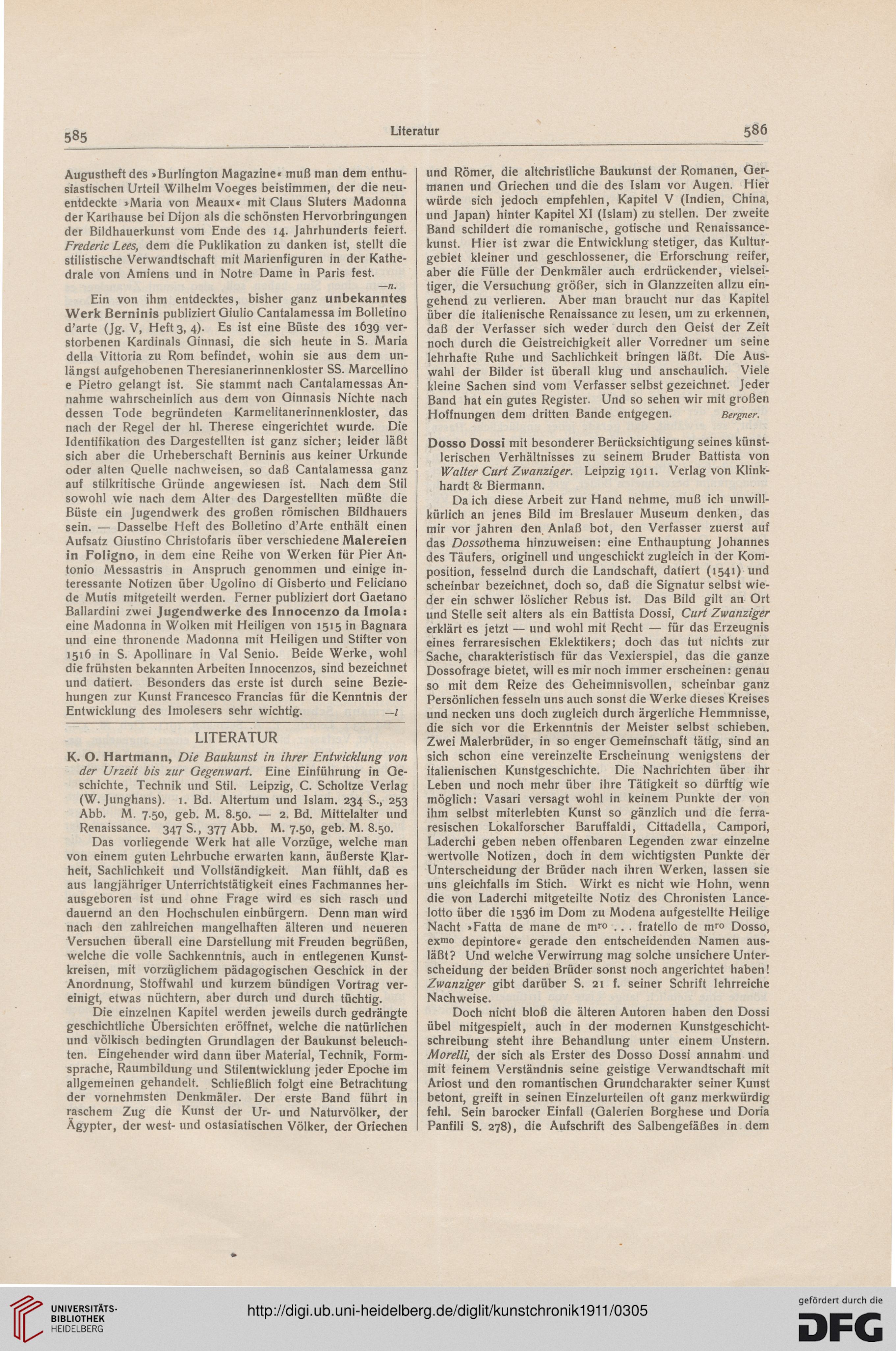585
Literatur
586
Augustheft des »Burlington Magazine« muß man dem enthu-
siastischen Urteil Wilhelm Voeges beistimmen, der die neu-
entdeckte »Maria von Meaux« mit Claus Sluters Madonna
der Karthause bei Dijon als die schönsten Hervorbringungen
der Bildhauerkunst vom Ende des 14. Jahrhunderts feiert.
Frederic Lees, dem die Puklikation zu danken ist, stellt die
stilistische Verwandtschaft mit Marienfiguren in der Kathe-
drale von Amiens und in Notre Dame in Paris fest.
—n.
Ein von ihm entdecktes, bisher ganz unbekanntes
Werk Berninis publiziert Oiulio Cantalamessa im Bolletino
d'arte (Jg. V, Heft 3, 4). Es ist eine Büste des 1639 ver-
storbenen Kardinals Ginnasi, die sich heute in S. Maria
della Vittoria zu Rom befindet, wohin sie aus dem un-
längst aufgehobenen Theresianerinnenkloster SS. Marcellino
e Pietro gelangt ist. Sie stammt nach Cantalamessas An-
nahme wahrscheinlich aus dem von Oinnasis Nichte nach
dessen Tode begründeten Karmelitanerinnenkloster, das
nach der Regel der hl. Therese eingerichtet wurde. Die
Identifikation des Dargestellten ist ganz sicher; leider läßt
sich aber die Urheberschaft Berninis aus keiner Urkunde
oder alten Quelle nachweisen, so daß Cantalamessa ganz
auf stilkritische Gründe angewiesen ist. Nach dem Stil
sowohl wie nach dem Alter des Dargestellten müßte die
Büste ein Jugendwerk des großen römischen Bildhauers
sein. — Dasselbe Heft des Bolletino d'Arte enthält einen
Aufsatz Giustino Christofaris über verschiedene Malereien
in Foligno, in dem eine Reihe von Werken für Pier An-
tonio Messastris in Anspruch genommen und einige in-
teressante Notizen über Ugolino di Gisberto und Feliciano
de Mutis mitgeteilt werden. Ferner publiziert dort Gaetano
Ballardini zwei Jugendwerke des Innocenzo da Imola:
eine Madonna in Wolken mit Heiligen von 1515 in Bagnara
und eine thronende Madonna mit Heiligen und Stifter von
1516 in S. Apollinare in Val Senio. Beide Werke, wohl
die frühsten bekannten Arbeiten Innocenzos, sind bezeichnet
und datiert. Besonders das erste ist durch seine Bezie-
hungen zur Kunst Francesco Francias für die Kenntnis der
Entwicklung des Imolesers sehr wichtig. —/
LITERATUR
K. O. Hartmann, Die Baukunst in ihrer Entwicklung von
der Urzeit bis zur Gegenwart. Eine Einführung in Ge-
schichte, Technik und Stil. Leipzig, C. Scholtze Verlag
(W. Junghans). 1. Bd. Altertum und Islam. 234 S., 253
Abb. M. 7.50, geb. M. 8.50. — 2. Bd. Mittelalter und
Renaissance. 347 S., 377 Abb. M. 7.50, geb. M. 8.50.
Das vorliegende Werk hat alle Vorzüge, welche man
von einem guten Lehrbuche erwarten kann, äußerste Klar-
heit, Sachlichkeit und Vollständigkeit. Man fühlt, daß es
aus langjähriger Unterrichtstätigkeit eines Fachmannes her-
ausgeboren ist und ohne Frage wird es sich rasch und
dauernd an den Hochschulen einbürgern. Denn man wird
nach den zahlreichen mangelhaften älteren und neueren
Versuchen überall eine Darstellung mit Freuden begrüßen,
welche die volle Sachkenntnis, auch in entlegenen Kunst-
kreisen, mit vorzüglichem pädagogischen Geschick in der
Anordnung, Stoffwahl und kurzem bündigen Vortrag ver-
einigt, etwas nüchtern, aber durch und durch tüchtig.
Die einzelnen Kapitel werden jeweils durch gedrängte
geschichtliche Übersichten eröffnet, welche die natürlichen
und völkisch bedingten Grundlagen der Baukunst beleuch-
ten. Eingehender wird dann über Material, Technik, Form-
sprache, Raumbildung und Stilentwicklung jeder Epoche im
allgemeinen gehandelt. Schließlich folgt eine Betrachtung
der vornehmsten Denkmäler. Der erste Band führt in
raschem Zug die Kunst der Ur- und Naturvölker, der
Ägypter, der west- und ostasiatischen Völker, der Griechen
und Römer, die altchristliche Baukunst der Romanen, Ger-
manen und Griechen und die des Islam vor Augen. Hier
würde sich jedoch empfehlen, Kapitel V (Indien, China,
und Japan) hinter Kapitel XI (Islam) zu stellen. Der zweite
Band schildert die romanische, gotische und Renaissance-
kunst. Hier ist zwar die Entwicklung stetiger, das Kultur-
gebiet kleiner und geschlossener, die Erforschung reifer,
aber die Fülle der Denkmäler auch erdrückender, vielsei-
tiger, die Versuchung größer, sich in Glanzzeiten allzu ein-
gehend zu verlieren. Aber man braucht nur das Kapitel
über die italienische Renaissance zu lesen, um zu erkennen,
daß der Verfasser sich weder durch den Geist der Zeit
noch durch die Geistreichigkeit aller Vorredner um seine
lehrhafte Ruhe und Sachlichkeit bringen läßt. Die Aus-
wahl der Bilder ist überall klug und anschaulich. Viele
kleine Sachen sind vom Verfasser selbst gezeichnet. Jeder
Band hat ein gutes Register. Und so sehen wir mit großen
Hoffnungen dem dritten Bande entgegen. Bergner.
Dosso Dossi mit besonderer Berücksichtigung seines künst-
lerischen Verhältnisses zu seinem Bruder Battista von
Walter Curt Zwanziger. Leipzig 1911. Verlag von Klink-
hardt & Biermann.
Da ich diese Arbeit zur Hand nehme, muß ich unwill-
kürlich an jenes Bild im Breslauer Museum denken, das
mir vor Jahren den Anlaß bot, den Verfasser zuerst auf
das Dossothema hinzuweisen: eine Enthauptung Johannes
des Täufers, originell und ungeschickt zugleich in der Kom-
position, fesselnd durch die Landschaft, datiert (1541) und
scheinbar bezeichnet, doch so, daß die Signatur selbst wie-
der ein schwer löslicher Rebus ist. Das Bild gilt an Ort
und Stelle seit alters als ein Battista Dossi, Curt Zwanziger
erklärt es jetzt — und wohl mit Recht — für das Erzeugnis
eines ferraresischen Eklektikers; doch das tut nichts zur
Sache, charakteristisch für das Vexierspiel, das die ganze
Dossofrage bietet, will es mir noch immer erscheinen: genau
so mit dem Reize des Geheimnisvollen, scheinbar ganz
Persönlichen fesseln uns auch sonst die Werke dieses Kreises
und necken uns doch zugleich durch ärgerliche Hemmnisse,
die sich vor die Erkenntnis der Meister selbst schieben.
Zwei Malerbrüder, in so enger Gemeinschaft tätig, sind an
sich schon eine vereinzelte Erscheinung wenigstens der
italienischen Kunstgeschichte. Die Nachrichten über ihr
Leben und noch mehr über ihre Tätigkeit so dürftig wie
möglich: Vasari versagt wohl in keinem Punkte der von
ihm selbst miterlebten Kunst so gänzlich und die ferra-
resischen Lokalforscher Baruffaldi, Cittadelia, Campori,
Laderchi geben neben offenbaren Legenden zwar einzelne
wertvolle Notizen, doch in dem wichtigsten Punkte der
Unterscheidung der Brüder nach ihren Werken, lassen sie
uns gleichfalls im Stich. Wirkt es nicht wie Hohn, wenn
die von Laderchi mitgeteilte Notiz des Chronisten Lance-
lotto über die 1536 im Dom zu Modena aufgestellte Heilige
Nacht »Fatta de mane de mr° .. . fratello de m"> Dosso,
exmo depintore« gerade den entscheidenden Namen aus-
läßt? Und welche Verwirrung mag solche unsichere Unter-
scheidung der beiden Brüder sonst noch angerichtet haben!
Zwanziger gibt darüber S. 21 f. seiner Schrift lehrreiche
Nachweise.
Doch nicht bloß die älteren Autoren haben den Dossi
übel mitgespielt, auch in der modernen Kunstgeschicht-
schreibung steht ihre Behandlung unter einem Unstern.
Morelli, der sich als Erster des Dosso Dossi annahm und
mit feinem Verständnis seine geistige Verwandtschaft mit
Ariost und den romantischen Grundcharakter seiner Kunst
betont, greift in seinen Einzelurteilen oft ganz merkwürdig
fehl. Sein barocker Einfall (Galerien Borghese und Doria
Panfili S. 278), die Aufschrift des Salbengefäßes in dem
Literatur
586
Augustheft des »Burlington Magazine« muß man dem enthu-
siastischen Urteil Wilhelm Voeges beistimmen, der die neu-
entdeckte »Maria von Meaux« mit Claus Sluters Madonna
der Karthause bei Dijon als die schönsten Hervorbringungen
der Bildhauerkunst vom Ende des 14. Jahrhunderts feiert.
Frederic Lees, dem die Puklikation zu danken ist, stellt die
stilistische Verwandtschaft mit Marienfiguren in der Kathe-
drale von Amiens und in Notre Dame in Paris fest.
—n.
Ein von ihm entdecktes, bisher ganz unbekanntes
Werk Berninis publiziert Oiulio Cantalamessa im Bolletino
d'arte (Jg. V, Heft 3, 4). Es ist eine Büste des 1639 ver-
storbenen Kardinals Ginnasi, die sich heute in S. Maria
della Vittoria zu Rom befindet, wohin sie aus dem un-
längst aufgehobenen Theresianerinnenkloster SS. Marcellino
e Pietro gelangt ist. Sie stammt nach Cantalamessas An-
nahme wahrscheinlich aus dem von Oinnasis Nichte nach
dessen Tode begründeten Karmelitanerinnenkloster, das
nach der Regel der hl. Therese eingerichtet wurde. Die
Identifikation des Dargestellten ist ganz sicher; leider läßt
sich aber die Urheberschaft Berninis aus keiner Urkunde
oder alten Quelle nachweisen, so daß Cantalamessa ganz
auf stilkritische Gründe angewiesen ist. Nach dem Stil
sowohl wie nach dem Alter des Dargestellten müßte die
Büste ein Jugendwerk des großen römischen Bildhauers
sein. — Dasselbe Heft des Bolletino d'Arte enthält einen
Aufsatz Giustino Christofaris über verschiedene Malereien
in Foligno, in dem eine Reihe von Werken für Pier An-
tonio Messastris in Anspruch genommen und einige in-
teressante Notizen über Ugolino di Gisberto und Feliciano
de Mutis mitgeteilt werden. Ferner publiziert dort Gaetano
Ballardini zwei Jugendwerke des Innocenzo da Imola:
eine Madonna in Wolken mit Heiligen von 1515 in Bagnara
und eine thronende Madonna mit Heiligen und Stifter von
1516 in S. Apollinare in Val Senio. Beide Werke, wohl
die frühsten bekannten Arbeiten Innocenzos, sind bezeichnet
und datiert. Besonders das erste ist durch seine Bezie-
hungen zur Kunst Francesco Francias für die Kenntnis der
Entwicklung des Imolesers sehr wichtig. —/
LITERATUR
K. O. Hartmann, Die Baukunst in ihrer Entwicklung von
der Urzeit bis zur Gegenwart. Eine Einführung in Ge-
schichte, Technik und Stil. Leipzig, C. Scholtze Verlag
(W. Junghans). 1. Bd. Altertum und Islam. 234 S., 253
Abb. M. 7.50, geb. M. 8.50. — 2. Bd. Mittelalter und
Renaissance. 347 S., 377 Abb. M. 7.50, geb. M. 8.50.
Das vorliegende Werk hat alle Vorzüge, welche man
von einem guten Lehrbuche erwarten kann, äußerste Klar-
heit, Sachlichkeit und Vollständigkeit. Man fühlt, daß es
aus langjähriger Unterrichtstätigkeit eines Fachmannes her-
ausgeboren ist und ohne Frage wird es sich rasch und
dauernd an den Hochschulen einbürgern. Denn man wird
nach den zahlreichen mangelhaften älteren und neueren
Versuchen überall eine Darstellung mit Freuden begrüßen,
welche die volle Sachkenntnis, auch in entlegenen Kunst-
kreisen, mit vorzüglichem pädagogischen Geschick in der
Anordnung, Stoffwahl und kurzem bündigen Vortrag ver-
einigt, etwas nüchtern, aber durch und durch tüchtig.
Die einzelnen Kapitel werden jeweils durch gedrängte
geschichtliche Übersichten eröffnet, welche die natürlichen
und völkisch bedingten Grundlagen der Baukunst beleuch-
ten. Eingehender wird dann über Material, Technik, Form-
sprache, Raumbildung und Stilentwicklung jeder Epoche im
allgemeinen gehandelt. Schließlich folgt eine Betrachtung
der vornehmsten Denkmäler. Der erste Band führt in
raschem Zug die Kunst der Ur- und Naturvölker, der
Ägypter, der west- und ostasiatischen Völker, der Griechen
und Römer, die altchristliche Baukunst der Romanen, Ger-
manen und Griechen und die des Islam vor Augen. Hier
würde sich jedoch empfehlen, Kapitel V (Indien, China,
und Japan) hinter Kapitel XI (Islam) zu stellen. Der zweite
Band schildert die romanische, gotische und Renaissance-
kunst. Hier ist zwar die Entwicklung stetiger, das Kultur-
gebiet kleiner und geschlossener, die Erforschung reifer,
aber die Fülle der Denkmäler auch erdrückender, vielsei-
tiger, die Versuchung größer, sich in Glanzzeiten allzu ein-
gehend zu verlieren. Aber man braucht nur das Kapitel
über die italienische Renaissance zu lesen, um zu erkennen,
daß der Verfasser sich weder durch den Geist der Zeit
noch durch die Geistreichigkeit aller Vorredner um seine
lehrhafte Ruhe und Sachlichkeit bringen läßt. Die Aus-
wahl der Bilder ist überall klug und anschaulich. Viele
kleine Sachen sind vom Verfasser selbst gezeichnet. Jeder
Band hat ein gutes Register. Und so sehen wir mit großen
Hoffnungen dem dritten Bande entgegen. Bergner.
Dosso Dossi mit besonderer Berücksichtigung seines künst-
lerischen Verhältnisses zu seinem Bruder Battista von
Walter Curt Zwanziger. Leipzig 1911. Verlag von Klink-
hardt & Biermann.
Da ich diese Arbeit zur Hand nehme, muß ich unwill-
kürlich an jenes Bild im Breslauer Museum denken, das
mir vor Jahren den Anlaß bot, den Verfasser zuerst auf
das Dossothema hinzuweisen: eine Enthauptung Johannes
des Täufers, originell und ungeschickt zugleich in der Kom-
position, fesselnd durch die Landschaft, datiert (1541) und
scheinbar bezeichnet, doch so, daß die Signatur selbst wie-
der ein schwer löslicher Rebus ist. Das Bild gilt an Ort
und Stelle seit alters als ein Battista Dossi, Curt Zwanziger
erklärt es jetzt — und wohl mit Recht — für das Erzeugnis
eines ferraresischen Eklektikers; doch das tut nichts zur
Sache, charakteristisch für das Vexierspiel, das die ganze
Dossofrage bietet, will es mir noch immer erscheinen: genau
so mit dem Reize des Geheimnisvollen, scheinbar ganz
Persönlichen fesseln uns auch sonst die Werke dieses Kreises
und necken uns doch zugleich durch ärgerliche Hemmnisse,
die sich vor die Erkenntnis der Meister selbst schieben.
Zwei Malerbrüder, in so enger Gemeinschaft tätig, sind an
sich schon eine vereinzelte Erscheinung wenigstens der
italienischen Kunstgeschichte. Die Nachrichten über ihr
Leben und noch mehr über ihre Tätigkeit so dürftig wie
möglich: Vasari versagt wohl in keinem Punkte der von
ihm selbst miterlebten Kunst so gänzlich und die ferra-
resischen Lokalforscher Baruffaldi, Cittadelia, Campori,
Laderchi geben neben offenbaren Legenden zwar einzelne
wertvolle Notizen, doch in dem wichtigsten Punkte der
Unterscheidung der Brüder nach ihren Werken, lassen sie
uns gleichfalls im Stich. Wirkt es nicht wie Hohn, wenn
die von Laderchi mitgeteilte Notiz des Chronisten Lance-
lotto über die 1536 im Dom zu Modena aufgestellte Heilige
Nacht »Fatta de mane de mr° .. . fratello de m"> Dosso,
exmo depintore« gerade den entscheidenden Namen aus-
läßt? Und welche Verwirrung mag solche unsichere Unter-
scheidung der beiden Brüder sonst noch angerichtet haben!
Zwanziger gibt darüber S. 21 f. seiner Schrift lehrreiche
Nachweise.
Doch nicht bloß die älteren Autoren haben den Dossi
übel mitgespielt, auch in der modernen Kunstgeschicht-
schreibung steht ihre Behandlung unter einem Unstern.
Morelli, der sich als Erster des Dosso Dossi annahm und
mit feinem Verständnis seine geistige Verwandtschaft mit
Ariost und den romantischen Grundcharakter seiner Kunst
betont, greift in seinen Einzelurteilen oft ganz merkwürdig
fehl. Sein barocker Einfall (Galerien Borghese und Doria
Panfili S. 278), die Aufschrift des Salbengefäßes in dem