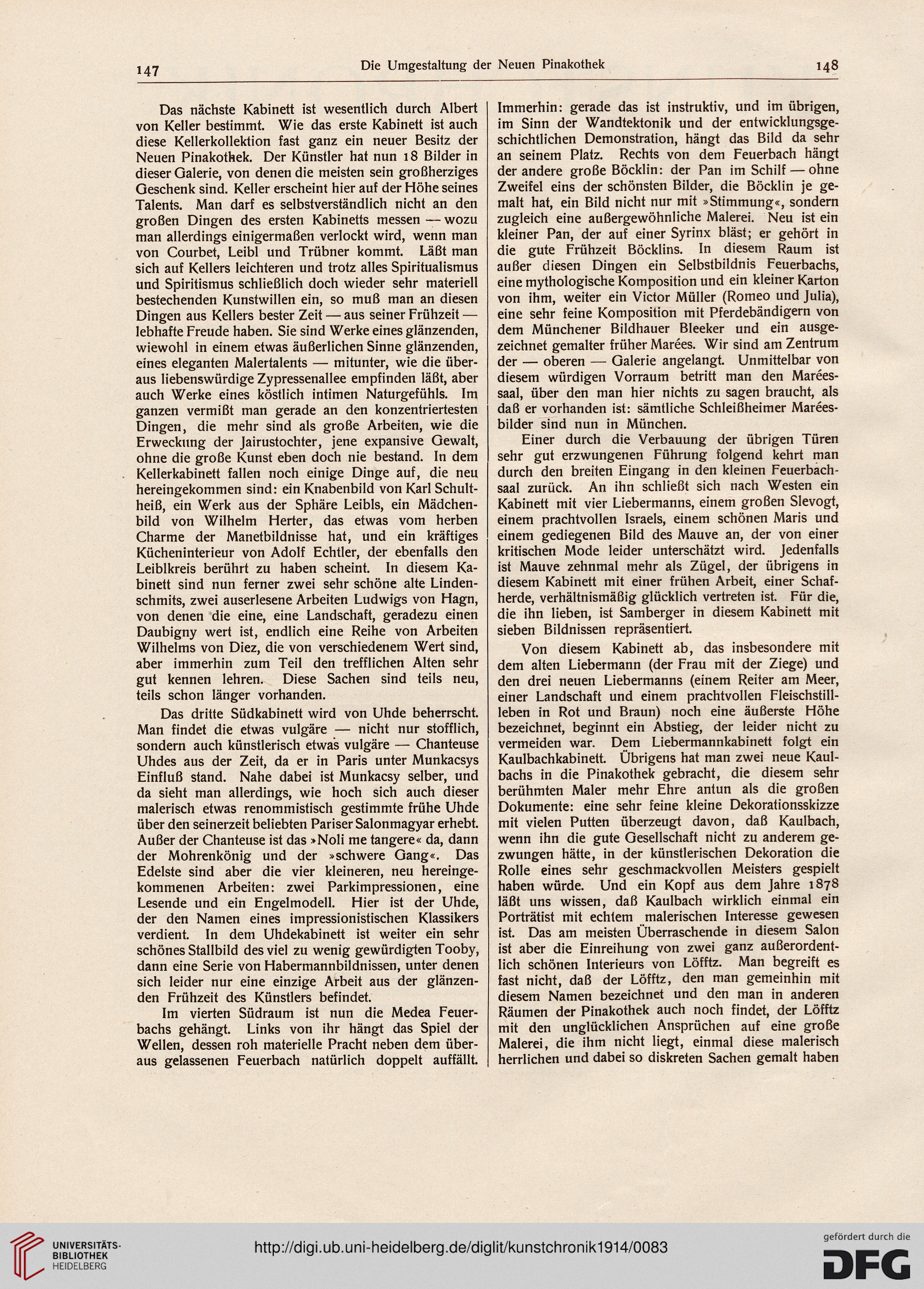147
Die Umgestaltung der Neuen Pinakothek
148
Das nächste Kabinett ist wesentlich durch Albert
von Keller bestimmt. Wie das erste Kabinett ist auch
diese Kellerkollektion fast ganz ein neuer Besitz der
Neuen Pinakothek. Der Künstler hat nun 18 Bilder in
dieser Galerie, von denen die meisten sein großherziges
Geschenk sind. Keller erscheint hier auf der Höhe seines
Talents. Man darf es selbstverständlich nicht an den
großen Dingen des ersten Kabinetts messen — wozu
man allerdings einigermaßen verlockt wird, wenn man
von Courbet, Leibi und Trübner kommt. Läßt man
sich auf Kellers leichteren und trotz alles Spiritualismus
und Spiritismus schließlich doch wieder sehr materiell
bestechenden Kunstwillen ein, so muß man an diesen
Dingen aus Kellers bester Zeit — aus seiner Frühzeit —
lebhafte Freude haben. Sie sind Werke eines glänzenden,
wiewohl in einem etwas äußerlichen Sinne glänzenden,
eines eleganten Malertalents — mitunter, wie die über-
aus liebenswürdige Zypressenallee empfinden läßt, aber
auch Werke eines köstlich intimen Naturgefühls. Im
ganzen vermißt man gerade an den konzentriertesten
Dingen, die mehr sind als große Arbeiten, wie die
Erweckung der Jairustochter, jene expansive Gewalt,
ohne die große Kunst eben doch nie bestand. In dem
Kellerkabinett fallen noch einige Dinge auf, die neu
hereingekommen sind: ein Knabenbild von Karl Schult-
heiß, ein Werk aus der Sphäre Leibis, ein Mädchen-
bild von Wilhelm Herter, das etwas vom herben
Charme der Manetbildnisse hat, und ein kräftiges
Kücheninterieur von Adolf Echtler, der ebenfalls den
Leibikreis berührt zu haben scheint. In diesem Ka-
binett sind nun ferner zwei sehr schöne alte Linden-
schmits, zwei auserlesene Arbeiten Ludwigs von Hagn,
von denen die eine, eine Landschaft, geradezu einen
Daubigny wert ist, endlich eine Reihe von Arbeiten
Wilhelms von Diez, die von verschiedenem Wert sind,
aber immerhin zum Teil den trefflichen Alten sehr
gut kennen lehren. Diese Sachen sind teils neu,
teils schon länger vorhanden.
Das dritte Südkabinett wird von Uhde beherrscht.
Man findet die etwas vulgäre — nicht nur stofflich,
sondern auch künstlerisch etwas vulgäre — Chanteuse
Uhdes aus der Zeit, da er in Paris unter Munkacsys
Einfluß stand. Nahe dabei ist Munkacsy selber, und
da sieht man allerdings, wie hoch sich auch dieser
malerisch etwas renommistisch gestimmte frühe Uhde
über den seinerzeit beliebten Pariser Salonmagyar erhebt.
Außer der Chanteuse ist das »Noli me tangere« da, dann
der Mohrenkönig und der »schwere Gang«. Das
Edelste sind aber die vier kleineren, neu hereinge-
kommenen Arbeiten: zwei Parkimpressionen, eine
Lesende und ein Engelmodell. Hier ist der Uhde,
der den Namen eines impressionistischen Klassikers
verdient. In dem Uhdekabinett ist weiter ein sehr
schönes Stallbild des viel zu wenig gewürdigten Tooby,
dann eine Serie von Habermannbildnissen, unter denen
sich leider nur eine einzige Arbeit aus der glänzen-
den Frühzeit des Künstlers befindet.
Im vierten Südraum ist nun die Medea Feuer-
bachs gehängt. Links von ihr hängt das Spiel der
Wellen, dessen roh materielle Pracht neben dem über-
aus gelassenen Feuerbach natürlich doppelt auffällt.
Immerhin: gerade das ist instruktiv, und im übrigen,
im Sinn der Wandtektonik und der entwicklungsge-
schichtlichen Demonstration, hängt das Bild da sehr
an seinem Platz. Rechts von dem Feuerbach hängt
der andere große Böcklin: der Pan im Schilf — ohne
Zweifel eins der schönsten Bilder, die Böcklin je ge-
malt hat, ein Bild nicht nur mit »Stimmung«, sondern
zugleich eine außergewöhnliche Malerei. Neu ist ein
kleiner Pan, der auf einer Syrinx bläst; er gehört in
die gute Frühzeit Böcklins. In diesem Raum ist
außer diesen Dingen ein Selbstbildnis Feuerbachs,
eine mythologische Komposition und ein kleiner Karton
von ihm, weiter ein Victor Müller (Romeo und Julia),
eine sehr feine Komposition mit Pferdebändigern von
dem Münchener Bildhauer Bleeker und ein ausge-
zeichnet gemalter früher Marees. Wir sind am Zentrum
der — oberen — Galerie angelangt. Unmittelbar von
diesem würdigen Vorraum betritt man den Marees-
saal, über den man hier nichts zu sagen braucht, als
daß er vorhanden ist: sämtliche Schleißheimer Marees-
bilder sind nun in München.
Einer durch die Verbauung der übrigen Türen
sehr gut erzwungenen Führung folgend kehrt man
durch den breiten Eingang in den kleinen Feuerbach-
saal zurück. An ihn schließt sich nach Westen ein
Kabinett mit vier Liebermanns, einem großen Slevogt,
einem prachtvollen Israels, einem schönen Maris und
einem gediegenen Bild des Mauve an, der von einer
kritischen Mode leider unterschätzt wird. Jedenfalls
ist Mauve zehnmal mehr als Zügel, der übrigens in
diesem Kabinett mit einer frühen Arbeit, einer Schaf-
herde, verhältnismäßig glücklich vertreten ist. Für die,
die ihn lieben, ist Samberger in diesem Kabinett mit
sieben Bildnissen repräsentiert.
Von diesem Kabinett ab, das insbesondere mit
dem alten Liebermann (der Frau mit der Ziege) und
den drei neuen Liebermanns (einem Reiter am Meer,
einer Landschaft und einem prachtvollen Fleischstill-
leben in Rot und Braun) noch eine äußerste Höhe
bezeichnet, beginnt ein Abstieg, der leider nicht zu
vermeiden war. Dem Liebermannkabinett folgt ein
Kaulbachkabinett. Übrigens hat man zwei neue Kaul-
bachs in die Pinakothek gebracht, die diesem sehr
berühmten Maler mehr Ehre antun als die großen
Dokumente: eine sehr feine kleine Dekorationsskizze
mit vielen Putten überzeugt davon, daß Kaulbach,
wenn ihn die gute Gesellschaft nicht zu anderem ge-
zwungen hätte, in der künstlerischen Dekoration die
Rolle eines sehr geschmackvollen Meisters gespielt
haben würde. Und ein Kopf aus dem Jahre 1878
läßt uns wissen, daß Kaulbach wirklich einmal ein
Porträtist mit echtem malerischen Interesse gewesen
ist. Das am meisten Überraschende in diesem Salon
ist aber die Einreihung von zwei ganz außerordent-
lich schönen Interieurs von Löfftz. Man begreift es
fast nicht, daß der Löfftz, den man gemeinhin mit
diesem Namen bezeichnet und den man in anderen
Räumen der Pinakothek auch noch findet, der Löfftz
mit den unglücklichen Ansprüchen auf eine große
Malerei, die ihm nicht liegt, einmal diese malerisch
herrlichen und dabei so diskreten Sachen gemalt haben
Die Umgestaltung der Neuen Pinakothek
148
Das nächste Kabinett ist wesentlich durch Albert
von Keller bestimmt. Wie das erste Kabinett ist auch
diese Kellerkollektion fast ganz ein neuer Besitz der
Neuen Pinakothek. Der Künstler hat nun 18 Bilder in
dieser Galerie, von denen die meisten sein großherziges
Geschenk sind. Keller erscheint hier auf der Höhe seines
Talents. Man darf es selbstverständlich nicht an den
großen Dingen des ersten Kabinetts messen — wozu
man allerdings einigermaßen verlockt wird, wenn man
von Courbet, Leibi und Trübner kommt. Läßt man
sich auf Kellers leichteren und trotz alles Spiritualismus
und Spiritismus schließlich doch wieder sehr materiell
bestechenden Kunstwillen ein, so muß man an diesen
Dingen aus Kellers bester Zeit — aus seiner Frühzeit —
lebhafte Freude haben. Sie sind Werke eines glänzenden,
wiewohl in einem etwas äußerlichen Sinne glänzenden,
eines eleganten Malertalents — mitunter, wie die über-
aus liebenswürdige Zypressenallee empfinden läßt, aber
auch Werke eines köstlich intimen Naturgefühls. Im
ganzen vermißt man gerade an den konzentriertesten
Dingen, die mehr sind als große Arbeiten, wie die
Erweckung der Jairustochter, jene expansive Gewalt,
ohne die große Kunst eben doch nie bestand. In dem
Kellerkabinett fallen noch einige Dinge auf, die neu
hereingekommen sind: ein Knabenbild von Karl Schult-
heiß, ein Werk aus der Sphäre Leibis, ein Mädchen-
bild von Wilhelm Herter, das etwas vom herben
Charme der Manetbildnisse hat, und ein kräftiges
Kücheninterieur von Adolf Echtler, der ebenfalls den
Leibikreis berührt zu haben scheint. In diesem Ka-
binett sind nun ferner zwei sehr schöne alte Linden-
schmits, zwei auserlesene Arbeiten Ludwigs von Hagn,
von denen die eine, eine Landschaft, geradezu einen
Daubigny wert ist, endlich eine Reihe von Arbeiten
Wilhelms von Diez, die von verschiedenem Wert sind,
aber immerhin zum Teil den trefflichen Alten sehr
gut kennen lehren. Diese Sachen sind teils neu,
teils schon länger vorhanden.
Das dritte Südkabinett wird von Uhde beherrscht.
Man findet die etwas vulgäre — nicht nur stofflich,
sondern auch künstlerisch etwas vulgäre — Chanteuse
Uhdes aus der Zeit, da er in Paris unter Munkacsys
Einfluß stand. Nahe dabei ist Munkacsy selber, und
da sieht man allerdings, wie hoch sich auch dieser
malerisch etwas renommistisch gestimmte frühe Uhde
über den seinerzeit beliebten Pariser Salonmagyar erhebt.
Außer der Chanteuse ist das »Noli me tangere« da, dann
der Mohrenkönig und der »schwere Gang«. Das
Edelste sind aber die vier kleineren, neu hereinge-
kommenen Arbeiten: zwei Parkimpressionen, eine
Lesende und ein Engelmodell. Hier ist der Uhde,
der den Namen eines impressionistischen Klassikers
verdient. In dem Uhdekabinett ist weiter ein sehr
schönes Stallbild des viel zu wenig gewürdigten Tooby,
dann eine Serie von Habermannbildnissen, unter denen
sich leider nur eine einzige Arbeit aus der glänzen-
den Frühzeit des Künstlers befindet.
Im vierten Südraum ist nun die Medea Feuer-
bachs gehängt. Links von ihr hängt das Spiel der
Wellen, dessen roh materielle Pracht neben dem über-
aus gelassenen Feuerbach natürlich doppelt auffällt.
Immerhin: gerade das ist instruktiv, und im übrigen,
im Sinn der Wandtektonik und der entwicklungsge-
schichtlichen Demonstration, hängt das Bild da sehr
an seinem Platz. Rechts von dem Feuerbach hängt
der andere große Böcklin: der Pan im Schilf — ohne
Zweifel eins der schönsten Bilder, die Böcklin je ge-
malt hat, ein Bild nicht nur mit »Stimmung«, sondern
zugleich eine außergewöhnliche Malerei. Neu ist ein
kleiner Pan, der auf einer Syrinx bläst; er gehört in
die gute Frühzeit Böcklins. In diesem Raum ist
außer diesen Dingen ein Selbstbildnis Feuerbachs,
eine mythologische Komposition und ein kleiner Karton
von ihm, weiter ein Victor Müller (Romeo und Julia),
eine sehr feine Komposition mit Pferdebändigern von
dem Münchener Bildhauer Bleeker und ein ausge-
zeichnet gemalter früher Marees. Wir sind am Zentrum
der — oberen — Galerie angelangt. Unmittelbar von
diesem würdigen Vorraum betritt man den Marees-
saal, über den man hier nichts zu sagen braucht, als
daß er vorhanden ist: sämtliche Schleißheimer Marees-
bilder sind nun in München.
Einer durch die Verbauung der übrigen Türen
sehr gut erzwungenen Führung folgend kehrt man
durch den breiten Eingang in den kleinen Feuerbach-
saal zurück. An ihn schließt sich nach Westen ein
Kabinett mit vier Liebermanns, einem großen Slevogt,
einem prachtvollen Israels, einem schönen Maris und
einem gediegenen Bild des Mauve an, der von einer
kritischen Mode leider unterschätzt wird. Jedenfalls
ist Mauve zehnmal mehr als Zügel, der übrigens in
diesem Kabinett mit einer frühen Arbeit, einer Schaf-
herde, verhältnismäßig glücklich vertreten ist. Für die,
die ihn lieben, ist Samberger in diesem Kabinett mit
sieben Bildnissen repräsentiert.
Von diesem Kabinett ab, das insbesondere mit
dem alten Liebermann (der Frau mit der Ziege) und
den drei neuen Liebermanns (einem Reiter am Meer,
einer Landschaft und einem prachtvollen Fleischstill-
leben in Rot und Braun) noch eine äußerste Höhe
bezeichnet, beginnt ein Abstieg, der leider nicht zu
vermeiden war. Dem Liebermannkabinett folgt ein
Kaulbachkabinett. Übrigens hat man zwei neue Kaul-
bachs in die Pinakothek gebracht, die diesem sehr
berühmten Maler mehr Ehre antun als die großen
Dokumente: eine sehr feine kleine Dekorationsskizze
mit vielen Putten überzeugt davon, daß Kaulbach,
wenn ihn die gute Gesellschaft nicht zu anderem ge-
zwungen hätte, in der künstlerischen Dekoration die
Rolle eines sehr geschmackvollen Meisters gespielt
haben würde. Und ein Kopf aus dem Jahre 1878
läßt uns wissen, daß Kaulbach wirklich einmal ein
Porträtist mit echtem malerischen Interesse gewesen
ist. Das am meisten Überraschende in diesem Salon
ist aber die Einreihung von zwei ganz außerordent-
lich schönen Interieurs von Löfftz. Man begreift es
fast nicht, daß der Löfftz, den man gemeinhin mit
diesem Namen bezeichnet und den man in anderen
Räumen der Pinakothek auch noch findet, der Löfftz
mit den unglücklichen Ansprüchen auf eine große
Malerei, die ihm nicht liegt, einmal diese malerisch
herrlichen und dabei so diskreten Sachen gemalt haben