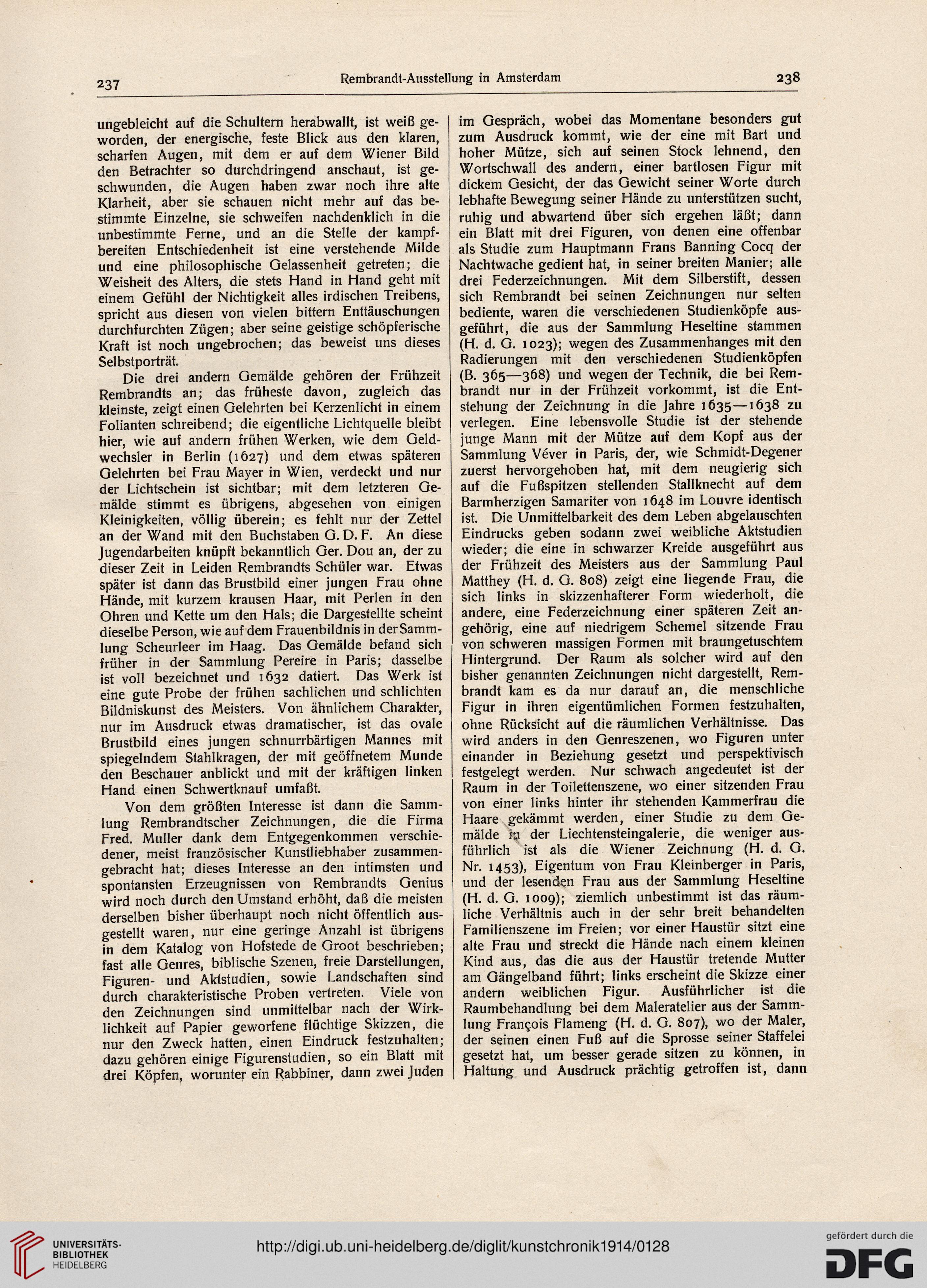237
Rembrandt-Ausstellung in Amsterdam
238
ungebleicht auf die Schultern herabwallt, ist weiß ge-
worden, der energische, feste Blick aus den klaren,
scharfen Augen, mit dem er auf dem Wiener Bild
den Betrachter so durchdringend anschaut, ist ge-
schwunden, die Augen haben zwar noch ihre alte
Klarheit, aber sie schauen nicht mehr auf das be-
stimmte Einzelne, sie schweifen nachdenklich in die
unbestimmte Ferne, und an die Stelle der kampf-
bereiten Entschiedenheit ist eine verstehende Milde
und eine philosophische Gelassenheit getreten; die
Weisheit des Alters, die stets Hand in Hand geht mit
einem Gefühl der Nichtigkeit alles irdischen Treibens,
spricht aus diesen von vielen bittern Enttäuschungen
durchfurchten Zügen; aber seine geistige schöpferische
Kraft ist noch ungebrochen; das beweist uns dieses
Selbstporträt.
Die drei andern Gemälde gehören der Frühzeit
Rembrandts an; das früheste davon, zugleich das
kleinste, zeigt einen Gelehrten bei Kerzenlicht in einem
Folianten schreibend; die eigentliche Lichtquelle bleibt
hier, wie auf andern frühen Werken, wie dem Geld-
wechsler in Berlin (1627) und dem etwas späteren
Gelehrten bei Frau Mayer in Wien, verdeckt und nur
der Lichtschein ist sichtbar; mit dem letzteren Ge-
mälde stimmt es übrigens, abgesehen von einigen
Kleinigkeiten, völlig überein; es fehlt nur der Zettel
an der Wand mit den Buchstaben G. D. F. An diese
Jugendarbeiten knüpft bekanntlich Ger. Dou an, der zu
dieser Zeit in Leiden Rembrandts Schüler war. Etwas
später ist dann das Brustbild einer jungen Frau ohne
Hände, mit kurzem krausen Haar, mit Perlen in den
Ohren und Kette um den Hals; die Dargestellte scheint
dieselbe Person, wie auf dem Frauenbildnis in der Samm-
lung Scheurleer im Haag. Das Gemälde befand sich
früher in der Sammlung Pereire in Paris; dasselbe
ist voll bezeichnet und 1632 datiert. Das Werk ist
eine gute Probe der frühen sachlichen und schlichten
Bildniskunst des Meisters. Von ähnlichem Charakter,
nur im Ausdruck etwas dramatischer, ist das ovale
Brustbild eines jungen schnurrbärtigen Mannes mit
spiegelndem Stahlkragen, der mit geöffnetem Munde
den Beschauer anblickt und mit der kräftigen linken
Hand einen Schwertknauf umfaßt.
Von dem größten Interesse ist dann die Samm-
lung Rembrandtscher Zeichnungen, die die Firma
Fred. Muller dank dem Entgegenkommen verschie-
dener, meist französischer Kunstliebhaber zusammen-
gebracht hat; dieses Interesse an den intimsten und
spontansten Erzeugnissen von Rembrandts Genius
wird noch durch den Umstand erhöht, daß die meisten
derselben bisher überhaupt noch nicht öffentlich aus-
gestellt waren, nur eine geringe Anzahl ist übrigens
in dem Katalog von Hofstede de Groot beschrieben;
fast alle Genres, biblische Szenen, freie Darstellungen,
Figuren- und Aktstudien, sowie Landschaften sind
durch charakteristische Proben vertreten. Viele von
den Zeichnungen sind unmittelbar nach der Wirk-
lichkeit auf Papier geworfene flüchtige Skizzen, die
nur den Zweck hatten, einen Eindruck festzuhalten;
dazu gehören einige Figurenstudien, so ein Blatt mit
drei Köpfen, worunter ein Rabbiner, dann zwei Juden
im Gespräch, wobei das Momentane besonders gut
zum Ausdruck kommt, wie der eine mit Bart und
hoher Mütze, sich auf seinen Stock lehnend, den
Wortschwall des andern, einer bartlosen Figur mit
dickem Gesicht, der das Gewicht seiner Worte durch
lebhafte Bewegung seiner Hände zu unterstützen sucht,
ruhig und abwartend über sich ergehen läßt; dann
ein Blatt mit drei Figuren, von denen eine offenbar
als Studie zum Hauptmann Frans Banning Cocq der
Nachtwache gedient hat, in seiner breiten Manier; alle
drei Federzeichnungen. Mit dem Silberstift, dessen
sich Rembrandt bei seinen Zeichnungen nur selten
bediente, waren die verschiedenen Studienköpfe aus-
geführt, die aus der Sammlung Heseltine stammen
(H. d. G. 1023); wegen des Zusammenhanges mit den
Radierungen mit den verschiedenen Studienköpfen
(B. 365—368) und wegen der Technik, die bei Rem-
brandt nur in der Frühzeit vorkommt, ist die Ent-
stehung der Zeichnung in die Jahre 1635—1638 zu
verlegen. Eine lebensvolle Studie ist der stehende
junge Mann mit der Mütze auf dem Kopf aus der
Sammlung Vever in Paris, der, wie Schmidt-Degener
zuerst hervorgehoben hat, mit dem neugierig sich
auf die Fußspitzen stellenden Stallknecht auf dem
Barmherzigen Samariter von 1648 im Louvre identisch
ist. Die Unmittelbarkeit des dem Leben abgelauschten
Eindrucks geben sodann zwei weibliche Aktstudien
wieder; die eine in schwarzer Kreide ausgeführt aus
der Frühzeit des Meisters aus der Sammlung Paul
Matthey (H. d. G. 808) zeigt eine liegende Frau, die
sich links in skizzenhafterer Form wiederholt, die
andere, eine Federzeichnung einer späteren Zeit an-
gehörig, eine auf niedrigem Schemel sitzende Frau
von schweren massigen Formen mit braungetuschtem
Hintergrund. Der Raum als solcher wird auf den
bisher genannten Zeichnungen nicht dargestellt, Rem-
brandt kam es da nur darauf an, die menschliche
Figur in ihren eigentümlichen Formen festzuhalten,
ohne Rücksicht auf die räumlichen Verhältnisse. Das
wird anders in den Genreszenen, wo Figuren unter
einander in Beziehung gesetzt und perspektivisch
festgelegt werden. Nur schwach angedeutet ist der
Raum in der Toilettenszene, wo einer sitzenden Frau
von einer links hinter ihr stehenden Kammerfrau die
Haare gekämmt werden, einer Studie zu dem Ge-
mälde der Liechtensteingalerie, die weniger aus-
führlich ist als die Wiener Zeichnung (H. d. G.
Nr. 1453)1 Eigentum von Frau Kleinberger in Paris,
und der lesenden Frau aus der Sammlung Heseltine
(H. d. G. 1009); ziemlich unbestimmt ist das räum-
liche Verhältnis auch in der sehr breit behandelten
Familienszene im Freien; vor einer Haustür sitzt eine
alte Frau und streckt die Hände nach einem kleinen
Kind aus, das die aus der Haustür tretende Mutter
am Gängelband führt; links erscheint die Skizze einer
andern weiblichen Figur. Ausführlicher ist die
Raumbehandlung bei dem Maleratelier aus der Samm-
lung Francois Flameng (H. d. G. 807), wo der Maler,
der seinen einen Fuß auf die Sprosse seiner Staffelei
gesetzt hat, um besser gerade sitzen zu können, in
Haltung und Ausdruck prächtig getroffen ist, dann
Rembrandt-Ausstellung in Amsterdam
238
ungebleicht auf die Schultern herabwallt, ist weiß ge-
worden, der energische, feste Blick aus den klaren,
scharfen Augen, mit dem er auf dem Wiener Bild
den Betrachter so durchdringend anschaut, ist ge-
schwunden, die Augen haben zwar noch ihre alte
Klarheit, aber sie schauen nicht mehr auf das be-
stimmte Einzelne, sie schweifen nachdenklich in die
unbestimmte Ferne, und an die Stelle der kampf-
bereiten Entschiedenheit ist eine verstehende Milde
und eine philosophische Gelassenheit getreten; die
Weisheit des Alters, die stets Hand in Hand geht mit
einem Gefühl der Nichtigkeit alles irdischen Treibens,
spricht aus diesen von vielen bittern Enttäuschungen
durchfurchten Zügen; aber seine geistige schöpferische
Kraft ist noch ungebrochen; das beweist uns dieses
Selbstporträt.
Die drei andern Gemälde gehören der Frühzeit
Rembrandts an; das früheste davon, zugleich das
kleinste, zeigt einen Gelehrten bei Kerzenlicht in einem
Folianten schreibend; die eigentliche Lichtquelle bleibt
hier, wie auf andern frühen Werken, wie dem Geld-
wechsler in Berlin (1627) und dem etwas späteren
Gelehrten bei Frau Mayer in Wien, verdeckt und nur
der Lichtschein ist sichtbar; mit dem letzteren Ge-
mälde stimmt es übrigens, abgesehen von einigen
Kleinigkeiten, völlig überein; es fehlt nur der Zettel
an der Wand mit den Buchstaben G. D. F. An diese
Jugendarbeiten knüpft bekanntlich Ger. Dou an, der zu
dieser Zeit in Leiden Rembrandts Schüler war. Etwas
später ist dann das Brustbild einer jungen Frau ohne
Hände, mit kurzem krausen Haar, mit Perlen in den
Ohren und Kette um den Hals; die Dargestellte scheint
dieselbe Person, wie auf dem Frauenbildnis in der Samm-
lung Scheurleer im Haag. Das Gemälde befand sich
früher in der Sammlung Pereire in Paris; dasselbe
ist voll bezeichnet und 1632 datiert. Das Werk ist
eine gute Probe der frühen sachlichen und schlichten
Bildniskunst des Meisters. Von ähnlichem Charakter,
nur im Ausdruck etwas dramatischer, ist das ovale
Brustbild eines jungen schnurrbärtigen Mannes mit
spiegelndem Stahlkragen, der mit geöffnetem Munde
den Beschauer anblickt und mit der kräftigen linken
Hand einen Schwertknauf umfaßt.
Von dem größten Interesse ist dann die Samm-
lung Rembrandtscher Zeichnungen, die die Firma
Fred. Muller dank dem Entgegenkommen verschie-
dener, meist französischer Kunstliebhaber zusammen-
gebracht hat; dieses Interesse an den intimsten und
spontansten Erzeugnissen von Rembrandts Genius
wird noch durch den Umstand erhöht, daß die meisten
derselben bisher überhaupt noch nicht öffentlich aus-
gestellt waren, nur eine geringe Anzahl ist übrigens
in dem Katalog von Hofstede de Groot beschrieben;
fast alle Genres, biblische Szenen, freie Darstellungen,
Figuren- und Aktstudien, sowie Landschaften sind
durch charakteristische Proben vertreten. Viele von
den Zeichnungen sind unmittelbar nach der Wirk-
lichkeit auf Papier geworfene flüchtige Skizzen, die
nur den Zweck hatten, einen Eindruck festzuhalten;
dazu gehören einige Figurenstudien, so ein Blatt mit
drei Köpfen, worunter ein Rabbiner, dann zwei Juden
im Gespräch, wobei das Momentane besonders gut
zum Ausdruck kommt, wie der eine mit Bart und
hoher Mütze, sich auf seinen Stock lehnend, den
Wortschwall des andern, einer bartlosen Figur mit
dickem Gesicht, der das Gewicht seiner Worte durch
lebhafte Bewegung seiner Hände zu unterstützen sucht,
ruhig und abwartend über sich ergehen läßt; dann
ein Blatt mit drei Figuren, von denen eine offenbar
als Studie zum Hauptmann Frans Banning Cocq der
Nachtwache gedient hat, in seiner breiten Manier; alle
drei Federzeichnungen. Mit dem Silberstift, dessen
sich Rembrandt bei seinen Zeichnungen nur selten
bediente, waren die verschiedenen Studienköpfe aus-
geführt, die aus der Sammlung Heseltine stammen
(H. d. G. 1023); wegen des Zusammenhanges mit den
Radierungen mit den verschiedenen Studienköpfen
(B. 365—368) und wegen der Technik, die bei Rem-
brandt nur in der Frühzeit vorkommt, ist die Ent-
stehung der Zeichnung in die Jahre 1635—1638 zu
verlegen. Eine lebensvolle Studie ist der stehende
junge Mann mit der Mütze auf dem Kopf aus der
Sammlung Vever in Paris, der, wie Schmidt-Degener
zuerst hervorgehoben hat, mit dem neugierig sich
auf die Fußspitzen stellenden Stallknecht auf dem
Barmherzigen Samariter von 1648 im Louvre identisch
ist. Die Unmittelbarkeit des dem Leben abgelauschten
Eindrucks geben sodann zwei weibliche Aktstudien
wieder; die eine in schwarzer Kreide ausgeführt aus
der Frühzeit des Meisters aus der Sammlung Paul
Matthey (H. d. G. 808) zeigt eine liegende Frau, die
sich links in skizzenhafterer Form wiederholt, die
andere, eine Federzeichnung einer späteren Zeit an-
gehörig, eine auf niedrigem Schemel sitzende Frau
von schweren massigen Formen mit braungetuschtem
Hintergrund. Der Raum als solcher wird auf den
bisher genannten Zeichnungen nicht dargestellt, Rem-
brandt kam es da nur darauf an, die menschliche
Figur in ihren eigentümlichen Formen festzuhalten,
ohne Rücksicht auf die räumlichen Verhältnisse. Das
wird anders in den Genreszenen, wo Figuren unter
einander in Beziehung gesetzt und perspektivisch
festgelegt werden. Nur schwach angedeutet ist der
Raum in der Toilettenszene, wo einer sitzenden Frau
von einer links hinter ihr stehenden Kammerfrau die
Haare gekämmt werden, einer Studie zu dem Ge-
mälde der Liechtensteingalerie, die weniger aus-
führlich ist als die Wiener Zeichnung (H. d. G.
Nr. 1453)1 Eigentum von Frau Kleinberger in Paris,
und der lesenden Frau aus der Sammlung Heseltine
(H. d. G. 1009); ziemlich unbestimmt ist das räum-
liche Verhältnis auch in der sehr breit behandelten
Familienszene im Freien; vor einer Haustür sitzt eine
alte Frau und streckt die Hände nach einem kleinen
Kind aus, das die aus der Haustür tretende Mutter
am Gängelband führt; links erscheint die Skizze einer
andern weiblichen Figur. Ausführlicher ist die
Raumbehandlung bei dem Maleratelier aus der Samm-
lung Francois Flameng (H. d. G. 807), wo der Maler,
der seinen einen Fuß auf die Sprosse seiner Staffelei
gesetzt hat, um besser gerade sitzen zu können, in
Haltung und Ausdruck prächtig getroffen ist, dann