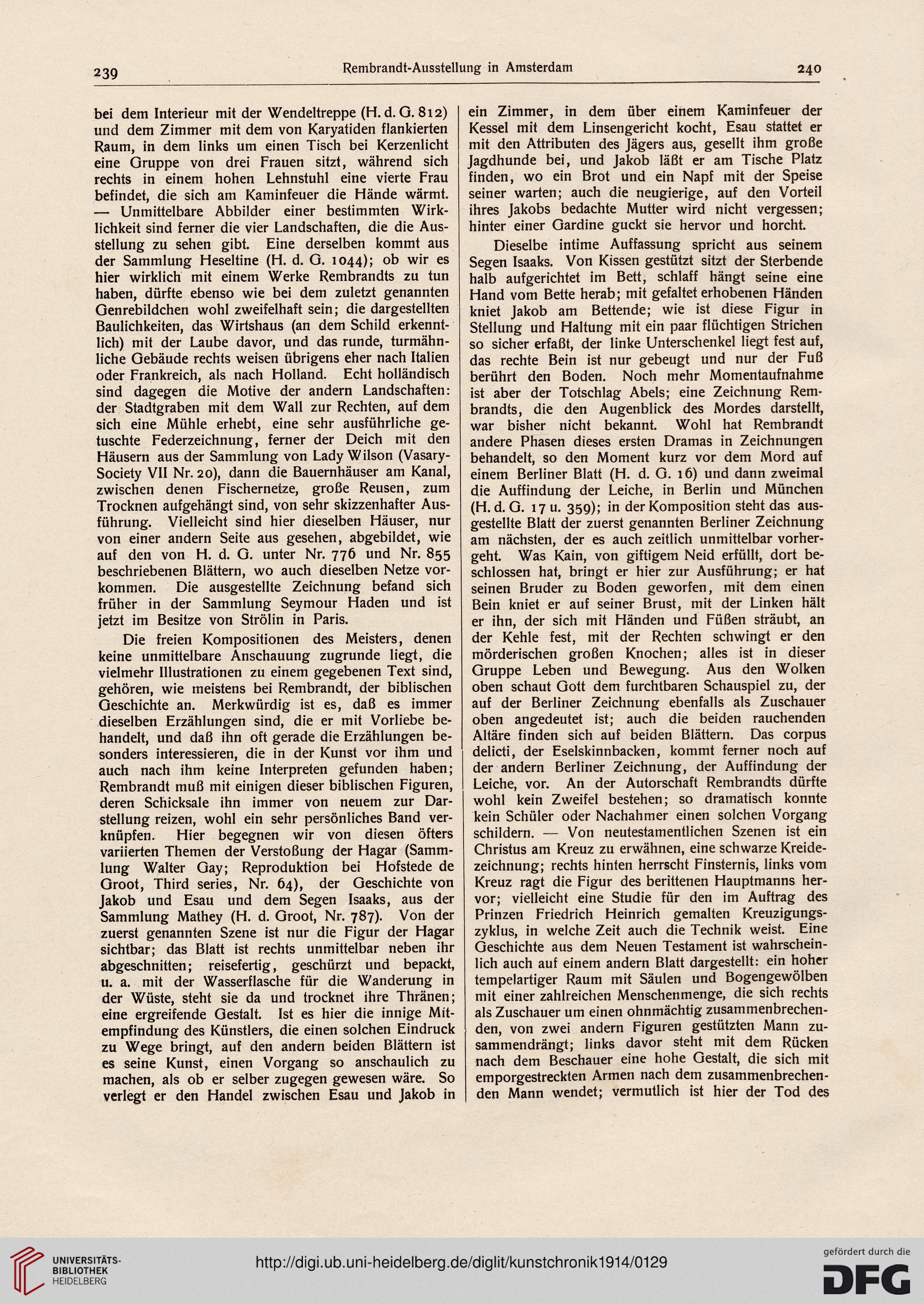239
Rembrandt-Ausstellung in Amsterdam
240
bei dem Interieur mit der Wendeltreppe (H. d. G. 812)
und dem Zimmer mit dem von Karyatiden flankierten
Raum, in dem links um einen Tisch bei Kerzenlicht
eine Gruppe von drei Frauen sitzt, während sich
rechts in einem hohen Lehnstuhl eine vierte Frau
befindet, die sich am Kaminfeuer die Hände wärmt.
— Unmittelbare Abbilder einer bestimmten Wirk-
lichkeit sind ferner die vier Landschaften, die die Aus-
stellung zu sehen gibt. Eine derselben kommt aus
der Sammlung Heseltine (H. d. G. 1044); ob wir es
hier wirklich mit einem Werke Rembrandts zu tun
haben, dürfte ebenso wie bei dem zuletzt genannten
Genrebildchen wohl zweifelhaft sein; die dargestellten
Baulichkeiten, das Wirtshaus (an dem Schild erkennt-
lich) mit der Laube davor, und das runde, turmähn-
liche Gebäude rechts weisen übrigens eher nach Italien
oder Frankreich, als nach Holland. Echt holländisch
sind dagegen die Motive der andern Landschaften:
der Stadtgraben mit dem Wall zur Rechten, auf dem
sich eine Mühle erhebt, eine sehr ausführliche ge-
tuschte Federzeichnung, ferner der Deich mit den
Häusern aus der Sammlung von Lady Wilson (Vasary-
Society VII Nr. 20), dann die Bauernhäuser am Kanal,
zwischen denen Fischernetze, große Reusen, zum
Trocknen aufgehängt sind, von sehr skizzenhafter Aus-
führung. Vielleicht sind hier dieselben Häuser, nur
von einer andern Seite aus gesehen, abgebildet, wie
auf den von H. d. G. unter Nr. 776 und Nr. 855
beschriebenen Blättern, wo auch dieselben Netze vor-
kommen. Die ausgestellte Zeichnung befand sich
früher in der Sammlung Seymour Haden und ist
jetzt im Besitze von Ströhn in Paris.
Die freien Kompositionen des Meisters, denen
keine unmittelbare Anschauung zugrunde liegt, die
vielmehr Illustrationen zu einem gegebenen Text sind,
gehören, wie meistens bei Rembrandt, der biblischen
Geschichte an. Merkwürdig ist es, daß es immer
dieselben Erzählungen sind, die er mit Vorliebe be-
handelt, und daß ihn oft gerade die Erzählungen be-
sonders interessieren, die in der Kunst vor ihm und
auch nach ihm keine Interpreten gefunden haben;
Rembrandt muß mit einigen dieser biblischen Figuren,
deren Schicksale ihn immer von neuem zur Dar-
stellung reizen, wohl ein sehr persönliches Band ver-
knüpfen. Hier begegnen wir von diesen öfters
variierten Themen der Verstoßung der Hagar (Samm-
lung Walter Gay; Reproduktion bei Hofstede de
Groot, Third series, Nr. 64), der Geschichte von
Jakob und Esau und dem Segen Isaaks, aus der
Sammlung Mathey (H. d. Groot, Nr. 787). Von der
zuerst genannten Szene ist nur die Figur der Hagar
sichtbar; das Blatt ist rechts unmittelbar neben ihr
abgeschnitten; reisefertig, geschürzt und bepackt,
u. a. mit der Wasserflasche für die Wanderung in
der Wüste, steht sie da und trocknet ihre Thränen;
eine ergreifende Gestalt. Ist es hier die innige Mit-
empfindung des Künstlers, die einen solchen Eindruck
zu Wege bringt, auf den andern beiden Blättern ist
es seine Kunst, einen Vorgang so anschaulich zu
machen, als ob er selber zugegen gewesen wäre. So
verlegt er den Handel zwischen Esau und Jakob in
ein Zimmer, in dem über einem Kaminfeuer der
Kessel mit dem Linsengericht kocht, Esau stattet er
mit den Attributen des Jägers aus, gesellt ihm große
Jagdhunde bei, und Jakob läßt er am Tische Platz
finden, wo ein Brot und ein Napf mit der Speise
seiner warten; auch die neugierige, auf den Vorteil
ihres Jakobs bedachte Mutter wird nicht vergessen;
hinter einer Gardine guckt sie hervor und horcht.
Dieselbe intime Auffassung spricht aus seinem
Segen Isaaks. Von Kissen gestützt sitzt der Sterbende
halb aufgerichtet im Bett, schlaff hängt seine eine
Hand vom Bette herab; mit gefaltet erhobenen Händen
kniet Jakob am Bettende; wie ist diese Figur in
Stellung und Haltung mit ein paar flüchtigen Strichen
so sicher erfaßt, der linke Unterschenkel liegt fest auf,
das rechte Bein ist nur gebeugt und nur der Fuß
berührt den Boden. Noch mehr Momentaufnahme
ist aber der Totschlag Abels; eine Zeichnung Rem-
brandts, die den Augenblick des Mordes darstellt,
war bisher nicht bekannt. Wohl hat Rembrandt
andere Phasen dieses ersten Dramas in Zeichnungen
behandelt, so den Moment kurz vor dem Mord auf
einem Berliner Blatt (H. d. G. 16) und dann zweimal
die Auffindung der Leiche, in Berlin und München
(H. d. G. 17U. 359); in der Komposition steht das aus-
gestellte Blatt der zuerst genannten Berliner Zeichnung
am nächsten, der es auch zeitlich unmittelbar vorher-
geht. Was Kain, von giftigem Neid erfüllt, dort be-
schlossen hat, bringt er hier zur Ausführung; er hat
seinen Bruder zu Boden geworfen, mit dem einen
Bein kniet er auf seiner Brust, mit der Linken hält
er ihn, der sich mit Händen und Füßen sträubt, an
der Kehle fest, mit der Rechten schwingt er den
mörderischen großen Knochen; alles ist in dieser
Gruppe Leben und Bewegung. Aus den Wolken
oben schaut Gott dem furchtbaren Schauspiel zu, der
auf der Berliner Zeichnung ebenfalls als Zuschauer
oben angedeutet ist; auch die beiden rauchenden
Altäre finden sich auf beiden Blättern. Das corpus
delicti, der Eselskinnbacken, kommt ferner noch auf
der andern Berliner Zeichnung, der Auffindung der
Leiche, vor. An der Autorschaft Rembrandts dürfte
wohl kein Zweifel bestehen; so dramatisch konnte
kein Schüler oder Nachahmer einen solchen Vorgang
schildern. — Von neutestamentlichen Szenen ist ein
Christus am Kreuz zu erwähnen, eine schwarze Kreide-
zeichnung; rechts hinten herrscht Finsternis, links vom
Kreuz ragt die Figur des berittenen Hauptmanns her-
vor; vielleicht eine Studie für den im Auftrag des
Prinzen Friedrich Heinrich gemalten Kreuzigungs-
zyklus, in welche Zeit auch die Technik weist. Eine
Geschichte aus dem Neuen Testament ist wahrschein-
lich auch auf einem andern Blatt dargestellt: ein hoher
tempelartiger Raum mit Säulen und Bogengewölben
mit einer zahlreichen Menschenmenge, die sich rechts
als Zuschauer um einen ohnmächtig zusammenbrechen-
den, von zwei andern Figuren gestützten Mann zu-
sammendrängt; links davor steht mit dem Rücken
nach dem Beschauer eine hohe Gestalt, die sich mit
emporgestreckten Armen nach dem zusammenbrechen-
den Mann wendet; vermutlich ist hier der Tod des
Rembrandt-Ausstellung in Amsterdam
240
bei dem Interieur mit der Wendeltreppe (H. d. G. 812)
und dem Zimmer mit dem von Karyatiden flankierten
Raum, in dem links um einen Tisch bei Kerzenlicht
eine Gruppe von drei Frauen sitzt, während sich
rechts in einem hohen Lehnstuhl eine vierte Frau
befindet, die sich am Kaminfeuer die Hände wärmt.
— Unmittelbare Abbilder einer bestimmten Wirk-
lichkeit sind ferner die vier Landschaften, die die Aus-
stellung zu sehen gibt. Eine derselben kommt aus
der Sammlung Heseltine (H. d. G. 1044); ob wir es
hier wirklich mit einem Werke Rembrandts zu tun
haben, dürfte ebenso wie bei dem zuletzt genannten
Genrebildchen wohl zweifelhaft sein; die dargestellten
Baulichkeiten, das Wirtshaus (an dem Schild erkennt-
lich) mit der Laube davor, und das runde, turmähn-
liche Gebäude rechts weisen übrigens eher nach Italien
oder Frankreich, als nach Holland. Echt holländisch
sind dagegen die Motive der andern Landschaften:
der Stadtgraben mit dem Wall zur Rechten, auf dem
sich eine Mühle erhebt, eine sehr ausführliche ge-
tuschte Federzeichnung, ferner der Deich mit den
Häusern aus der Sammlung von Lady Wilson (Vasary-
Society VII Nr. 20), dann die Bauernhäuser am Kanal,
zwischen denen Fischernetze, große Reusen, zum
Trocknen aufgehängt sind, von sehr skizzenhafter Aus-
führung. Vielleicht sind hier dieselben Häuser, nur
von einer andern Seite aus gesehen, abgebildet, wie
auf den von H. d. G. unter Nr. 776 und Nr. 855
beschriebenen Blättern, wo auch dieselben Netze vor-
kommen. Die ausgestellte Zeichnung befand sich
früher in der Sammlung Seymour Haden und ist
jetzt im Besitze von Ströhn in Paris.
Die freien Kompositionen des Meisters, denen
keine unmittelbare Anschauung zugrunde liegt, die
vielmehr Illustrationen zu einem gegebenen Text sind,
gehören, wie meistens bei Rembrandt, der biblischen
Geschichte an. Merkwürdig ist es, daß es immer
dieselben Erzählungen sind, die er mit Vorliebe be-
handelt, und daß ihn oft gerade die Erzählungen be-
sonders interessieren, die in der Kunst vor ihm und
auch nach ihm keine Interpreten gefunden haben;
Rembrandt muß mit einigen dieser biblischen Figuren,
deren Schicksale ihn immer von neuem zur Dar-
stellung reizen, wohl ein sehr persönliches Band ver-
knüpfen. Hier begegnen wir von diesen öfters
variierten Themen der Verstoßung der Hagar (Samm-
lung Walter Gay; Reproduktion bei Hofstede de
Groot, Third series, Nr. 64), der Geschichte von
Jakob und Esau und dem Segen Isaaks, aus der
Sammlung Mathey (H. d. Groot, Nr. 787). Von der
zuerst genannten Szene ist nur die Figur der Hagar
sichtbar; das Blatt ist rechts unmittelbar neben ihr
abgeschnitten; reisefertig, geschürzt und bepackt,
u. a. mit der Wasserflasche für die Wanderung in
der Wüste, steht sie da und trocknet ihre Thränen;
eine ergreifende Gestalt. Ist es hier die innige Mit-
empfindung des Künstlers, die einen solchen Eindruck
zu Wege bringt, auf den andern beiden Blättern ist
es seine Kunst, einen Vorgang so anschaulich zu
machen, als ob er selber zugegen gewesen wäre. So
verlegt er den Handel zwischen Esau und Jakob in
ein Zimmer, in dem über einem Kaminfeuer der
Kessel mit dem Linsengericht kocht, Esau stattet er
mit den Attributen des Jägers aus, gesellt ihm große
Jagdhunde bei, und Jakob läßt er am Tische Platz
finden, wo ein Brot und ein Napf mit der Speise
seiner warten; auch die neugierige, auf den Vorteil
ihres Jakobs bedachte Mutter wird nicht vergessen;
hinter einer Gardine guckt sie hervor und horcht.
Dieselbe intime Auffassung spricht aus seinem
Segen Isaaks. Von Kissen gestützt sitzt der Sterbende
halb aufgerichtet im Bett, schlaff hängt seine eine
Hand vom Bette herab; mit gefaltet erhobenen Händen
kniet Jakob am Bettende; wie ist diese Figur in
Stellung und Haltung mit ein paar flüchtigen Strichen
so sicher erfaßt, der linke Unterschenkel liegt fest auf,
das rechte Bein ist nur gebeugt und nur der Fuß
berührt den Boden. Noch mehr Momentaufnahme
ist aber der Totschlag Abels; eine Zeichnung Rem-
brandts, die den Augenblick des Mordes darstellt,
war bisher nicht bekannt. Wohl hat Rembrandt
andere Phasen dieses ersten Dramas in Zeichnungen
behandelt, so den Moment kurz vor dem Mord auf
einem Berliner Blatt (H. d. G. 16) und dann zweimal
die Auffindung der Leiche, in Berlin und München
(H. d. G. 17U. 359); in der Komposition steht das aus-
gestellte Blatt der zuerst genannten Berliner Zeichnung
am nächsten, der es auch zeitlich unmittelbar vorher-
geht. Was Kain, von giftigem Neid erfüllt, dort be-
schlossen hat, bringt er hier zur Ausführung; er hat
seinen Bruder zu Boden geworfen, mit dem einen
Bein kniet er auf seiner Brust, mit der Linken hält
er ihn, der sich mit Händen und Füßen sträubt, an
der Kehle fest, mit der Rechten schwingt er den
mörderischen großen Knochen; alles ist in dieser
Gruppe Leben und Bewegung. Aus den Wolken
oben schaut Gott dem furchtbaren Schauspiel zu, der
auf der Berliner Zeichnung ebenfalls als Zuschauer
oben angedeutet ist; auch die beiden rauchenden
Altäre finden sich auf beiden Blättern. Das corpus
delicti, der Eselskinnbacken, kommt ferner noch auf
der andern Berliner Zeichnung, der Auffindung der
Leiche, vor. An der Autorschaft Rembrandts dürfte
wohl kein Zweifel bestehen; so dramatisch konnte
kein Schüler oder Nachahmer einen solchen Vorgang
schildern. — Von neutestamentlichen Szenen ist ein
Christus am Kreuz zu erwähnen, eine schwarze Kreide-
zeichnung; rechts hinten herrscht Finsternis, links vom
Kreuz ragt die Figur des berittenen Hauptmanns her-
vor; vielleicht eine Studie für den im Auftrag des
Prinzen Friedrich Heinrich gemalten Kreuzigungs-
zyklus, in welche Zeit auch die Technik weist. Eine
Geschichte aus dem Neuen Testament ist wahrschein-
lich auch auf einem andern Blatt dargestellt: ein hoher
tempelartiger Raum mit Säulen und Bogengewölben
mit einer zahlreichen Menschenmenge, die sich rechts
als Zuschauer um einen ohnmächtig zusammenbrechen-
den, von zwei andern Figuren gestützten Mann zu-
sammendrängt; links davor steht mit dem Rücken
nach dem Beschauer eine hohe Gestalt, die sich mit
emporgestreckten Armen nach dem zusammenbrechen-
den Mann wendet; vermutlich ist hier der Tod des