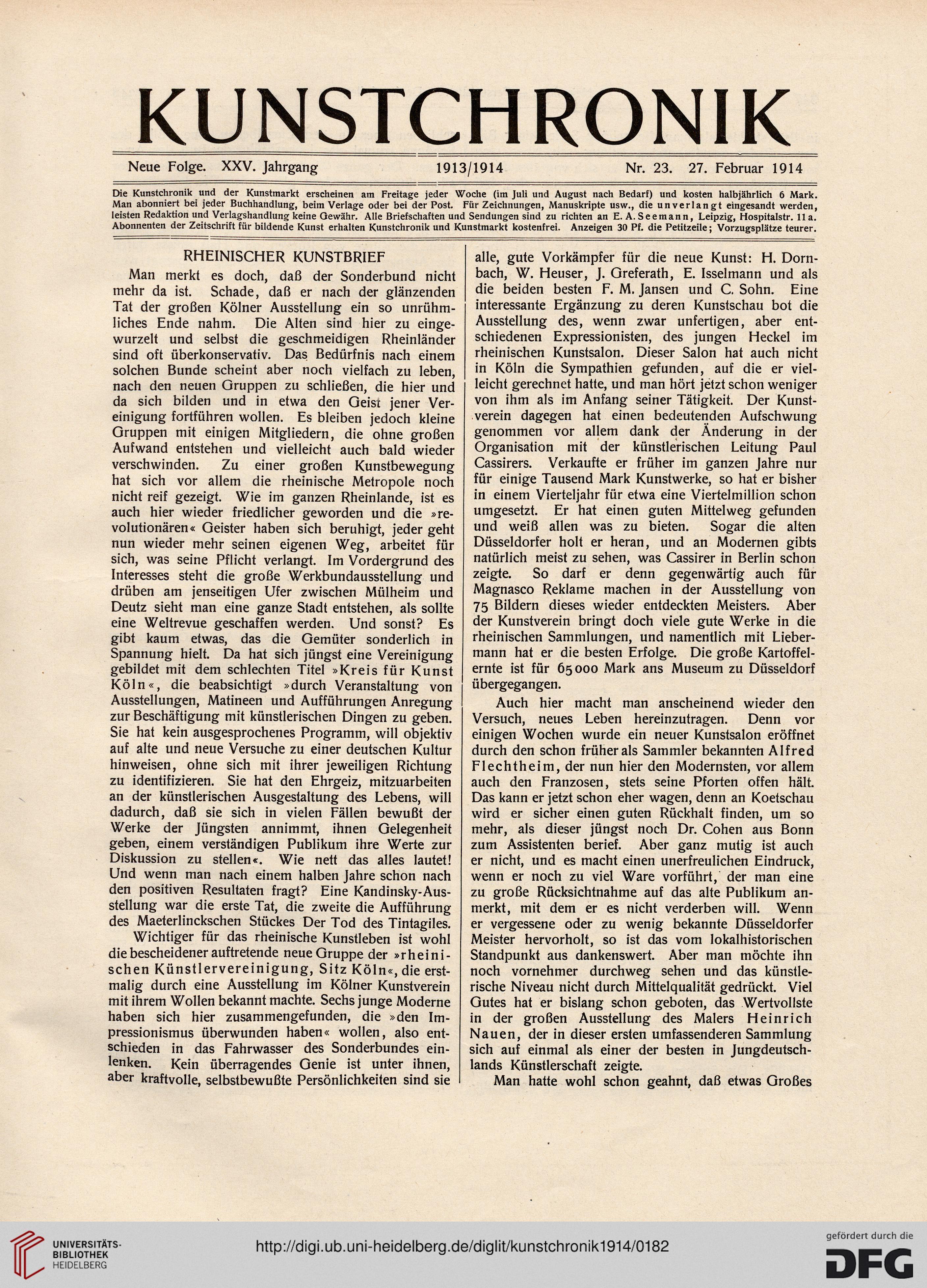KUNSTCHRONIK
Neue Folge. XXV. Jahrgang 1913/1914 Nr. 23. 27. Februar 1914
Die Kunstchronik und der Kunstmarkt erscheinen am Freitage jeder Woche (im Juli und August nach Bedarf) und kosten halbjährlich 6 Mark.
Man abonniert bei jeder Buchhandlung, beim Verlage oder bei der Post. Für Zeichnungen, Manuskripte usw., die unverlangt eingesandt werden,
leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Oewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E. A.Seemann, Leipzig, Hospitalstr. 11 a.
Abonnenten der Zeitschrift für bildende Kunst erhalten Kunstchronik und Kunstmarkt kostenfrei. Anzeigen 30 Pf. die Petitzeile; Vorzugsplätze teurer.
RHEINISCHER KUNSTBRIEF
Man merkt es doch, daß der Sonderbund nicht
mehr da ist. Schade, daß er nach der glänzenden
Tat der großen Kölner Ausstellung ein so unrühm-
liches Ende nahm. Die Alten sind hier zu einge-
wurzelt und selbst die geschmeidigen Rheinländer
sind oft überkonservativ. Das Bedürfnis nach einem
solchen Bunde scheint aber noch vielfach zu leben,
nach den neuen Gruppen zu schließen, die hier und
da sich bilden und in etwa den Geisi jener Ver-
einigung fortführen wollen. Es bleiben jedoch kleine
Gruppen mit einigen Mitgliedern, die ohne großen
Aufwand entstehen und vielleicht auch bald wieder
verschwinden. Zu einer großen Kunstbewegung
hat sich vor allem die rheinische Metropole noch
nicht reif gezeigt. Wie im ganzen Rheinlande, ist es
auch hier wieder friedlicher geworden und die »re-
volutionären« Geister haben sich beruhigt, jeder geht
nun wieder mehr seinen eigenen Weg, arbeitet für
sich, was seine Pflicht verlangt. Im Vordergrund des
Interesses steht die große Werkbundausstellung und
drüben am jenseitigen Ufer zwischen Mülheim und
Deutz sieht man eine ganze Stadt entstehen, als sollte
eine Weltrevue geschaffen werden. Und sonst? Es
gibt kaum etwas, das die Gemüter sonderlich in
Spannung hielt. Da hat sich jüngst eine Vereinigung
gebildet mit dem schlechten Titel »Kreis für Kunst
Köln«, die beabsichtigt »durch Veranstaltung von
Ausstellungen, Matineen und Aufführungen Anregung
zur Beschäftigung mit künstlerischen Dingen zu geben.
Sie hat kein ausgesprochenes Programm, will objektiv
auf alte und neue Versuche zu einer deutschen Kultur
hinweisen, ohne sich mit ihrer jeweiligen Richtung
zu identifizieren. Sie hat den Ehrgeiz, mitzuarbeiten
an der künstlerischen Ausgestaltung des Lebens, will
dadurch, daß sie sich in vielen Fällen bewußt der
Werke der Jüngsten annimmt, ihnen Gelegenheit
geben, einem verständigen Publikum ihre Werte zur
Diskussion zu stellen«. Wie nett das alles lautet!
Und wenn man nach einem halben Jahre schon nach
den positiven Resultaten fragt? Eine Kandinsky-Aus-
stellung war die erste Tat, die zweite die Aufführung
des Maeterlinckschen Stückes Der Tod des Tintagiles.
Wichtiger für das rheinische Kunstleben ist wohl
die bescheidener auftretende neue Gruppe der »rheini-
schen Künstlervereinigung, Sitz Köln«, die erst-
malig durch eine Ausstellung im Kölner Kunstverein
mit ihrem Wollen bekannt machte. Sechs junge Moderne
haben sich hier zusammengefunden, die »den Im-
pressionismus überwunden haben« wollen, also ent-
schieden in das Fahrwasser des Sonderbundes ein-
lenken. Kein überragendes Genie ist unter ihnen,
aber kraftvolle, selbstbewußte Persönlichkeiten sind sie
alle, gute Vorkämpfer für die neue Kunst: H. Dorn-
bach, W. Heuser, J. Greferath, E. Isselmann und als
die beiden besten F. M. Jansen und C. Sohn. Eine
interessante Ergänzung zu deren Kunstschau bot die
Ausstellung des, wenn zwar unfertigen, aber ent-
schiedenen Expressionisten, des jungen Heckel im
rheinischen Kunstsalon. Dieser Salon hat auch nicht
in Köln die Sympathien gefunden, auf die er viel-
leicht gerechnet hatte, und man hört jetzt schon weniger
von ihm als im Anfang seiner Tätigkeit. Der Kunst-
verein dagegen hat einen bedeutenden Aufschwung
genommen vor allem dank der Änderung in der
Organisation mit der künstlerischen Leitung Paul
Cassirers. Verkaufte er früher im ganzen Jahre nur
für einige Tausend Mark Kunstwerke, so hat er bisher
in einem Vierteljahr für etwa eine Viertelmillion schon
umgesetzt. Er hat einen guten Mittelweg gefunden
und weiß allen was zu bieten. Sogar die alten
Düsseldorfer holt er heran, und an Modernen gibts
natürlich meist zu sehen, was Cassirer in Berlin schon
zeigte. So darf er denn gegenwärtig auch für
Magnasco Reklame machen in der Ausstellung von
75 Bildern dieses wieder entdeckten Meisters. Aber
der Kunstverein bringt doch viele gute Werke in die
rheinischen Sammlungen, und namentlich mit Lieber-
mann hat er die besten Erfolge. Die große Kartoffel-
ernte ist für 65000 Mark ans Museum zu Düsseldorf
übergegangen.
Auch hier macht man anscheinend wieder den
Versuch, neues Leben hereinzutragen. Denn vor
einigen Wochen wurde ein neuer Kunstsalon eröffnet
durch den schon früher als Sammler bekannten Alfred
Flechtheim, der nun hier den Modernsten, vor allem
auch den Franzosen, stets seine Pforten offen hält.
Das kann er jetzt schon eher wagen, denn an Koetschau
wird er sicher einen guten Rückhalt finden, um so
mehr, als dieser jüngst noch Dr. Cohen aus Bonn
zum Assistenten berief. Aber ganz mutig ist auch
er nicht, und es macht einen unerfreulichen Eindruck,
wenn er noch zu viel Ware vorführt, der man eine
zu große Rücksichtnahme auf das alte Publikum an-
merkt, mit dem er es nicht verderben will. Wenn
er vergessene oder zu wenig bekannte Düsseldorfer
Meister hervorholt, so ist das vom lokalhistorischen
Standpunkt aus dankenswert. Aber man möchte ihn
noch vornehmer durchweg sehen und das künstle-
rische Niveau nicht durch Mittelqualität gedrückt. Viel
Gutes hat er bislang schon geboten, das Wertvollste
in der großen Ausstellung des Malers Heinrich
Nauen, der in dieser ersten umfassenderen Sammlung
sich auf einmal als einer der besten in Jungdeutsch-
lands Künstlerschaft zeigte.
Man hatte wohl schon geahnt, daß etwas Großes
Neue Folge. XXV. Jahrgang 1913/1914 Nr. 23. 27. Februar 1914
Die Kunstchronik und der Kunstmarkt erscheinen am Freitage jeder Woche (im Juli und August nach Bedarf) und kosten halbjährlich 6 Mark.
Man abonniert bei jeder Buchhandlung, beim Verlage oder bei der Post. Für Zeichnungen, Manuskripte usw., die unverlangt eingesandt werden,
leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Oewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E. A.Seemann, Leipzig, Hospitalstr. 11 a.
Abonnenten der Zeitschrift für bildende Kunst erhalten Kunstchronik und Kunstmarkt kostenfrei. Anzeigen 30 Pf. die Petitzeile; Vorzugsplätze teurer.
RHEINISCHER KUNSTBRIEF
Man merkt es doch, daß der Sonderbund nicht
mehr da ist. Schade, daß er nach der glänzenden
Tat der großen Kölner Ausstellung ein so unrühm-
liches Ende nahm. Die Alten sind hier zu einge-
wurzelt und selbst die geschmeidigen Rheinländer
sind oft überkonservativ. Das Bedürfnis nach einem
solchen Bunde scheint aber noch vielfach zu leben,
nach den neuen Gruppen zu schließen, die hier und
da sich bilden und in etwa den Geisi jener Ver-
einigung fortführen wollen. Es bleiben jedoch kleine
Gruppen mit einigen Mitgliedern, die ohne großen
Aufwand entstehen und vielleicht auch bald wieder
verschwinden. Zu einer großen Kunstbewegung
hat sich vor allem die rheinische Metropole noch
nicht reif gezeigt. Wie im ganzen Rheinlande, ist es
auch hier wieder friedlicher geworden und die »re-
volutionären« Geister haben sich beruhigt, jeder geht
nun wieder mehr seinen eigenen Weg, arbeitet für
sich, was seine Pflicht verlangt. Im Vordergrund des
Interesses steht die große Werkbundausstellung und
drüben am jenseitigen Ufer zwischen Mülheim und
Deutz sieht man eine ganze Stadt entstehen, als sollte
eine Weltrevue geschaffen werden. Und sonst? Es
gibt kaum etwas, das die Gemüter sonderlich in
Spannung hielt. Da hat sich jüngst eine Vereinigung
gebildet mit dem schlechten Titel »Kreis für Kunst
Köln«, die beabsichtigt »durch Veranstaltung von
Ausstellungen, Matineen und Aufführungen Anregung
zur Beschäftigung mit künstlerischen Dingen zu geben.
Sie hat kein ausgesprochenes Programm, will objektiv
auf alte und neue Versuche zu einer deutschen Kultur
hinweisen, ohne sich mit ihrer jeweiligen Richtung
zu identifizieren. Sie hat den Ehrgeiz, mitzuarbeiten
an der künstlerischen Ausgestaltung des Lebens, will
dadurch, daß sie sich in vielen Fällen bewußt der
Werke der Jüngsten annimmt, ihnen Gelegenheit
geben, einem verständigen Publikum ihre Werte zur
Diskussion zu stellen«. Wie nett das alles lautet!
Und wenn man nach einem halben Jahre schon nach
den positiven Resultaten fragt? Eine Kandinsky-Aus-
stellung war die erste Tat, die zweite die Aufführung
des Maeterlinckschen Stückes Der Tod des Tintagiles.
Wichtiger für das rheinische Kunstleben ist wohl
die bescheidener auftretende neue Gruppe der »rheini-
schen Künstlervereinigung, Sitz Köln«, die erst-
malig durch eine Ausstellung im Kölner Kunstverein
mit ihrem Wollen bekannt machte. Sechs junge Moderne
haben sich hier zusammengefunden, die »den Im-
pressionismus überwunden haben« wollen, also ent-
schieden in das Fahrwasser des Sonderbundes ein-
lenken. Kein überragendes Genie ist unter ihnen,
aber kraftvolle, selbstbewußte Persönlichkeiten sind sie
alle, gute Vorkämpfer für die neue Kunst: H. Dorn-
bach, W. Heuser, J. Greferath, E. Isselmann und als
die beiden besten F. M. Jansen und C. Sohn. Eine
interessante Ergänzung zu deren Kunstschau bot die
Ausstellung des, wenn zwar unfertigen, aber ent-
schiedenen Expressionisten, des jungen Heckel im
rheinischen Kunstsalon. Dieser Salon hat auch nicht
in Köln die Sympathien gefunden, auf die er viel-
leicht gerechnet hatte, und man hört jetzt schon weniger
von ihm als im Anfang seiner Tätigkeit. Der Kunst-
verein dagegen hat einen bedeutenden Aufschwung
genommen vor allem dank der Änderung in der
Organisation mit der künstlerischen Leitung Paul
Cassirers. Verkaufte er früher im ganzen Jahre nur
für einige Tausend Mark Kunstwerke, so hat er bisher
in einem Vierteljahr für etwa eine Viertelmillion schon
umgesetzt. Er hat einen guten Mittelweg gefunden
und weiß allen was zu bieten. Sogar die alten
Düsseldorfer holt er heran, und an Modernen gibts
natürlich meist zu sehen, was Cassirer in Berlin schon
zeigte. So darf er denn gegenwärtig auch für
Magnasco Reklame machen in der Ausstellung von
75 Bildern dieses wieder entdeckten Meisters. Aber
der Kunstverein bringt doch viele gute Werke in die
rheinischen Sammlungen, und namentlich mit Lieber-
mann hat er die besten Erfolge. Die große Kartoffel-
ernte ist für 65000 Mark ans Museum zu Düsseldorf
übergegangen.
Auch hier macht man anscheinend wieder den
Versuch, neues Leben hereinzutragen. Denn vor
einigen Wochen wurde ein neuer Kunstsalon eröffnet
durch den schon früher als Sammler bekannten Alfred
Flechtheim, der nun hier den Modernsten, vor allem
auch den Franzosen, stets seine Pforten offen hält.
Das kann er jetzt schon eher wagen, denn an Koetschau
wird er sicher einen guten Rückhalt finden, um so
mehr, als dieser jüngst noch Dr. Cohen aus Bonn
zum Assistenten berief. Aber ganz mutig ist auch
er nicht, und es macht einen unerfreulichen Eindruck,
wenn er noch zu viel Ware vorführt, der man eine
zu große Rücksichtnahme auf das alte Publikum an-
merkt, mit dem er es nicht verderben will. Wenn
er vergessene oder zu wenig bekannte Düsseldorfer
Meister hervorholt, so ist das vom lokalhistorischen
Standpunkt aus dankenswert. Aber man möchte ihn
noch vornehmer durchweg sehen und das künstle-
rische Niveau nicht durch Mittelqualität gedrückt. Viel
Gutes hat er bislang schon geboten, das Wertvollste
in der großen Ausstellung des Malers Heinrich
Nauen, der in dieser ersten umfassenderen Sammlung
sich auf einmal als einer der besten in Jungdeutsch-
lands Künstlerschaft zeigte.
Man hatte wohl schon geahnt, daß etwas Großes