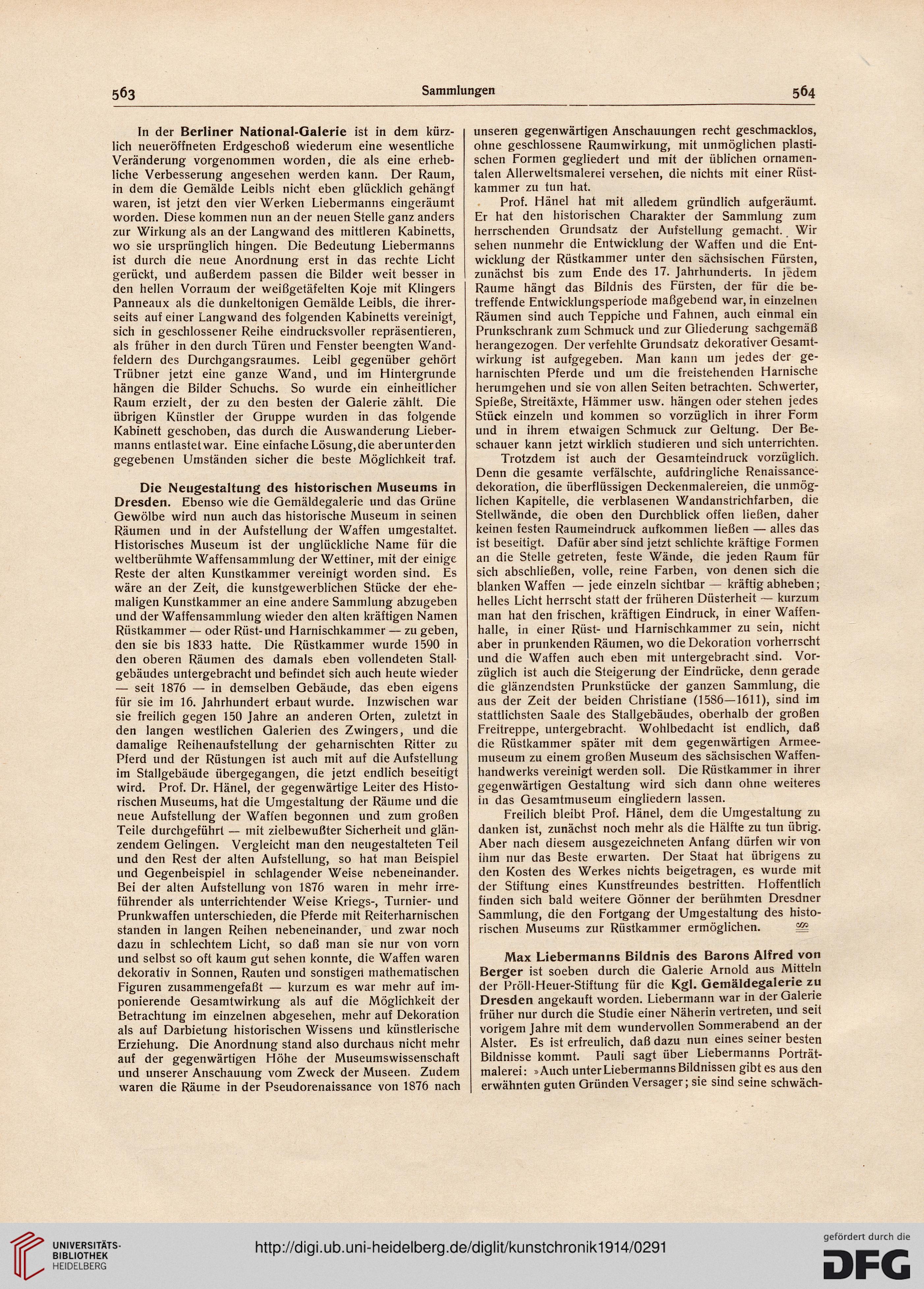563
Sammlungen
564
In der Berliner National-Galerie ist in dem kürz-
lich neueröffneten Erdgeschoß wiederum eine wesentliche
Veränderung vorgenommen worden, die als eine erheb-
liche Verbesserung angesehen werden kann. Der Raum,
in dem die Gemälde Leibis nicht eben glücklich gehängt
waren, ist jetzt den vier Werken Liebermanns eingeräumt
worden. Diese kommen nun an der neuen Stelle ganz anders
zur Wirkung als an der Langwand des mittleren Kabinetts,
wo sie ursprünglich hingen. Die Bedeutung Liebermanns
ist durch die neue Anordnung erst in das rechte Licht
gerückt, und außerdem passen die Bilder weit besser in
den hellen Vorraum der weißgetäfelten Koje mit Klingers
Panneaux als die dunkeltonigen Gemälde Leibis, die ihrer-
seits auf einer Langwand des folgenden Kabinetts vereinigt,
sich in geschlossener Reihe eindrucksvoller repräsentieren,
als früher in den durch Türen und Fenster beengten Wand-
feldern des Durchgangsraumes. Leibi gegenüber gehört
Trübner jetzt eine ganze Wand, und im Hintergrunde
hängen die Bilder Schuchs. So wurde ein einheitlicher
Raum erzielt, der zu den besten der Galerie zählt. Die
übrigen Künstler der Gruppe wurden in das folgende
Kabinett geschoben, das durch die Auswanderung Lieber-
manns entlastet war. Eine einfache Lösung, die aberunterden
gegebenen Umständen sicher die beste Möglichkeit traf.
Die Neugestaltung des historischen Museums in
Dresden. Ebenso wie die Gemäldegalerie und das Grüne
Gewölbe wird nun auch das historische Museum in seinen
Räumen und in der Aufstellung der Waffen umgestaltet.
Historisches Museum ist der unglückliche Name für die
weltberühmte Waffensammlung der Wettiner, mit der einige
Reste der alten Kunstkammer vereinigt worden sind. Es
wäre an der Zeit, die kunstgewerblichen Stücke der ehe-
maligen Kunstkammer an eine andere Sammlung abzugeben
und der Waffensammlung wieder den alten kräftigen Namen
Rüstkammer — oder Rüst-und Harnischkammer — zu geben,
den sie bis 1833 hatte. Die Rüstkammer wurde 1590 in
den oberen Räumen des damals eben vollendeten Stall-
gebäudes untergebracht und befindet sich auch heute wieder
— seit 1876 — in demselben Gebäude, das eben eigens
für sie im 16. Jahrhundert erbaut wurde. Inzwischen war
sie freilich gegen 150 Jahre an anderen Orten, zuletzt in
den langen westlichen Galerien des Zwingers, und die
damalige Reihenaufstellung der geharnischten Ritter zu
Pferd und der Rüstungen ist auch mit auf die Aufstellung
im Stallgebäude übergegangen, die jetzt endlich beseitigt
wird. Prof. Dr. Hänel, der gegenwärtige Leiter des Histo-
rischen Museums, hat die Umgestaltung der Räume und die
neue Aufstellung der Wafien begonnen und zum großen
Teile durchgeführt — mit zielbewußter Sicherheit und glän-
zendem Gelingen. Vergleicht man den neugestalteten Teil
und den Rest der alten Aufstellung, so hat man Beispiel
und Gegenbeispiel in schlagender Weise nebeneinander.
Bei der alten Aufstellung von 1876 waren in mehr irre-
führender als unterrichtender Weise Kriegs-, Turnier- und
Prunkwaffen unterschieden, die Pferde mit Reiterharnischen
standen in langen Reihen nebeneinander, und zwar noch
dazu in schlechtem Licht, so daß man sie nur von vorn
und selbst so oft kaum gut sehen konnte, die Waffen waren
dekorativ in Sonnen, Rauten und sonstigen mathematischen
Figuren zusammengefaßt — kurzum es war mehr auf im-
ponierende Gesamtwirkung als auf die Möglichkeit der
Betrachtung im einzelnen abgesehen, mehr auf Dekoration
als auf Darbietung historischen Wissens und künstlerische
Erziehung. Die Anordnung stand also durchaus nicht mehr
auf der gegenwärtigen Höhe der Museumswissenschaft
und unserer Anschauung vom Zweck der Museen. Zudem
waren die Räume in der Pseudorenaissance von 1876 nach
unseren gegenwärtigen Anschauungen recht geschmacklos,
ohne geschlossene Raumwirkung, mit unmöglichen plasti-
schen Formen gegliedert und mit der üblichen ornamen-
talen Allerweltsmalerei versehen, die nichts mit einer Rüst-
kammer zu tun hat.
Prof. Hänel hat mit alledem gründlich aufgeräumt.
Er hat den historischen Charakter der Sammlung zum
herrschenden Grundsatz der Aufstellung gemacht. Wir
sehen nunmehr die Entwicklung der Waffen und die Ent-
wicklung der Rüstkammer unter den sächsischen Fürsten,
zunächst bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. In jedem
Räume hängt das Bildnis des Fürsten, der für die be-
treffende Entwicklungsperiode maßgebend war, in einzelnen
Räumen sind auch Teppiche und Fahnen, auch einmal ein
Prunkschrank zum Schmuck und zur Gliederung sachgemäß
herangezogen. Der verfehlte Grundsatz dekorativer Gesamt-
wirkung ist aufgegeben. Man kann um jedes der ge-
harnischten Pferde und um die freistehenden Harnische
herumgehen und sie von allen Seiten betrachten. Schwerter,
Spieße, Streitäxte, Hämmer usw. hängen oder stehen jedes
Stück einzeln und kommen so vorzüglich in ihrer Form
und in ihrem etwaigen Schmuck zur Geltung. Der Be-
schauer kann jetzt wirklich studieren und sich unterrichten.
Trotzdem ist auch der Gesamteindruck vorzüglich.
Denn die gesamte verfälschte, aufdringliche Renaissance-
dekoration, die überflüssigen Deckenmalereien, die unmög-
lichen Kapitelle, die verblasenen Wandanstrichfarben, die
Stellwände, die oben den Durchblick offen ließen, daher
keinen festen Raumeindruck aufkommen ließen — alles das
ist beseitigt. Dafür aber sind jetzt schlichte kräftige Formen
an die Stelle getreten, feste Wände, die jeden Raum für
sich abschließen, volle, reine Farben, von denen sich die
blanken Waffen — jede einzeln sichtbar — kräftig abheben;
helles Licht herrscht statt der früheren Düsterheit — kurzum
man hat den frischen, kräftigen Eindruck, in einer Waffen-
halle, in einer Rüst- und Harnischkammer zu sein, nicht
aber in prunkenden Räumen, wo die Dekoration vorherrscht
und die Waffen auch eben mit untergebracht sind. Vor-
züglich ist auch die Steigerung der Eindrücke, denn gerade
die glänzendsten Prunkstücke der ganzen Sammlung, die
aus der Zeit der beiden Christiane (1586—1611), sind im
stattlichsten Saale des Stallgebäudes, oberhalb der großen
Freitreppe, untergebracht. Wohlbedacht ist endlich, daß
die Rüstkammer später mit dem gegenwärtigen Armee-
museum zu einem großen Museum des sächsischen Waffen-
handwerks vereinigt werden soll. Die Rüstkammer in ihrer
gegenwärtigen Gestaltung wird sich dann ohne weiteres
in das Gesamtmuseum eingliedern lassen.
Freilich bleibt Prof. Hänel, dem die Umgestaltung zu
danken ist, zunächst noch mehr als die Hälfte zu tun übrig.
Aber nach diesem ausgezeichneten Anfang dürfen wir von
ihm nur das Beste erwarten. Der Staat hat übrigens zu
den Kosten des Werkes nichts beigetragen, es wurde mit
der Stiftung eines Kunstfreundes bestritten. Hoffentlich
finden sich bald weitere Gönner der berühmten Dresdner
Sammlung, die den Fortgang der Umgestaltung des histo-
rischen Museums zur Rüstkammer ermöglichen. ^?
Max Liebermanns Bildnis des Barons Alfred von
Berger ist soeben durch die Galerie Arnold aus Mitteln
der Pröll-Heuer-Stiftung für die Kgl. Gemäldegalerie zu
Dresden angekauft worden. Liebermann war in der Galerie
früher nur durch die Studie einer Näherin vertreten, und seit
vorigem Jahre mit dem wundervollen Sommerabend an der
Alster. Es ist erfreulich, daß dazu nun eines seiner besten
Bildnisse kommt. Pauli sagt über Liebermanns Porträt-
malerei : »Auch unter Liebermanns Bildnissen gibt es aus den
erwähnten guten Gründen Versager; sie sind seine schwäch-
Sammlungen
564
In der Berliner National-Galerie ist in dem kürz-
lich neueröffneten Erdgeschoß wiederum eine wesentliche
Veränderung vorgenommen worden, die als eine erheb-
liche Verbesserung angesehen werden kann. Der Raum,
in dem die Gemälde Leibis nicht eben glücklich gehängt
waren, ist jetzt den vier Werken Liebermanns eingeräumt
worden. Diese kommen nun an der neuen Stelle ganz anders
zur Wirkung als an der Langwand des mittleren Kabinetts,
wo sie ursprünglich hingen. Die Bedeutung Liebermanns
ist durch die neue Anordnung erst in das rechte Licht
gerückt, und außerdem passen die Bilder weit besser in
den hellen Vorraum der weißgetäfelten Koje mit Klingers
Panneaux als die dunkeltonigen Gemälde Leibis, die ihrer-
seits auf einer Langwand des folgenden Kabinetts vereinigt,
sich in geschlossener Reihe eindrucksvoller repräsentieren,
als früher in den durch Türen und Fenster beengten Wand-
feldern des Durchgangsraumes. Leibi gegenüber gehört
Trübner jetzt eine ganze Wand, und im Hintergrunde
hängen die Bilder Schuchs. So wurde ein einheitlicher
Raum erzielt, der zu den besten der Galerie zählt. Die
übrigen Künstler der Gruppe wurden in das folgende
Kabinett geschoben, das durch die Auswanderung Lieber-
manns entlastet war. Eine einfache Lösung, die aberunterden
gegebenen Umständen sicher die beste Möglichkeit traf.
Die Neugestaltung des historischen Museums in
Dresden. Ebenso wie die Gemäldegalerie und das Grüne
Gewölbe wird nun auch das historische Museum in seinen
Räumen und in der Aufstellung der Waffen umgestaltet.
Historisches Museum ist der unglückliche Name für die
weltberühmte Waffensammlung der Wettiner, mit der einige
Reste der alten Kunstkammer vereinigt worden sind. Es
wäre an der Zeit, die kunstgewerblichen Stücke der ehe-
maligen Kunstkammer an eine andere Sammlung abzugeben
und der Waffensammlung wieder den alten kräftigen Namen
Rüstkammer — oder Rüst-und Harnischkammer — zu geben,
den sie bis 1833 hatte. Die Rüstkammer wurde 1590 in
den oberen Räumen des damals eben vollendeten Stall-
gebäudes untergebracht und befindet sich auch heute wieder
— seit 1876 — in demselben Gebäude, das eben eigens
für sie im 16. Jahrhundert erbaut wurde. Inzwischen war
sie freilich gegen 150 Jahre an anderen Orten, zuletzt in
den langen westlichen Galerien des Zwingers, und die
damalige Reihenaufstellung der geharnischten Ritter zu
Pferd und der Rüstungen ist auch mit auf die Aufstellung
im Stallgebäude übergegangen, die jetzt endlich beseitigt
wird. Prof. Dr. Hänel, der gegenwärtige Leiter des Histo-
rischen Museums, hat die Umgestaltung der Räume und die
neue Aufstellung der Wafien begonnen und zum großen
Teile durchgeführt — mit zielbewußter Sicherheit und glän-
zendem Gelingen. Vergleicht man den neugestalteten Teil
und den Rest der alten Aufstellung, so hat man Beispiel
und Gegenbeispiel in schlagender Weise nebeneinander.
Bei der alten Aufstellung von 1876 waren in mehr irre-
führender als unterrichtender Weise Kriegs-, Turnier- und
Prunkwaffen unterschieden, die Pferde mit Reiterharnischen
standen in langen Reihen nebeneinander, und zwar noch
dazu in schlechtem Licht, so daß man sie nur von vorn
und selbst so oft kaum gut sehen konnte, die Waffen waren
dekorativ in Sonnen, Rauten und sonstigen mathematischen
Figuren zusammengefaßt — kurzum es war mehr auf im-
ponierende Gesamtwirkung als auf die Möglichkeit der
Betrachtung im einzelnen abgesehen, mehr auf Dekoration
als auf Darbietung historischen Wissens und künstlerische
Erziehung. Die Anordnung stand also durchaus nicht mehr
auf der gegenwärtigen Höhe der Museumswissenschaft
und unserer Anschauung vom Zweck der Museen. Zudem
waren die Räume in der Pseudorenaissance von 1876 nach
unseren gegenwärtigen Anschauungen recht geschmacklos,
ohne geschlossene Raumwirkung, mit unmöglichen plasti-
schen Formen gegliedert und mit der üblichen ornamen-
talen Allerweltsmalerei versehen, die nichts mit einer Rüst-
kammer zu tun hat.
Prof. Hänel hat mit alledem gründlich aufgeräumt.
Er hat den historischen Charakter der Sammlung zum
herrschenden Grundsatz der Aufstellung gemacht. Wir
sehen nunmehr die Entwicklung der Waffen und die Ent-
wicklung der Rüstkammer unter den sächsischen Fürsten,
zunächst bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. In jedem
Räume hängt das Bildnis des Fürsten, der für die be-
treffende Entwicklungsperiode maßgebend war, in einzelnen
Räumen sind auch Teppiche und Fahnen, auch einmal ein
Prunkschrank zum Schmuck und zur Gliederung sachgemäß
herangezogen. Der verfehlte Grundsatz dekorativer Gesamt-
wirkung ist aufgegeben. Man kann um jedes der ge-
harnischten Pferde und um die freistehenden Harnische
herumgehen und sie von allen Seiten betrachten. Schwerter,
Spieße, Streitäxte, Hämmer usw. hängen oder stehen jedes
Stück einzeln und kommen so vorzüglich in ihrer Form
und in ihrem etwaigen Schmuck zur Geltung. Der Be-
schauer kann jetzt wirklich studieren und sich unterrichten.
Trotzdem ist auch der Gesamteindruck vorzüglich.
Denn die gesamte verfälschte, aufdringliche Renaissance-
dekoration, die überflüssigen Deckenmalereien, die unmög-
lichen Kapitelle, die verblasenen Wandanstrichfarben, die
Stellwände, die oben den Durchblick offen ließen, daher
keinen festen Raumeindruck aufkommen ließen — alles das
ist beseitigt. Dafür aber sind jetzt schlichte kräftige Formen
an die Stelle getreten, feste Wände, die jeden Raum für
sich abschließen, volle, reine Farben, von denen sich die
blanken Waffen — jede einzeln sichtbar — kräftig abheben;
helles Licht herrscht statt der früheren Düsterheit — kurzum
man hat den frischen, kräftigen Eindruck, in einer Waffen-
halle, in einer Rüst- und Harnischkammer zu sein, nicht
aber in prunkenden Räumen, wo die Dekoration vorherrscht
und die Waffen auch eben mit untergebracht sind. Vor-
züglich ist auch die Steigerung der Eindrücke, denn gerade
die glänzendsten Prunkstücke der ganzen Sammlung, die
aus der Zeit der beiden Christiane (1586—1611), sind im
stattlichsten Saale des Stallgebäudes, oberhalb der großen
Freitreppe, untergebracht. Wohlbedacht ist endlich, daß
die Rüstkammer später mit dem gegenwärtigen Armee-
museum zu einem großen Museum des sächsischen Waffen-
handwerks vereinigt werden soll. Die Rüstkammer in ihrer
gegenwärtigen Gestaltung wird sich dann ohne weiteres
in das Gesamtmuseum eingliedern lassen.
Freilich bleibt Prof. Hänel, dem die Umgestaltung zu
danken ist, zunächst noch mehr als die Hälfte zu tun übrig.
Aber nach diesem ausgezeichneten Anfang dürfen wir von
ihm nur das Beste erwarten. Der Staat hat übrigens zu
den Kosten des Werkes nichts beigetragen, es wurde mit
der Stiftung eines Kunstfreundes bestritten. Hoffentlich
finden sich bald weitere Gönner der berühmten Dresdner
Sammlung, die den Fortgang der Umgestaltung des histo-
rischen Museums zur Rüstkammer ermöglichen. ^?
Max Liebermanns Bildnis des Barons Alfred von
Berger ist soeben durch die Galerie Arnold aus Mitteln
der Pröll-Heuer-Stiftung für die Kgl. Gemäldegalerie zu
Dresden angekauft worden. Liebermann war in der Galerie
früher nur durch die Studie einer Näherin vertreten, und seit
vorigem Jahre mit dem wundervollen Sommerabend an der
Alster. Es ist erfreulich, daß dazu nun eines seiner besten
Bildnisse kommt. Pauli sagt über Liebermanns Porträt-
malerei : »Auch unter Liebermanns Bildnissen gibt es aus den
erwähnten guten Gründen Versager; sie sind seine schwäch-