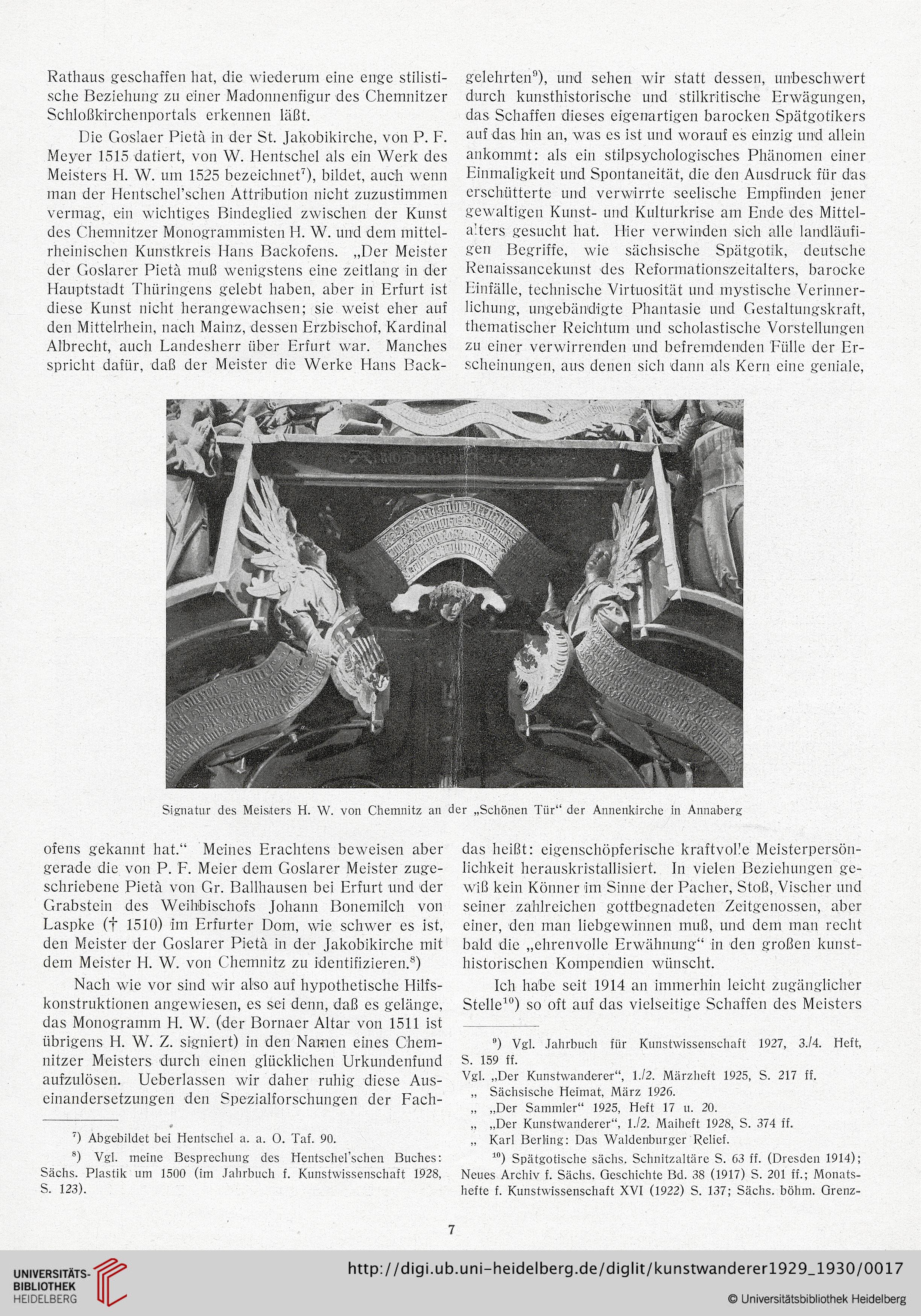Rathaus geschaffen hat, die wiederum eine enge stilisti-
sche Beziehung zu einer Madonnenfigur des Chemnitzer
Schloßkirchenportais erkennen läßt.
Die Goslaer Pieta in der St. Jakobikirche, von P. F.
Meyer 1515 datiert, von W. Hentschel als ein Werk des
Meisters H. W. um 1525 bezeichnet7), bildet, auch wenn
man der Hentschel’schen Attribution nicht zuzustimmen
vermag, ein wichtiges Bindeglied zwischen der Kunst
des Chemnitzer Monogrammisten H. W. und dem mittel-
rheinischen Kunstkreis Hans Backofens. „Der Meister
der Goslarcr Pieta muß wenigstens eine zeitlang in der
Hauptstadt Thüringens gelebt haben, aber in Erfurt ist
diese Kunst nicht herangewachsen; sie weist eher auf
den Mittelrhein, nach Mainz, dessen Erzbischof, Kardinal
Albrecht, auch Landesherr über Erfurt war. Manches
spricht dafür, daß der Meister die Werke Hans Back-
gelehrten0), und sehen wir statt dessen, unbeschwert
durch kunsthistorische und stilkritische Erwägungen,
das Schaffen dieses eigenartigen barocken Spätgotikers
auf das hin an, was es ist und worauf es einzig und allein
ankommt: als ein stilpsychologisches Phänomen ciner
Einmaligkeit und Spontaneität, die den Ausdruck für das
erschütterte und verwirrte seelische Empfinden jener
gewaltigen Kunst- und Kulturkrise am Ende des Mittel-
alters gesucht hat. 1 Iler verwinden sich alle landläufi-
gen Begriffe, wie sächsische Spätgotik, deutsche
Renaissancekunst des Reformationszeitalters, barocke
Einfälle, technische Virtuosität und mystische Verinner-
lichung, ungebändigte Phantasie und Gestaltungskraft,
thematischer Reichtum und scholastische Vorstellungen
zu einer verwirrenden und befremdenden Fülle der Er-
scheinungen, aus denen sich dann als Kern eine geniale,
Signatur des Meisters H. W. von Chemnitz an der „Schönen Tür“ der Annenkirche in Annaberg
ofens gekannt hat.“ Meines Erachtens beweisen aber
gerade die von P. F. Meier dem Goslarer Meister zuge-
schriebene Pieta von Gr. Ballhausen bei Erfurt und der
Grabstein des Weihbischofs Johann Bonemilch von
Laspke (f 1510) im Erfurter Dom, wie schwer es ist,
den Meister der Goslarer Pieta in der Jakobikirche mit
dem Meister H. W. von Chemnitz zu identifizieren.8 *)
Nach wie vor sind wir also auf hypothetische Hilfs-
konstruktionen angewiesen, es sei denn, daß es gelänge,
das Monogramm H. W. (der Bornaer Altar von 1511 ist
übrigens H. W. Z. signiert) in den Namen eines Chem-
nitzer Meisters durch einen glücklichen Urkundenfund
aufzulösen. Ueberlassen wir daher ruhig diese Aus-
einandersetzungen den Spezialforschungen der Fach-
7) Abgebildet bei Hentschel a. a. 0. Tat. 90.
8) Vgl. meine Besprechung des Hentschel’schen Buches:
Sächs. Plastik um 1500 (im Jahrbuch f. Kunstwissenschaft 1928,
S. 123).
das heißt: eigenschöpferische kraftvolle Meisterpersön-
lichkeit herauskristallisiert. In vielen Beziehungen ge-
wiß kein Könner im Sinne der Pacher, Stoß, Vischer und
seiner zahlreichen gottbegnadeten Zeitgenossen, aber
einer, den man liebgewinnen muß, und dem man recht
bald die „ehrenvolle Erwähnung“ in den großen kunst-
historischen Kompendien wünscht.
Ich habe seit 1914 an immerhin leicht zugänglicher
Stelle10) so oft auf das vielseitige Schaffen des Meisters
ö) Vgl. Jahrbuch für Kunstwissenschaft 1927, 3./4. Heft,
S. 159 ff.
Vgl. „Der Kunstwanderer“, 1.12. Märzheft 1925, S. 217 ff.
,, Sächsische Heimat, März 1926.
„ „Der Sammler“ 1925, Heft 17 u. 20.
„ „Der Kunstwandercr“, 1.12. Maiheft 1928, S. 374 ff.
„ Karl Beding: Das Waldenburger Relief.
10) Spätgotische sächs. Schnitzaltäre S. 63 ff. (Dresden 1914);
Neues Archiv f. Sächs. Geschichte Bd. 38 (1917) S. 201 ff.; Monats-
hefte f. Kunstwissenschaft XVI (1922) S. 137; Sächs. böhm. Grenz-
7
sche Beziehung zu einer Madonnenfigur des Chemnitzer
Schloßkirchenportais erkennen läßt.
Die Goslaer Pieta in der St. Jakobikirche, von P. F.
Meyer 1515 datiert, von W. Hentschel als ein Werk des
Meisters H. W. um 1525 bezeichnet7), bildet, auch wenn
man der Hentschel’schen Attribution nicht zuzustimmen
vermag, ein wichtiges Bindeglied zwischen der Kunst
des Chemnitzer Monogrammisten H. W. und dem mittel-
rheinischen Kunstkreis Hans Backofens. „Der Meister
der Goslarcr Pieta muß wenigstens eine zeitlang in der
Hauptstadt Thüringens gelebt haben, aber in Erfurt ist
diese Kunst nicht herangewachsen; sie weist eher auf
den Mittelrhein, nach Mainz, dessen Erzbischof, Kardinal
Albrecht, auch Landesherr über Erfurt war. Manches
spricht dafür, daß der Meister die Werke Hans Back-
gelehrten0), und sehen wir statt dessen, unbeschwert
durch kunsthistorische und stilkritische Erwägungen,
das Schaffen dieses eigenartigen barocken Spätgotikers
auf das hin an, was es ist und worauf es einzig und allein
ankommt: als ein stilpsychologisches Phänomen ciner
Einmaligkeit und Spontaneität, die den Ausdruck für das
erschütterte und verwirrte seelische Empfinden jener
gewaltigen Kunst- und Kulturkrise am Ende des Mittel-
alters gesucht hat. 1 Iler verwinden sich alle landläufi-
gen Begriffe, wie sächsische Spätgotik, deutsche
Renaissancekunst des Reformationszeitalters, barocke
Einfälle, technische Virtuosität und mystische Verinner-
lichung, ungebändigte Phantasie und Gestaltungskraft,
thematischer Reichtum und scholastische Vorstellungen
zu einer verwirrenden und befremdenden Fülle der Er-
scheinungen, aus denen sich dann als Kern eine geniale,
Signatur des Meisters H. W. von Chemnitz an der „Schönen Tür“ der Annenkirche in Annaberg
ofens gekannt hat.“ Meines Erachtens beweisen aber
gerade die von P. F. Meier dem Goslarer Meister zuge-
schriebene Pieta von Gr. Ballhausen bei Erfurt und der
Grabstein des Weihbischofs Johann Bonemilch von
Laspke (f 1510) im Erfurter Dom, wie schwer es ist,
den Meister der Goslarer Pieta in der Jakobikirche mit
dem Meister H. W. von Chemnitz zu identifizieren.8 *)
Nach wie vor sind wir also auf hypothetische Hilfs-
konstruktionen angewiesen, es sei denn, daß es gelänge,
das Monogramm H. W. (der Bornaer Altar von 1511 ist
übrigens H. W. Z. signiert) in den Namen eines Chem-
nitzer Meisters durch einen glücklichen Urkundenfund
aufzulösen. Ueberlassen wir daher ruhig diese Aus-
einandersetzungen den Spezialforschungen der Fach-
7) Abgebildet bei Hentschel a. a. 0. Tat. 90.
8) Vgl. meine Besprechung des Hentschel’schen Buches:
Sächs. Plastik um 1500 (im Jahrbuch f. Kunstwissenschaft 1928,
S. 123).
das heißt: eigenschöpferische kraftvolle Meisterpersön-
lichkeit herauskristallisiert. In vielen Beziehungen ge-
wiß kein Könner im Sinne der Pacher, Stoß, Vischer und
seiner zahlreichen gottbegnadeten Zeitgenossen, aber
einer, den man liebgewinnen muß, und dem man recht
bald die „ehrenvolle Erwähnung“ in den großen kunst-
historischen Kompendien wünscht.
Ich habe seit 1914 an immerhin leicht zugänglicher
Stelle10) so oft auf das vielseitige Schaffen des Meisters
ö) Vgl. Jahrbuch für Kunstwissenschaft 1927, 3./4. Heft,
S. 159 ff.
Vgl. „Der Kunstwanderer“, 1.12. Märzheft 1925, S. 217 ff.
,, Sächsische Heimat, März 1926.
„ „Der Sammler“ 1925, Heft 17 u. 20.
„ „Der Kunstwandercr“, 1.12. Maiheft 1928, S. 374 ff.
„ Karl Beding: Das Waldenburger Relief.
10) Spätgotische sächs. Schnitzaltäre S. 63 ff. (Dresden 1914);
Neues Archiv f. Sächs. Geschichte Bd. 38 (1917) S. 201 ff.; Monats-
hefte f. Kunstwissenschaft XVI (1922) S. 137; Sächs. böhm. Grenz-
7