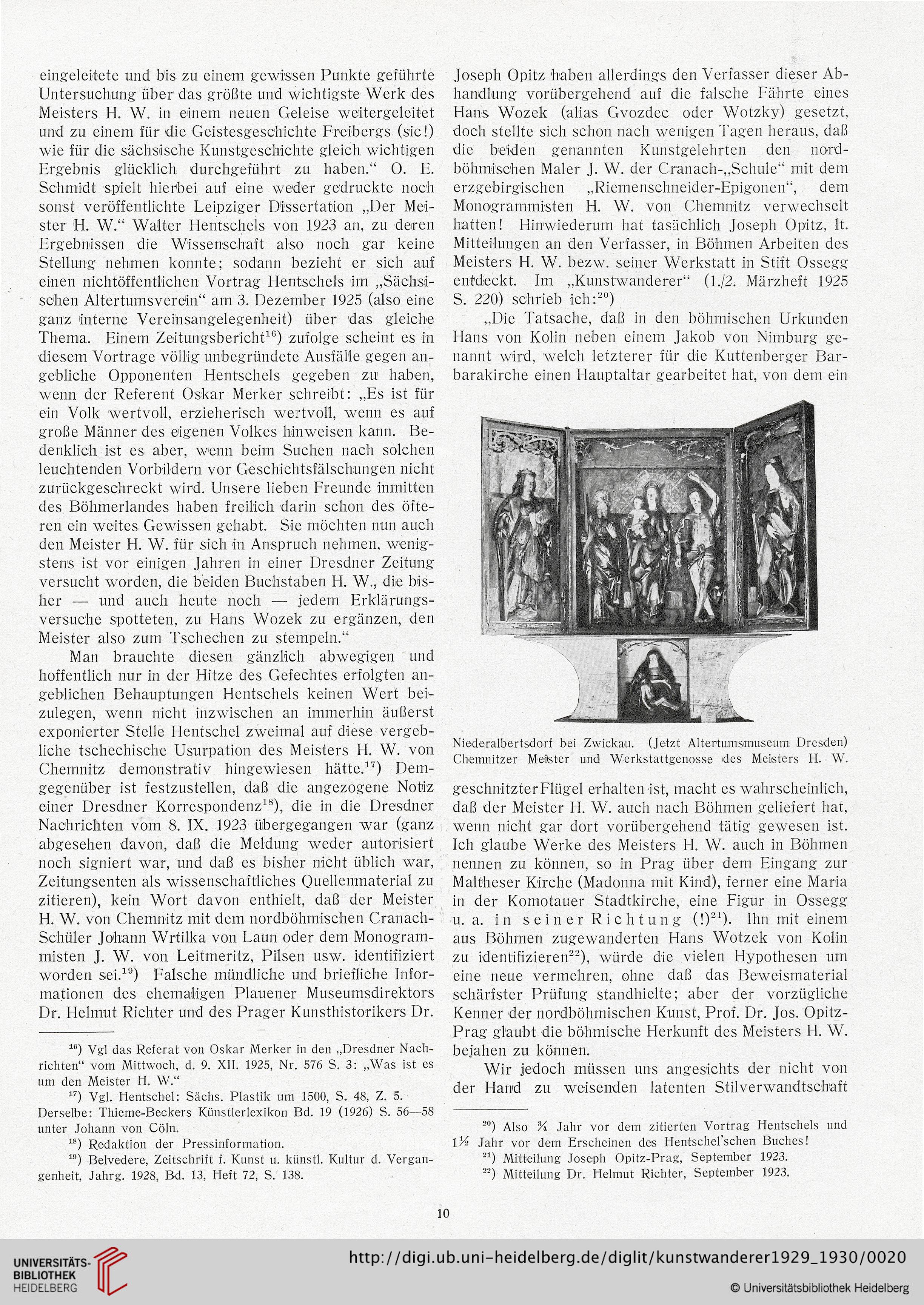eingeleitete und bis zu einem gewissen Punkte geführte
Untersuchung über das größte und wichtigste Werk des
Meisters H. W. in einem neuen Geleise weitergeleitet
und zu einem für die Geistesgeschichte Freibergs (sic!)
wie für die sächsische Kunstgeschichte gleich wichtigen
Ergebnis glücklich durchgeführt zu haben.“ O. E.
Schmidt ‘spielt hierbei auf eine weder gedruckte noch
sonst veröffentlichte Leipziger Dissertation „Der Mei-
ster H. W.“ Walter Hentschels von 1923 an, zu deren
Ergebnissen die Wissenschaft also noch gar keine
Stellung nehmen konnte; sodann bezieht er sich auf
einen nichtöffentlichen Vortrag Hentschels im „Sächsi-
schen Altertumsverein“ am 3. Dezember 1925 (also eine
ganz interne Vereinsangelegenheit) über das gleiche
Thema. Einem Zeitungsbericht16) zufolge scheint es in
diesem Vortrage völlig unbegründete Ausfälle gegen an-
gebliche Opponenten Hentschels gegeben zu haben,
wenn der Referent Oskar Merker schreibt: „Es ist für
ein Volk wertvoll, erzieherisch wertvoll, wenn es auf
große Männer des eigenen Volkes hinweisen kann. Be-
denklich ist es aber, wenn beim Suchen nach solchen
leuchtenden Vorbildern vor Geschichtsfälschungen nicht
zurückgeschreckt wird. Unsere lieben Freunde inmitten
des Böhmerlandes haben freilich darin schon des öfte-
ren ein weites Gewissen gehabt. Sie möchten nun auch
den Meister H. W. für sich in Anspruch nehmen, wenig-
stens ist vor einigen Jahren in einer Dresdner Zeitung
versucht worden, die beiden Buchstaben H. W„ die bis-
her — und auch heute noch — jedem Erklärungs-
versuche spotteten, zu Hans Wozek zu ergänzen, den
Meister also zum Tschechen zu stempeln.“
Man brauchte diesen gänzlich abwegigen und
hoffentlich nur in der Hitze des Gefechtes erfolgten an-
geblichen Behauptungen Hentschels keinen Wert bei-
zulegen, wenn nicht inzwischen an immerhin äußerst
exponierter Stelle Hentschel zweimal auf diese vergeb-
liche tschechische Usurpation des Meisters H. W. von
Chemnitz demonstrativ hingewiesen hätte.17) Dem-
gegenüber ist fcstzustellen, daß die angezogene Notiz
einer Dresdner Korrespondenz18), die in die Dresdner
Nachrichten vom 8. IX. 1923 übergegangen war (ganz
abgesehen davon, daß die Meldung weder autorisiert
noch signiert war, und daß es bisher nicht üblich war,
Zeitungsenten als wissenschaftliches Quellenmaterial zu
zitieren), kein Wort davon enthielt, daß der Meister
H. W. von Chemnitz mit dem nordböhmischen Cranach-
Schüler Johann Wrtilka von Laun oder dem Monogram-
misten J. W. von Leitmeritz, Pilsen usw. identifiziert
worden sei.19) Falsche mündliche und briefliche Infor-
mationen des ehemaligen Plauener Museumsdirektors
Dr. Helmut Richter und des Prager Kunsthistorikers Dr.
10) Vgl das Referat von Oskar Merker in den „Dresdner Nach-
richten“ vom Mittwoch, d. 9. XII. 1925, Nr. 576 S. 3: „Was ist es
um den Meister H. W.“
17) Vgl. Hentschel: Sächs. Plastik um 1500, S. 48, Z. 5.
Derselbe: Thieme-Beckers Künstlerlexikon Bd. 19 (1926) S. 56—58
unter Johann von Cöln.
18) Redaktion der Pressinformation.
10) Belvedere, Zeitschrift f. Kunst u. künstl. Kultur d. Vergan-
genheit, Jahrg. 1928, Bd. 13, Heft 72, S. 138.
Joseph Opitz haben allerdings den Verfasser dieser Ab-
handlung vorübergehend auf die falsche Fährte eines
Hans Wozek (alias Gvozdec oder Wotzky) gesetzt,
doch stellte sich schon nach wenigen Tagen heraus, daß
die beiden genannten Kunstgelehrten den nord-
böhmischen Maler J. W. der Cranach-„Schule“ mit dem
erzgebirgischen „Riemenschneider-Epigonen“, dem
Monogrammisten H. W. von Chemnitz verwechselt
hatten! Hinwiederum hat tasächlich Joseph Opitz, lt.
Mitteilungen an den Verfasser, in Böhmen Arbeiten des
Meisters H. W. bezw. seiner Werkstatt in Stift Ossegg
entdeckt. Im „Kunstwanderer“ (1./2. Märzheft 1925
S. 220) schrieb ich:20)
„Die Tatsache, daß in den böhmischen Urkunden
Hans von Kolin neben einem Jakob von Nimburg ge-
nannt wird, welch letzterer für die Kuttenberger Bar-
barakirche einen Hauptaltar gearbeitet hat, von dem ein
Niederalbertsdorf bei Zwickau. (Jetzt Altertumsmuseum Dresden)
Chemnitzer Meister und Werkstattgenosse des Meisters H. W.
geschuitzterFlügel erhalten ist, macht es wahrscheinlich,
daß der Meister H. W. auch nach Böhmen geliefert hat,
wenn nicht gar dort vorübergehend tätig gewesen ist.
Ich glaube Werke des Meisters H. W. auch in Böhmen
nennen zu können, so in Prag über dem Eingang zur
Maltheser Kirche (Madonna mit Kind), ferner eine Maria
in der Komotauer Stadtkirche, eine Figur in Ossegg
u. a. in seiner Richtung (!)21). Ihn mit einem
aus Böhmen zugewanderten Hans Wotzek von Kolin
zu identifizieren22), würde die vielen Hypothesen um
eine neue vermehren, ohne daß das Beweismaterial
schärfster Prüfung standhielte; aber der vorzügliche
Kenner der nordböhmischen Kunst, Prof. Dr. Jos. Opitz-
Prag glaubt die böhmische Herkunft des Meisters H. W.
bejahen zu können.
Wir jedoch müssen uns angesichts der nicht von
der Hand zu weisenden latenten Stilverwandtschaft
20) Also % Jahr vor dem zitierten Vortrag Hentschels und
lK Jahr vor dem Erscheinen des Hentschel’schen Buches!
21) Mitteilung Joseph Opitz-Prag, September 1923.
22) Mitteilung Dr. Helmut Richter, September 1923.
10
Untersuchung über das größte und wichtigste Werk des
Meisters H. W. in einem neuen Geleise weitergeleitet
und zu einem für die Geistesgeschichte Freibergs (sic!)
wie für die sächsische Kunstgeschichte gleich wichtigen
Ergebnis glücklich durchgeführt zu haben.“ O. E.
Schmidt ‘spielt hierbei auf eine weder gedruckte noch
sonst veröffentlichte Leipziger Dissertation „Der Mei-
ster H. W.“ Walter Hentschels von 1923 an, zu deren
Ergebnissen die Wissenschaft also noch gar keine
Stellung nehmen konnte; sodann bezieht er sich auf
einen nichtöffentlichen Vortrag Hentschels im „Sächsi-
schen Altertumsverein“ am 3. Dezember 1925 (also eine
ganz interne Vereinsangelegenheit) über das gleiche
Thema. Einem Zeitungsbericht16) zufolge scheint es in
diesem Vortrage völlig unbegründete Ausfälle gegen an-
gebliche Opponenten Hentschels gegeben zu haben,
wenn der Referent Oskar Merker schreibt: „Es ist für
ein Volk wertvoll, erzieherisch wertvoll, wenn es auf
große Männer des eigenen Volkes hinweisen kann. Be-
denklich ist es aber, wenn beim Suchen nach solchen
leuchtenden Vorbildern vor Geschichtsfälschungen nicht
zurückgeschreckt wird. Unsere lieben Freunde inmitten
des Böhmerlandes haben freilich darin schon des öfte-
ren ein weites Gewissen gehabt. Sie möchten nun auch
den Meister H. W. für sich in Anspruch nehmen, wenig-
stens ist vor einigen Jahren in einer Dresdner Zeitung
versucht worden, die beiden Buchstaben H. W„ die bis-
her — und auch heute noch — jedem Erklärungs-
versuche spotteten, zu Hans Wozek zu ergänzen, den
Meister also zum Tschechen zu stempeln.“
Man brauchte diesen gänzlich abwegigen und
hoffentlich nur in der Hitze des Gefechtes erfolgten an-
geblichen Behauptungen Hentschels keinen Wert bei-
zulegen, wenn nicht inzwischen an immerhin äußerst
exponierter Stelle Hentschel zweimal auf diese vergeb-
liche tschechische Usurpation des Meisters H. W. von
Chemnitz demonstrativ hingewiesen hätte.17) Dem-
gegenüber ist fcstzustellen, daß die angezogene Notiz
einer Dresdner Korrespondenz18), die in die Dresdner
Nachrichten vom 8. IX. 1923 übergegangen war (ganz
abgesehen davon, daß die Meldung weder autorisiert
noch signiert war, und daß es bisher nicht üblich war,
Zeitungsenten als wissenschaftliches Quellenmaterial zu
zitieren), kein Wort davon enthielt, daß der Meister
H. W. von Chemnitz mit dem nordböhmischen Cranach-
Schüler Johann Wrtilka von Laun oder dem Monogram-
misten J. W. von Leitmeritz, Pilsen usw. identifiziert
worden sei.19) Falsche mündliche und briefliche Infor-
mationen des ehemaligen Plauener Museumsdirektors
Dr. Helmut Richter und des Prager Kunsthistorikers Dr.
10) Vgl das Referat von Oskar Merker in den „Dresdner Nach-
richten“ vom Mittwoch, d. 9. XII. 1925, Nr. 576 S. 3: „Was ist es
um den Meister H. W.“
17) Vgl. Hentschel: Sächs. Plastik um 1500, S. 48, Z. 5.
Derselbe: Thieme-Beckers Künstlerlexikon Bd. 19 (1926) S. 56—58
unter Johann von Cöln.
18) Redaktion der Pressinformation.
10) Belvedere, Zeitschrift f. Kunst u. künstl. Kultur d. Vergan-
genheit, Jahrg. 1928, Bd. 13, Heft 72, S. 138.
Joseph Opitz haben allerdings den Verfasser dieser Ab-
handlung vorübergehend auf die falsche Fährte eines
Hans Wozek (alias Gvozdec oder Wotzky) gesetzt,
doch stellte sich schon nach wenigen Tagen heraus, daß
die beiden genannten Kunstgelehrten den nord-
böhmischen Maler J. W. der Cranach-„Schule“ mit dem
erzgebirgischen „Riemenschneider-Epigonen“, dem
Monogrammisten H. W. von Chemnitz verwechselt
hatten! Hinwiederum hat tasächlich Joseph Opitz, lt.
Mitteilungen an den Verfasser, in Böhmen Arbeiten des
Meisters H. W. bezw. seiner Werkstatt in Stift Ossegg
entdeckt. Im „Kunstwanderer“ (1./2. Märzheft 1925
S. 220) schrieb ich:20)
„Die Tatsache, daß in den böhmischen Urkunden
Hans von Kolin neben einem Jakob von Nimburg ge-
nannt wird, welch letzterer für die Kuttenberger Bar-
barakirche einen Hauptaltar gearbeitet hat, von dem ein
Niederalbertsdorf bei Zwickau. (Jetzt Altertumsmuseum Dresden)
Chemnitzer Meister und Werkstattgenosse des Meisters H. W.
geschuitzterFlügel erhalten ist, macht es wahrscheinlich,
daß der Meister H. W. auch nach Böhmen geliefert hat,
wenn nicht gar dort vorübergehend tätig gewesen ist.
Ich glaube Werke des Meisters H. W. auch in Böhmen
nennen zu können, so in Prag über dem Eingang zur
Maltheser Kirche (Madonna mit Kind), ferner eine Maria
in der Komotauer Stadtkirche, eine Figur in Ossegg
u. a. in seiner Richtung (!)21). Ihn mit einem
aus Böhmen zugewanderten Hans Wotzek von Kolin
zu identifizieren22), würde die vielen Hypothesen um
eine neue vermehren, ohne daß das Beweismaterial
schärfster Prüfung standhielte; aber der vorzügliche
Kenner der nordböhmischen Kunst, Prof. Dr. Jos. Opitz-
Prag glaubt die böhmische Herkunft des Meisters H. W.
bejahen zu können.
Wir jedoch müssen uns angesichts der nicht von
der Hand zu weisenden latenten Stilverwandtschaft
20) Also % Jahr vor dem zitierten Vortrag Hentschels und
lK Jahr vor dem Erscheinen des Hentschel’schen Buches!
21) Mitteilung Joseph Opitz-Prag, September 1923.
22) Mitteilung Dr. Helmut Richter, September 1923.
10