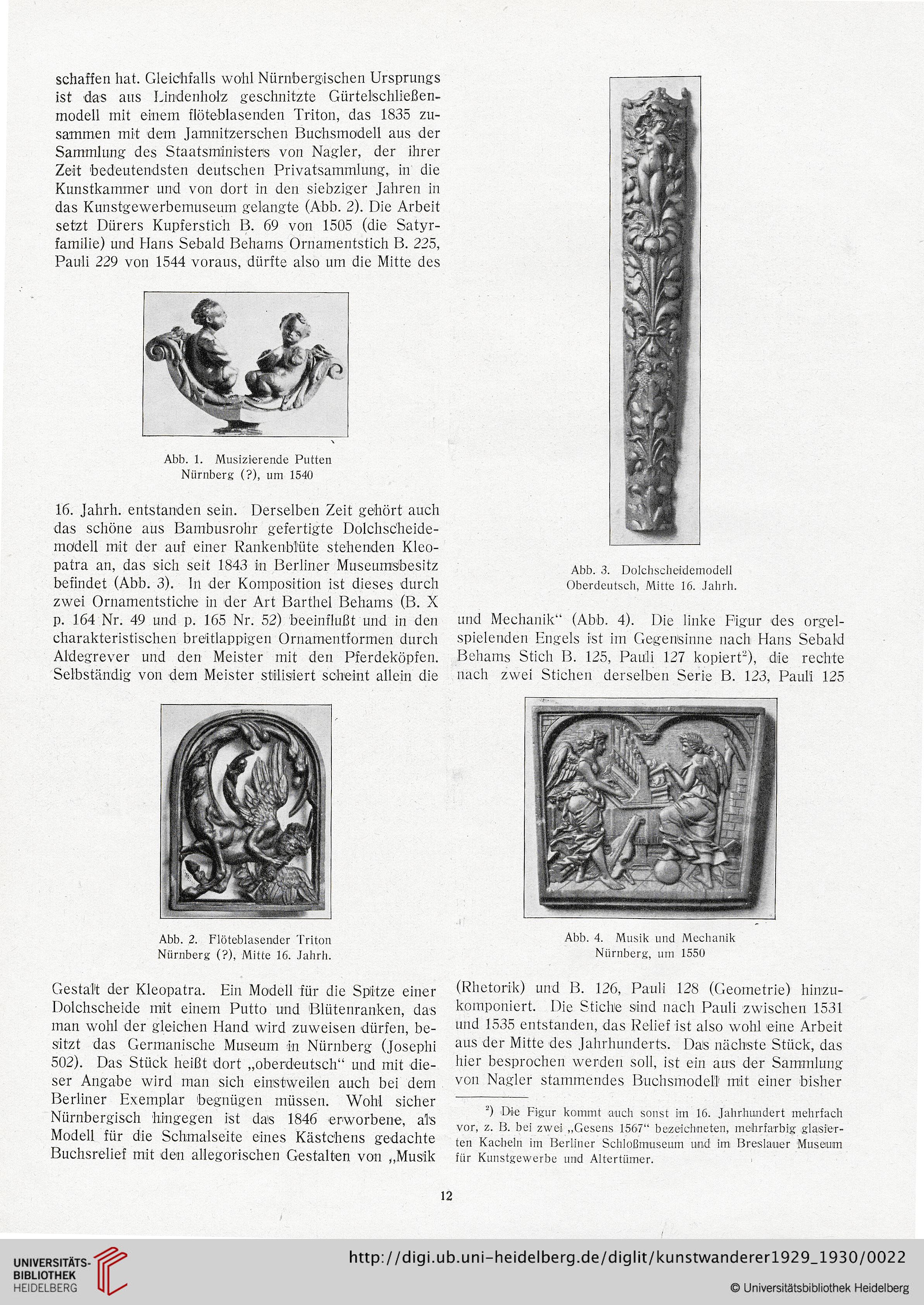Donath, Adolph [Hrsg.]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 11./12.1929/30
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.26238#0022
DOI Heft:
1./2. Septemberheft
DOI Artikel:Bethe, Hellmuth: Goldschmiedemodelle des 16. und 17. Jahrhunderts im Berliner Schloßmuseum
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.26238#0022
schaffen hat. Gleichfalls wohl Nürnbergäschen Ursprungs
ist das aus Lindenholz geschnitzte Gürtelschließen-
modell init einem flöteblasenden Triton, das 1835 zu-
sammen mit dem Jamnitzerschen Buchsmodell aus der
Sammlung des Staatsministeris von Nagler, der ihrer
Zeit bedeutendsten deutschen Privatsammlung, in die
Kunstkammer und von dort in den siebziger Jahren in
das Kunstgewerbemuseum gelangte (Abb. 2). Die Arbeit
setzt Dürers Kupferstich ß. 69 von 1505 (die Satyr-
familie) und Hans Sebald Behams Ornamentstich B. 225,
Pauli 229 von 1544 voraus, dürfte also um die Mitte des
Abb. 1. Musizierende Putten
Nürnberg (?), um 1540
16. Jahrh. entstanden sein. Derselben Zeit gehört auch
das schöne aus Bambusrohr gefertigte Dolchscheide-
tnodell mit der auf einer Rankenbl’üte stehenden Klco-
patra an, das sich seit 1843 in Berliner Museumsbesitz
befindet (Abb. 3). ln der Komposition ist dieses durch
zwei Oruamentsticbe in der Art Barthel Behams (B. X
p. 164 Nr. 49 und p. 165 Nr. 52) beeinflußt und in den
charakteristischen breitlappigen Ornamentformen durch
Aldegrever und den Meister mit den Pferdeköpfen.
Selbständig von dem Meister stilisiert scheint allein die
Abb. 2. Flöteblasender Triton
Nürnberg (?), Mitte 16. Jahrh.
Gestalt der Kleopatra. Ein Modell für die Spitze einer
Dolchscheide mit einem Putto und Blütenranken, das
man wohl der gleichen Hand wird zuweisen dürfen, be-
sitzt das Germanische Museum in Nürnberg (Josephi
502). Das Stück heißt dort „oberdeutsch“ und mit die-
ser Angabe wird man sich einstweilen auch bei dem
Berliner Exemplar begnügen müssen. Wohl sicher
Nürnbergiseh hingegen ist das 1846 erworbene, als
Modell für die Schmalseite eines Kästchens gedachte
Buchsrelief mit den allegorischen Gestalten von „Musik
Abb. 3. Dolchscheidemodell
Oberdeutsch, Mitte 16. Jahrh.
und Mechanik“ (Abb. 4). Die linke Figur des orgel-
spielenden Engels ist im Gegensinne nach Hans Sebald
Behams Stich B. 125, Pauli 127 kopiert'), die rechte
nach zwei Stichen derselben Serie B. 123, Pauli 125
Abb. 4. Musik und Mechanik
Nürnberg, um 1550
(Rhetorik) und B. 126, Pauli 128 (Geometrie) hinzu-
komponiert. Die Stiche sind nach Pauli zwischen 1531
und 1535 entstanden, das Relief ist also wohl eine Arbeit
aus der Mitte des Jahrhunderts. Das nächste Stück, das
hier besprochen werden soll, ist ein aus der Sammlung
von Nagler stammendes Buchsmodell' mit einer bisher
2) Pie Figur kommt auch sonst im 16. Jahrhundert mehrfach
vor, z. B. bei zwei „Gesens 1567“ bezeichneten, mehrfarbig glasier-
ten Kacheln im Berliner Schloßmuseum und im Breslauer Museum
für Kunstgewerbe und Altertümer.
12
ist das aus Lindenholz geschnitzte Gürtelschließen-
modell init einem flöteblasenden Triton, das 1835 zu-
sammen mit dem Jamnitzerschen Buchsmodell aus der
Sammlung des Staatsministeris von Nagler, der ihrer
Zeit bedeutendsten deutschen Privatsammlung, in die
Kunstkammer und von dort in den siebziger Jahren in
das Kunstgewerbemuseum gelangte (Abb. 2). Die Arbeit
setzt Dürers Kupferstich ß. 69 von 1505 (die Satyr-
familie) und Hans Sebald Behams Ornamentstich B. 225,
Pauli 229 von 1544 voraus, dürfte also um die Mitte des
Abb. 1. Musizierende Putten
Nürnberg (?), um 1540
16. Jahrh. entstanden sein. Derselben Zeit gehört auch
das schöne aus Bambusrohr gefertigte Dolchscheide-
tnodell mit der auf einer Rankenbl’üte stehenden Klco-
patra an, das sich seit 1843 in Berliner Museumsbesitz
befindet (Abb. 3). ln der Komposition ist dieses durch
zwei Oruamentsticbe in der Art Barthel Behams (B. X
p. 164 Nr. 49 und p. 165 Nr. 52) beeinflußt und in den
charakteristischen breitlappigen Ornamentformen durch
Aldegrever und den Meister mit den Pferdeköpfen.
Selbständig von dem Meister stilisiert scheint allein die
Abb. 2. Flöteblasender Triton
Nürnberg (?), Mitte 16. Jahrh.
Gestalt der Kleopatra. Ein Modell für die Spitze einer
Dolchscheide mit einem Putto und Blütenranken, das
man wohl der gleichen Hand wird zuweisen dürfen, be-
sitzt das Germanische Museum in Nürnberg (Josephi
502). Das Stück heißt dort „oberdeutsch“ und mit die-
ser Angabe wird man sich einstweilen auch bei dem
Berliner Exemplar begnügen müssen. Wohl sicher
Nürnbergiseh hingegen ist das 1846 erworbene, als
Modell für die Schmalseite eines Kästchens gedachte
Buchsrelief mit den allegorischen Gestalten von „Musik
Abb. 3. Dolchscheidemodell
Oberdeutsch, Mitte 16. Jahrh.
und Mechanik“ (Abb. 4). Die linke Figur des orgel-
spielenden Engels ist im Gegensinne nach Hans Sebald
Behams Stich B. 125, Pauli 127 kopiert'), die rechte
nach zwei Stichen derselben Serie B. 123, Pauli 125
Abb. 4. Musik und Mechanik
Nürnberg, um 1550
(Rhetorik) und B. 126, Pauli 128 (Geometrie) hinzu-
komponiert. Die Stiche sind nach Pauli zwischen 1531
und 1535 entstanden, das Relief ist also wohl eine Arbeit
aus der Mitte des Jahrhunderts. Das nächste Stück, das
hier besprochen werden soll, ist ein aus der Sammlung
von Nagler stammendes Buchsmodell' mit einer bisher
2) Pie Figur kommt auch sonst im 16. Jahrhundert mehrfach
vor, z. B. bei zwei „Gesens 1567“ bezeichneten, mehrfarbig glasier-
ten Kacheln im Berliner Schloßmuseum und im Breslauer Museum
für Kunstgewerbe und Altertümer.
12