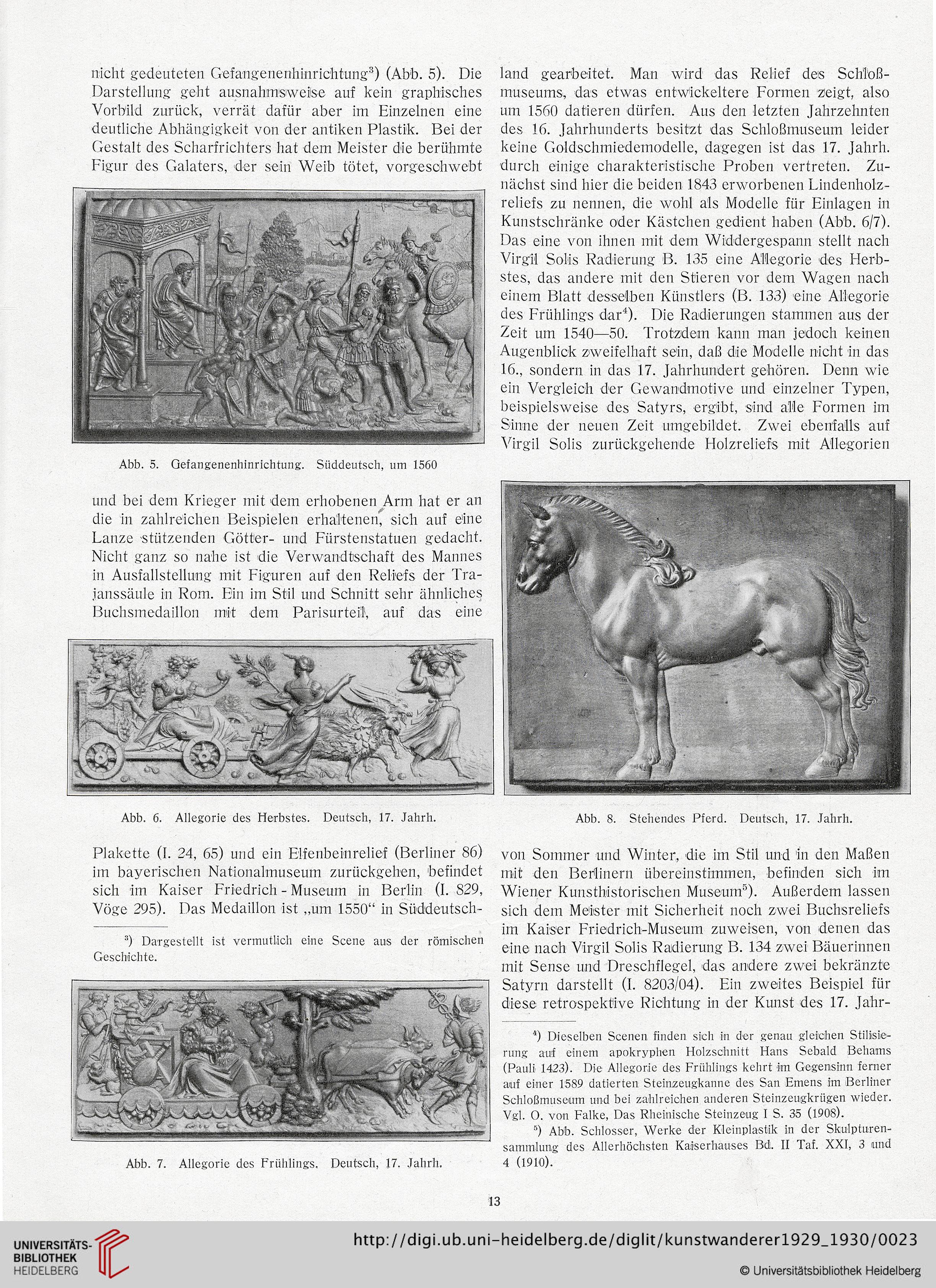Abb. 6. Allegorie des Herbstes. Deutsch, 17. Jahrh.
Abb. 8. Stehendes Pferd. Deutsch, 17. Jahrh.
land gearbeitet. Man wird das Relief deis SchToß-
museums, das etwas entwickeltere Formen zeigt, also
um 1560 datieren dürfen. Aus den letzten Jahrzehnten
des 16. Jahrhunderts besitzt das Schloßmuseum leider
keine Goldschmiedemodelle, dagegen ist das 17. Jahrh.
durch einige charakteristische Proben vertreten. Zu-
nächst sind hier die beiden 1843 erworbenen Lindenholz-
reliefs zu nennen, die wohl als Modelle für Einlagen in
Kunstschränke oder Kästchen gedient haben (Abb. 6/7).
Das eine von ihnen mit dem Widdergespann stellt nach
Virgil Solls Radierung B. 135 eine Allegorie des Herb-
stes, das andere mit den Stieren vor dem Wagen nach
einem Blatt desselben Künstlers (B. 133) eine Allegorie
des Frühlings dar4). Die Radierungen stammen aus der
Zeit um 1540—50. Trotzdem kann man jedoch keinen
Augenblick zweifelhaft sein, daß die Modelle nicht in das
16., sondern in das 17. Jahrhundert gehören. Denn wie
ein Vergleich der Gewandmotive und einzelner Typen,
beispielsweise des Satyrs, ergibt, sind alle Formen im
Sinne der neuen Zeit umgebildet. Zwei ebenfalls auf
Virgil Solis zurückgehende Holzreliefs mit Allegorien
und bei dem Krieger mit dem erhobenen Arm hat er an
die in zahlreichen Beispielen erhaltenen, sich auf eine
Lanze -stützenden Götter- und Fürstenstatuen gedacht.
Nicht ganz so nahe ist die Verwandtschaft des Mannes
in Ausfallstellung mit Figuren auf den Reliefs der Tra-
janssäule in I^om. Ein im Stil und Schnitt sehr ähnliches
Buchsmedaillon mit dem Parisurteil1, auf das eine
Plakette (I. 24, 65) und ein Elfenbeinrelief (Berliner 86)
im bayerischen Nationalmuseum zurückgehen, befindet
sich im Kaiser Friedrich - Museum in Berlin (1.829,
Vöge 295). Das Medaillon ist „um 1550“ in Süddeutsch-
3) Dargestellt ist vermutlich eine Scene aus der römischen
Geschichte.
von Sommer und Winter, die im Stil und in den Maßen
mit den Berlinern übereinstimmen, befinden sich im
Wiener Kunsthistorischen Museum5). Außerdem lassen
sich dem Meister mit Sicherheit noch zwei Buchsreliefs
im Kaiser Friedrich-Museum zuweisen, von denen das
eine nach Virgil Solis Radierung B. 134 zwei Bäuerinnen
mit Sense und Dreschflegel, das andere zwei bekränzte
Satyrn darstellt (I. 8203/04). Ein zweites Beispiel für
diese retrospektive Richtung in der Kunst des 17. Jahr-
Abb. 7. Allegorie des Frühlings, Deutsch, 17. Jahrh.
4) Dieselben Scenen finden sich in der genau gleichen Stilisie-
rung auf einem apokryphen Holzschnitt Hans Sebald Behams
(Pauli 1423). Die Allegorie des Frühlings kehrt im Gegensinn ferner
aiuf einer 1589 datierten Steinzeugkanne des San Emens im Berliner
Schloßmuseum und bei zahlreichen anderen Steinzeugkrügen wieder.
Vgl. O. von Falke, Das Rheinische Steinzeug I S. 35 (1908).
5) Abb. Schlosser, Werke der Kleinplastik in der Skulpturen-
sammlung des Allerhöchsten Kaiserhauses Bd. II Taf. XXI, 3 und
4 (1910).
nicht gedeuteten Gefangenenhinrichtung3) (Abb. 5). Die
Darstellung geht ausnahmsweise auf kein graphisches
Vorbild zurück, verrät dafür aber im Einzelnen eine
deutliche Abhängigkeit von der antiken Plastik. Bei der
Gestalt des Scharfrichters hat dem Meister die berühmte
Figur des Galaters, der sein Weib tötet, vorgeschwebt
Abb. 5. Gefangenenhinrichtung. Süddeutsch, um 1560
13
Abb. 8. Stehendes Pferd. Deutsch, 17. Jahrh.
land gearbeitet. Man wird das Relief deis SchToß-
museums, das etwas entwickeltere Formen zeigt, also
um 1560 datieren dürfen. Aus den letzten Jahrzehnten
des 16. Jahrhunderts besitzt das Schloßmuseum leider
keine Goldschmiedemodelle, dagegen ist das 17. Jahrh.
durch einige charakteristische Proben vertreten. Zu-
nächst sind hier die beiden 1843 erworbenen Lindenholz-
reliefs zu nennen, die wohl als Modelle für Einlagen in
Kunstschränke oder Kästchen gedient haben (Abb. 6/7).
Das eine von ihnen mit dem Widdergespann stellt nach
Virgil Solls Radierung B. 135 eine Allegorie des Herb-
stes, das andere mit den Stieren vor dem Wagen nach
einem Blatt desselben Künstlers (B. 133) eine Allegorie
des Frühlings dar4). Die Radierungen stammen aus der
Zeit um 1540—50. Trotzdem kann man jedoch keinen
Augenblick zweifelhaft sein, daß die Modelle nicht in das
16., sondern in das 17. Jahrhundert gehören. Denn wie
ein Vergleich der Gewandmotive und einzelner Typen,
beispielsweise des Satyrs, ergibt, sind alle Formen im
Sinne der neuen Zeit umgebildet. Zwei ebenfalls auf
Virgil Solis zurückgehende Holzreliefs mit Allegorien
und bei dem Krieger mit dem erhobenen Arm hat er an
die in zahlreichen Beispielen erhaltenen, sich auf eine
Lanze -stützenden Götter- und Fürstenstatuen gedacht.
Nicht ganz so nahe ist die Verwandtschaft des Mannes
in Ausfallstellung mit Figuren auf den Reliefs der Tra-
janssäule in I^om. Ein im Stil und Schnitt sehr ähnliches
Buchsmedaillon mit dem Parisurteil1, auf das eine
Plakette (I. 24, 65) und ein Elfenbeinrelief (Berliner 86)
im bayerischen Nationalmuseum zurückgehen, befindet
sich im Kaiser Friedrich - Museum in Berlin (1.829,
Vöge 295). Das Medaillon ist „um 1550“ in Süddeutsch-
3) Dargestellt ist vermutlich eine Scene aus der römischen
Geschichte.
von Sommer und Winter, die im Stil und in den Maßen
mit den Berlinern übereinstimmen, befinden sich im
Wiener Kunsthistorischen Museum5). Außerdem lassen
sich dem Meister mit Sicherheit noch zwei Buchsreliefs
im Kaiser Friedrich-Museum zuweisen, von denen das
eine nach Virgil Solis Radierung B. 134 zwei Bäuerinnen
mit Sense und Dreschflegel, das andere zwei bekränzte
Satyrn darstellt (I. 8203/04). Ein zweites Beispiel für
diese retrospektive Richtung in der Kunst des 17. Jahr-
Abb. 7. Allegorie des Frühlings, Deutsch, 17. Jahrh.
4) Dieselben Scenen finden sich in der genau gleichen Stilisie-
rung auf einem apokryphen Holzschnitt Hans Sebald Behams
(Pauli 1423). Die Allegorie des Frühlings kehrt im Gegensinn ferner
aiuf einer 1589 datierten Steinzeugkanne des San Emens im Berliner
Schloßmuseum und bei zahlreichen anderen Steinzeugkrügen wieder.
Vgl. O. von Falke, Das Rheinische Steinzeug I S. 35 (1908).
5) Abb. Schlosser, Werke der Kleinplastik in der Skulpturen-
sammlung des Allerhöchsten Kaiserhauses Bd. II Taf. XXI, 3 und
4 (1910).
nicht gedeuteten Gefangenenhinrichtung3) (Abb. 5). Die
Darstellung geht ausnahmsweise auf kein graphisches
Vorbild zurück, verrät dafür aber im Einzelnen eine
deutliche Abhängigkeit von der antiken Plastik. Bei der
Gestalt des Scharfrichters hat dem Meister die berühmte
Figur des Galaters, der sein Weib tötet, vorgeschwebt
Abb. 5. Gefangenenhinrichtung. Süddeutsch, um 1560
13