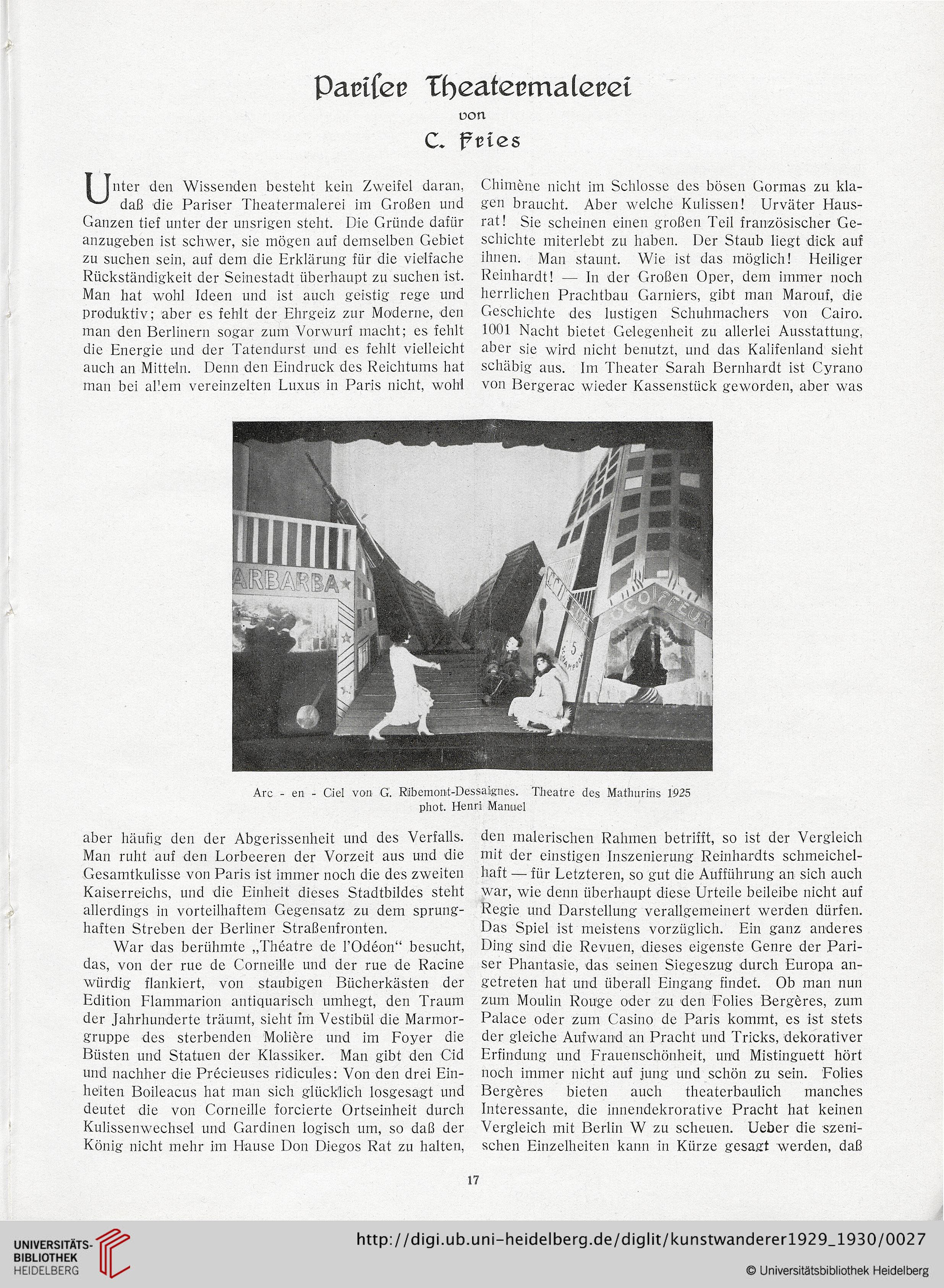Pavifev Tf)eateümalet’et
üon
C. ftnes
I Inter den Wissenden besteht kein Zweifel daran,
daß die Pariser Theatermalerei im Großen und
Ganzen tief unter der unsrigen steht. Die Gründe dafür
anzugeben ist schwer, sie mögen auf demselben Gebiet
zu suchen sein, auf dem die Erklärung für die vielfache
Rückständigkeit der Seinestadt überhaupt zu suchen ist.
Man hat wohl Ideen und ist auch geistig rege und
produktiv; aber es fehlt der Ehrgeiz zur Moderne, den
man den Berlinern sogar zum Vorwurf macht; es fehlt
die Energie und der Tatendurst und es fehlt vielleicht
auch an Mitteln. Denn den Eindruck des Reichtums hat
man bei allem vereinzelten Luxus in Paris nicht, wohl
Chimene nicht im Schlosse des bösen Gormas zu kla-
gen braucht. Aber welche Kulissen! Urväter Haus-
rat! Sie scheinen einen großen Teil französischer Ge-
schichte miterlebt zu haben. Der Staub liegt dick auf
ihnen. Man staunt. Wie ist das möglich! Heiliger
Reinhardt! — In der Großen Oper, dem immer noch
herrlichen Prachtbau Garniers, gibt man Marouf, die
Geschichte des lustigen Schuhmachers von Cairo.
1001 Nacht bietet Gelegenheit zu allerlei Ausstattung,
aber sie wird nicht benutzt, und das Kalifenland sieht
schäbig aus. Im Theater Sarah Bernhardt ist Cyrano
von Bergerac wieder Kassenstück geworden, aber was
Are - en - CM von G'. Räbemonit-Dessaignes. Tbeatre des Mathurins 1925
phot. Henri Manuel
aber häufig den der Abgerissenheit und des Verfalls.
Man ruht auf den Lorbeeren der Vorzeit aus und die
Gesamtkulisse von Paris ist immer noch die des zweiten
Kaiserreichs, und die Einheit dieses Stadtbildes steht
allerdings in vorteilhaftem Gegensatz zu dem sprung-
haften Streben der Berliner Straßenfronten.
War das berühmte „Theatre de l’Odeon“ besucht,
das, von der rue de Corneille und der rue de Racine
würdig flankiert, von staubigen Bücherkästen der
Edition Flammarion antiquarisch umhegt, den Traum
der Jahrhunderte träumt, sieht im Vestibül die Marmor-
gruppe des sterbenden Moliere und im Foyer die
Büsten und Statuen der Klassiker. Man gibt den Cid
und nachher die Precieuses ridicules: Von den drei Ein-
heiten Boileacus hat man sich glücklich losgesagt und
deutet die von Corneille forcierte Ortseinheit durch
Kulissenwechsel und Gardinen logisch um, so daß der
König nicht mehr im Hause Don Diegos Rat zu halten,
den malerischen Rahmen betrifft, so ist der Vergleich
mit der einstigen Inszenierung Reinhardts schmeichel-
haft — für Letzteren, so gut die Aufführung an sich auch
war, wie denn überhaupt diese Urteile beileibe nicht auf
Regie und Darstellung verallgemeinert werden dürfen.
Das Spiel ist meistens vorzüglich. Ein ganz anderes
Ding sind die Revuen, dieses eigenste Genre der Pari-
ser Phantasie, das seinen Siegeszug durch Europa an-
getreten hat und überall Eingang findet. Ob man nun
zum Moulin Rouge oder zu den Folies Bergeres, zum
Palace oder zum Casino de Paris kommt, es ist stets
der gleiche Aufwand an Pracht und Tricks, dekorativer
Erfindung und Frauenschönheit, und Mistinguett hört
noch immer nicht auf jung und schön zu sein. Folies
Bergeres bieten auch theaterbaulich manches
Interessante, die innendekrorative Pracht hat keinen
Vergleich mit Berlin W zu scheuen. Ucbcr die szeni-
schen Einzelheiten kann in Kürze gesagt werden, daß
17
üon
C. ftnes
I Inter den Wissenden besteht kein Zweifel daran,
daß die Pariser Theatermalerei im Großen und
Ganzen tief unter der unsrigen steht. Die Gründe dafür
anzugeben ist schwer, sie mögen auf demselben Gebiet
zu suchen sein, auf dem die Erklärung für die vielfache
Rückständigkeit der Seinestadt überhaupt zu suchen ist.
Man hat wohl Ideen und ist auch geistig rege und
produktiv; aber es fehlt der Ehrgeiz zur Moderne, den
man den Berlinern sogar zum Vorwurf macht; es fehlt
die Energie und der Tatendurst und es fehlt vielleicht
auch an Mitteln. Denn den Eindruck des Reichtums hat
man bei allem vereinzelten Luxus in Paris nicht, wohl
Chimene nicht im Schlosse des bösen Gormas zu kla-
gen braucht. Aber welche Kulissen! Urväter Haus-
rat! Sie scheinen einen großen Teil französischer Ge-
schichte miterlebt zu haben. Der Staub liegt dick auf
ihnen. Man staunt. Wie ist das möglich! Heiliger
Reinhardt! — In der Großen Oper, dem immer noch
herrlichen Prachtbau Garniers, gibt man Marouf, die
Geschichte des lustigen Schuhmachers von Cairo.
1001 Nacht bietet Gelegenheit zu allerlei Ausstattung,
aber sie wird nicht benutzt, und das Kalifenland sieht
schäbig aus. Im Theater Sarah Bernhardt ist Cyrano
von Bergerac wieder Kassenstück geworden, aber was
Are - en - CM von G'. Räbemonit-Dessaignes. Tbeatre des Mathurins 1925
phot. Henri Manuel
aber häufig den der Abgerissenheit und des Verfalls.
Man ruht auf den Lorbeeren der Vorzeit aus und die
Gesamtkulisse von Paris ist immer noch die des zweiten
Kaiserreichs, und die Einheit dieses Stadtbildes steht
allerdings in vorteilhaftem Gegensatz zu dem sprung-
haften Streben der Berliner Straßenfronten.
War das berühmte „Theatre de l’Odeon“ besucht,
das, von der rue de Corneille und der rue de Racine
würdig flankiert, von staubigen Bücherkästen der
Edition Flammarion antiquarisch umhegt, den Traum
der Jahrhunderte träumt, sieht im Vestibül die Marmor-
gruppe des sterbenden Moliere und im Foyer die
Büsten und Statuen der Klassiker. Man gibt den Cid
und nachher die Precieuses ridicules: Von den drei Ein-
heiten Boileacus hat man sich glücklich losgesagt und
deutet die von Corneille forcierte Ortseinheit durch
Kulissenwechsel und Gardinen logisch um, so daß der
König nicht mehr im Hause Don Diegos Rat zu halten,
den malerischen Rahmen betrifft, so ist der Vergleich
mit der einstigen Inszenierung Reinhardts schmeichel-
haft — für Letzteren, so gut die Aufführung an sich auch
war, wie denn überhaupt diese Urteile beileibe nicht auf
Regie und Darstellung verallgemeinert werden dürfen.
Das Spiel ist meistens vorzüglich. Ein ganz anderes
Ding sind die Revuen, dieses eigenste Genre der Pari-
ser Phantasie, das seinen Siegeszug durch Europa an-
getreten hat und überall Eingang findet. Ob man nun
zum Moulin Rouge oder zu den Folies Bergeres, zum
Palace oder zum Casino de Paris kommt, es ist stets
der gleiche Aufwand an Pracht und Tricks, dekorativer
Erfindung und Frauenschönheit, und Mistinguett hört
noch immer nicht auf jung und schön zu sein. Folies
Bergeres bieten auch theaterbaulich manches
Interessante, die innendekrorative Pracht hat keinen
Vergleich mit Berlin W zu scheuen. Ucbcr die szeni-
schen Einzelheiten kann in Kürze gesagt werden, daß
17