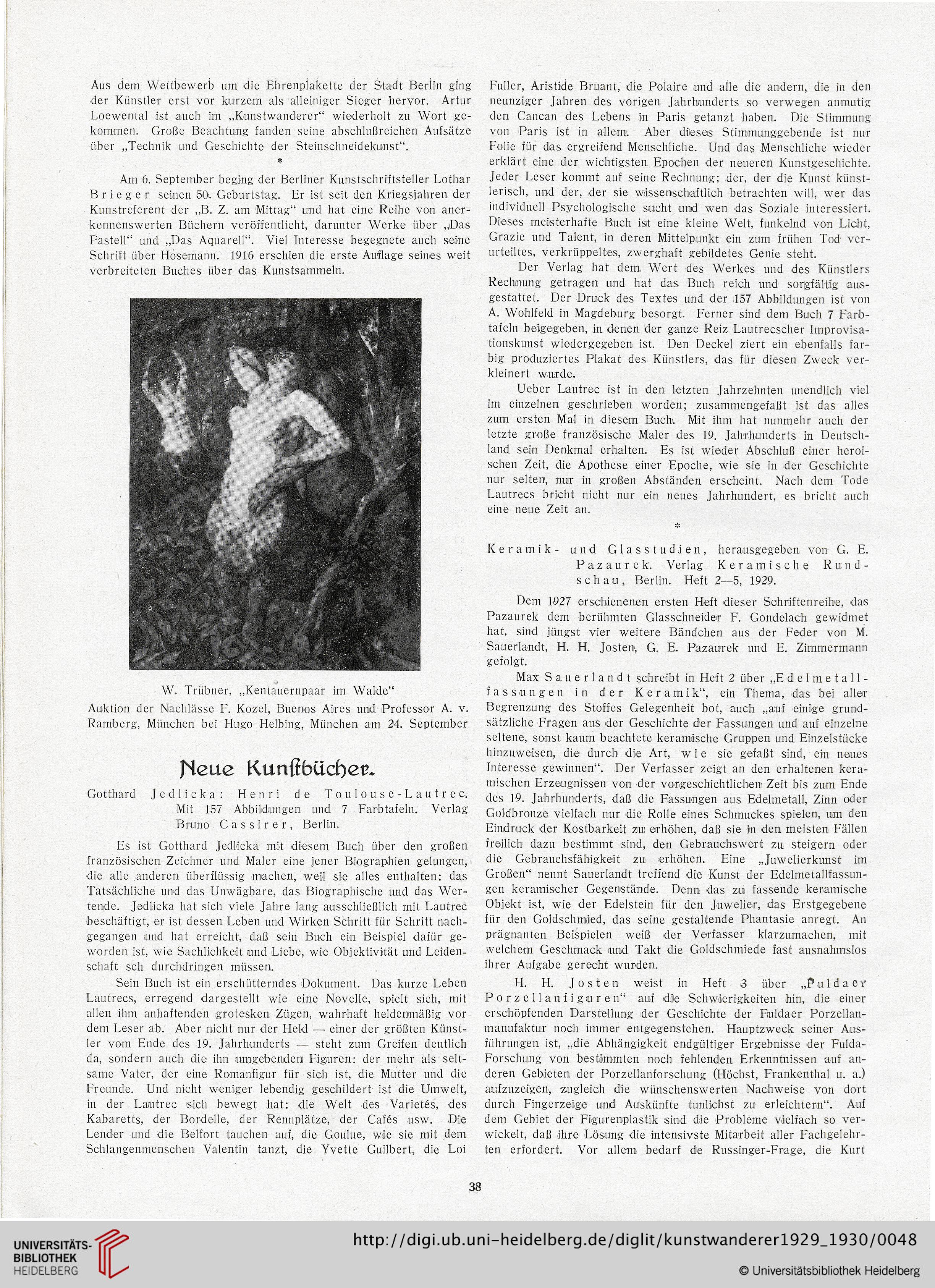Aus dem Wettbewerb um die Ehrenpiakette der Stadt Berlin ging
der Künstler erst vor kurzem als alleiniger Sieger hervor. Artur
Loewental ist auch im „Kunstwanderer“ wiederholt zu Wort ge-
kommen. Große Beachtung fanden seine abschlußreichen Aufsätze
über „Technik und Geschichte der Steinschneidekunst“.
*
Am 6. September beging der Berliner Kunstschriftsteller Lothar
B r i e g e r seinen 50. Geburtstag. Er ist seit den Kriegs]ähren, der
Kunstreferent der „B. Z. am Mittag“ und hat eine Reihe von aner-
kennenswerten Büchern veröffentlicht, darunter Werke über „Das
Pastell“ und „Das Aquarell“. Viel Interesse begegnete auch seine
Schrift über Hosemann. 1916 erschien die erste Auflage seines weit
verbreiteten Buches über das Kunstsammeln.
W. Trübner, „Kentauernpaar im Walde“
Auktion der Nachlässe F. Kozel, Buenos Aires und Professor A. v.
Ramberg, München bei Hugo Helbing, München am 24. September
Heile Kunffbücbet?.
Gotthard Jedlicka: Henri de Toulouse-Lautrec.
Mit 157 Abbildungen und 7 Farbtafeln. Verlag
Bruno Cassirer, Berlin.
Es ist Gotthard Jedlicka mit diesem Buch über den großen
französischen Zeichner und Maler eine jener Biographien gelungen,
die alle anderen überflüssig machen, weil sie alles enthalten: das
Tatsächliche und das Unwägbare, das Biographische und das Wer-
tende. Jedlicka hat sich viele Jahre lang ausschließlich mit Lautrec
beschäftigt, er ist dessen Leben und Wirken Schritt für Schritt nach-
gegangen und hat erreicht, daß sein Buch ein Beispiel dafür ge-
worden ist, wie Sachlichkeit und Liebe, wie Objektivität und Leiden-
schaft sch durchdringen müssen.
Sein Buch ist ein erschütterndes Dokument. Das kurze Leben
Lautrecs, erregend dargestellt wie eine Novelle, spielt sich, mit
allen ihm anhaftenden grotesken Zügen, wahrhaft heldenmäßig vor
dem Leser ab. Aber nicht nur der Held — einer der größten Künst-
ler vom Ende des 19. Jahrhunderts — steht zum Greifen deutlich
da, sondern auch die ihn umgebenden Figuren: der mehr als selt-
same Vater, der eine Romanfigur für sich ist, die Mutter und die
Freunde. Und nicht weniger lebendig geschildert ist die Umwelt,
in der Lautrec sich bewegt hat: die Welt des Varietes, des
Kabaretts, der Bordelle, der Rennplätze, der Cafes usw. Die
Lender und die Beifort tauchen auf, die Goulue, wie sie mit dem
Schlangenmenschen Valentin tanzt, die Yvette Guilbert, die Loi
Füller, Aristide Bruant, die Polaire und alle die andern, die in den
neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts so verwegen anmutig
den Cancan des Lebens in Paris getanzt haben. Die Stimmung
von Paris ist in allem. Aber dieses Stimmunggebende ist nur
Folie für das ergreifend Menschliche. Und das Menschliche wieder
erklärt eine der wichtigsten Epochen der neueren Kunstgeschichte.
Jeder Leser kommt auf seine Rechnung; der, der die Kunst künst-
lerisch, und der, der sie wissenschaftlich betrachten will, wer das
individuell Psychologische sucht und wen das Soziale interessiert.
Dieses meisterhafte Buch ist eine kleine Welt, funkelnd von Licht,
Grazie und Talent, in deren Mittelpunkt ein zum frühen Tod ver-
urteiltes, verkrüppeltes, zwerghaft gebildetes Genie steht.
Der Verlag hat dem. Wert des Werkes und des Künstlers
Rechnung getragen und hat das Buch reich und sorgfältig aus-
gestattet. Der Druck des Textes und der 157 Abbildungen ist von
A. Wohlfeld in Magdeburg besorgt. Ferner sind dem Buch 7 Farb-
tafeln beigegeben, in denen der ganze Reiz Lautrecscher Improvisa-
tionskunst wiedergegeben ist. Den Deckel ziert ein ebenfalls far-
big produziertes Plakat des Künstlers, das für diesen Zweck ver-
kleinert wurde.
Ueber Lautrec ist in den letzten Jahrzehnten unendlich viel
im einzelnen geschrieben worden; zusammengefaßt ist das alles
zum ersten Mal in diesem Buch. Mit ihm hat nunmehr auch der
letzte große französische Maler des 19. Jahrhunderts in Deutsch-
land sein Denkmal erhalten. Es ist wieder Abschluß einer heroi-
schen Zeit, die Apothese einer Epoche, wie sie in der Geschichte
nur selten, nur in großen Abständen erscheint. Nach dem Tode
Lautrecs bricht nicht nur ein neues Jahrhundert, es bricht auch
eine neue Zeit an.
Keramik- und Glasstudien, herausgegeben von G. E.
Pazaurek. Verlag Keramische Rund-
schau, Berlin. Heft 2—5, 1929.
Dem 1927 erschienenen ersten Heft dieser Schriftenreihe, das
Pazaurek dem berühmten Glasschneider F. Gondelach gewidmet
hat, sind jüngst vier weitere Bändchen aus der Feder von M.
Sauerlandt, H. H. Josten, G. E. Pazaurek und E. Zimmermann
gefolgt.
Max Sauerlandt schreibt in Heft 2 über „Edelmetall-
fassungen in der Keramik“, ein Thema, das bei aller
Begrenzung des Stoffes Gelegenheit bot, auch „auf einige grund-
sätzliche Fragen aus der Geschichte der Fassungen und auf einzelne
seltene, sonst kaum beachtete keramische Gruppen und Einzelstücke
hinzuweisen, die durch die Art, wie sie gefaßt sind, ein neues
Interesse gewinnen“. Der Verfasser zeigt an den erhaltenen kera-
mischen Erzeugnissen von der vorgeschichtlichen Zeit bis zum Ende
des 19. Jahrhunderts, daß die Fassungen aus Edelmetall, Zinn oder
Goldbronze vielfach nur die Rolle eines Schmuckes spielen, um den
Eindruck der Kostbarkeit m erhöhen, daß sie in den meisten Fällen
freilich dazu bestimmt sind, den Gebrauchswert zu steigern oder
die Gebrauchsfähigkeit zu erhöhen. Eine „Juwelierkunst im
Großen“ nennt Sauerlandt treffend die Kunst der Edelmetallfassun-
gen keramischer Gegenstände. Denn das zui fassende keramische
Objekt ist, wie der Edelstein für den Juwelier, das Erstgegebene
für den Goldschmied, das seine gestaltende Phantasie anregt. An
prägnanten Beispielen weiß der Verfasser klarzumachen, mit
welchem Geschmack und Takt die Goldschmiede fast ausnahmslos
ihrer Aufgabe gerecht wurden.
H. H. Josten weist in Heft 3 über „Puldaev
P o r z e 11 a n f i g u r e n“ auf die Schwierigkeiten hin, die einer
erschöpfenden Darstellung der Geschichte der Fuldaer Porzellan-
manufaktur noch immer entgegenstehen. Hauptzweck seiner Aus-
führungen ist, „die Abhängigkeit endgültiger Ergebnisse der Fulda-
Forschung von bestimmten noch fehlenden Erkenntnissen auf an-
deren Gebieten .der Porzellanforschung (Höchst, Frankenthal u. a.)
aufzuzeigen, zugleich die wünschenswerten Nachweise von dort
durch Fingerzeige und Auskünfte tunlichst zu erleichtern“. Auf
dem Gebiet der Fi-gurenplastik sind die Probleme vielfach so ver-
wickelt, daß ihre Lösung die intensivste Mitarbeit aller Fachgelehr-
ten erfordert. Vor allem bedarf de Russinger-Frage, die Kurt
38
der Künstler erst vor kurzem als alleiniger Sieger hervor. Artur
Loewental ist auch im „Kunstwanderer“ wiederholt zu Wort ge-
kommen. Große Beachtung fanden seine abschlußreichen Aufsätze
über „Technik und Geschichte der Steinschneidekunst“.
*
Am 6. September beging der Berliner Kunstschriftsteller Lothar
B r i e g e r seinen 50. Geburtstag. Er ist seit den Kriegs]ähren, der
Kunstreferent der „B. Z. am Mittag“ und hat eine Reihe von aner-
kennenswerten Büchern veröffentlicht, darunter Werke über „Das
Pastell“ und „Das Aquarell“. Viel Interesse begegnete auch seine
Schrift über Hosemann. 1916 erschien die erste Auflage seines weit
verbreiteten Buches über das Kunstsammeln.
W. Trübner, „Kentauernpaar im Walde“
Auktion der Nachlässe F. Kozel, Buenos Aires und Professor A. v.
Ramberg, München bei Hugo Helbing, München am 24. September
Heile Kunffbücbet?.
Gotthard Jedlicka: Henri de Toulouse-Lautrec.
Mit 157 Abbildungen und 7 Farbtafeln. Verlag
Bruno Cassirer, Berlin.
Es ist Gotthard Jedlicka mit diesem Buch über den großen
französischen Zeichner und Maler eine jener Biographien gelungen,
die alle anderen überflüssig machen, weil sie alles enthalten: das
Tatsächliche und das Unwägbare, das Biographische und das Wer-
tende. Jedlicka hat sich viele Jahre lang ausschließlich mit Lautrec
beschäftigt, er ist dessen Leben und Wirken Schritt für Schritt nach-
gegangen und hat erreicht, daß sein Buch ein Beispiel dafür ge-
worden ist, wie Sachlichkeit und Liebe, wie Objektivität und Leiden-
schaft sch durchdringen müssen.
Sein Buch ist ein erschütterndes Dokument. Das kurze Leben
Lautrecs, erregend dargestellt wie eine Novelle, spielt sich, mit
allen ihm anhaftenden grotesken Zügen, wahrhaft heldenmäßig vor
dem Leser ab. Aber nicht nur der Held — einer der größten Künst-
ler vom Ende des 19. Jahrhunderts — steht zum Greifen deutlich
da, sondern auch die ihn umgebenden Figuren: der mehr als selt-
same Vater, der eine Romanfigur für sich ist, die Mutter und die
Freunde. Und nicht weniger lebendig geschildert ist die Umwelt,
in der Lautrec sich bewegt hat: die Welt des Varietes, des
Kabaretts, der Bordelle, der Rennplätze, der Cafes usw. Die
Lender und die Beifort tauchen auf, die Goulue, wie sie mit dem
Schlangenmenschen Valentin tanzt, die Yvette Guilbert, die Loi
Füller, Aristide Bruant, die Polaire und alle die andern, die in den
neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts so verwegen anmutig
den Cancan des Lebens in Paris getanzt haben. Die Stimmung
von Paris ist in allem. Aber dieses Stimmunggebende ist nur
Folie für das ergreifend Menschliche. Und das Menschliche wieder
erklärt eine der wichtigsten Epochen der neueren Kunstgeschichte.
Jeder Leser kommt auf seine Rechnung; der, der die Kunst künst-
lerisch, und der, der sie wissenschaftlich betrachten will, wer das
individuell Psychologische sucht und wen das Soziale interessiert.
Dieses meisterhafte Buch ist eine kleine Welt, funkelnd von Licht,
Grazie und Talent, in deren Mittelpunkt ein zum frühen Tod ver-
urteiltes, verkrüppeltes, zwerghaft gebildetes Genie steht.
Der Verlag hat dem. Wert des Werkes und des Künstlers
Rechnung getragen und hat das Buch reich und sorgfältig aus-
gestattet. Der Druck des Textes und der 157 Abbildungen ist von
A. Wohlfeld in Magdeburg besorgt. Ferner sind dem Buch 7 Farb-
tafeln beigegeben, in denen der ganze Reiz Lautrecscher Improvisa-
tionskunst wiedergegeben ist. Den Deckel ziert ein ebenfalls far-
big produziertes Plakat des Künstlers, das für diesen Zweck ver-
kleinert wurde.
Ueber Lautrec ist in den letzten Jahrzehnten unendlich viel
im einzelnen geschrieben worden; zusammengefaßt ist das alles
zum ersten Mal in diesem Buch. Mit ihm hat nunmehr auch der
letzte große französische Maler des 19. Jahrhunderts in Deutsch-
land sein Denkmal erhalten. Es ist wieder Abschluß einer heroi-
schen Zeit, die Apothese einer Epoche, wie sie in der Geschichte
nur selten, nur in großen Abständen erscheint. Nach dem Tode
Lautrecs bricht nicht nur ein neues Jahrhundert, es bricht auch
eine neue Zeit an.
Keramik- und Glasstudien, herausgegeben von G. E.
Pazaurek. Verlag Keramische Rund-
schau, Berlin. Heft 2—5, 1929.
Dem 1927 erschienenen ersten Heft dieser Schriftenreihe, das
Pazaurek dem berühmten Glasschneider F. Gondelach gewidmet
hat, sind jüngst vier weitere Bändchen aus der Feder von M.
Sauerlandt, H. H. Josten, G. E. Pazaurek und E. Zimmermann
gefolgt.
Max Sauerlandt schreibt in Heft 2 über „Edelmetall-
fassungen in der Keramik“, ein Thema, das bei aller
Begrenzung des Stoffes Gelegenheit bot, auch „auf einige grund-
sätzliche Fragen aus der Geschichte der Fassungen und auf einzelne
seltene, sonst kaum beachtete keramische Gruppen und Einzelstücke
hinzuweisen, die durch die Art, wie sie gefaßt sind, ein neues
Interesse gewinnen“. Der Verfasser zeigt an den erhaltenen kera-
mischen Erzeugnissen von der vorgeschichtlichen Zeit bis zum Ende
des 19. Jahrhunderts, daß die Fassungen aus Edelmetall, Zinn oder
Goldbronze vielfach nur die Rolle eines Schmuckes spielen, um den
Eindruck der Kostbarkeit m erhöhen, daß sie in den meisten Fällen
freilich dazu bestimmt sind, den Gebrauchswert zu steigern oder
die Gebrauchsfähigkeit zu erhöhen. Eine „Juwelierkunst im
Großen“ nennt Sauerlandt treffend die Kunst der Edelmetallfassun-
gen keramischer Gegenstände. Denn das zui fassende keramische
Objekt ist, wie der Edelstein für den Juwelier, das Erstgegebene
für den Goldschmied, das seine gestaltende Phantasie anregt. An
prägnanten Beispielen weiß der Verfasser klarzumachen, mit
welchem Geschmack und Takt die Goldschmiede fast ausnahmslos
ihrer Aufgabe gerecht wurden.
H. H. Josten weist in Heft 3 über „Puldaev
P o r z e 11 a n f i g u r e n“ auf die Schwierigkeiten hin, die einer
erschöpfenden Darstellung der Geschichte der Fuldaer Porzellan-
manufaktur noch immer entgegenstehen. Hauptzweck seiner Aus-
führungen ist, „die Abhängigkeit endgültiger Ergebnisse der Fulda-
Forschung von bestimmten noch fehlenden Erkenntnissen auf an-
deren Gebieten .der Porzellanforschung (Höchst, Frankenthal u. a.)
aufzuzeigen, zugleich die wünschenswerten Nachweise von dort
durch Fingerzeige und Auskünfte tunlichst zu erleichtern“. Auf
dem Gebiet der Fi-gurenplastik sind die Probleme vielfach so ver-
wickelt, daß ihre Lösung die intensivste Mitarbeit aller Fachgelehr-
ten erfordert. Vor allem bedarf de Russinger-Frage, die Kurt
38