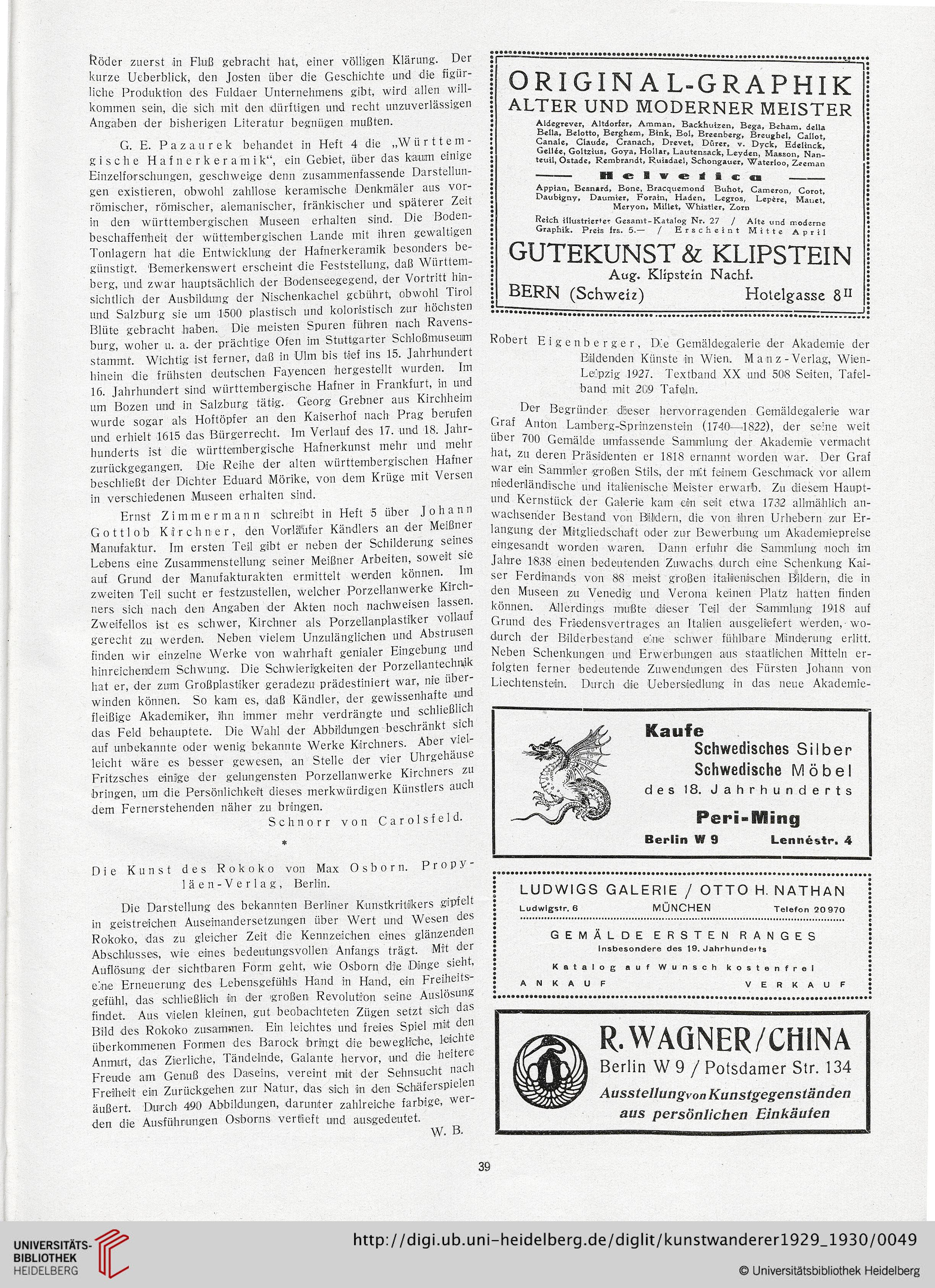Röder zuerst in Fluß gebracht hat, einer völligen Klärung. Der
kurze Ueberblick, den Josten über die Geschichte und die figür-
liche Produktion des Fuldaer Unternehmens gibt, wird allen will-
kommen sein, die sich mit den dürftigen, und recht unzuverlässigen
Angaben der bisherigen Literatur begnügen mußten.
G. E. Pazaurek behandet in Heft 4 die „W ü r 11 e m -
gische Hafnerkeramik“, ein Gebiet, über das kaum einige
Einzelforschungen, geschweige denn zusammenfassende Darstellun-
gen existieren, obwohl zahllose keramische Denkmäler aus vor-
römischer, römischer, alemanischer, fränkischer und späterer Zeit
in den württembergischen Museen erhalten sind. Die Boden-
beschaffenheit der wüttembergischen Lande mit ihren gewaltigen
Tonlagern hat die Entwicklung der Hafnerkeramik besonders be-
günstigt. Bemerkenswert erscheint die Feststellung, daß Württem-
berg, und zwar hauptsächlich der Bodenseegegend, der Vortritt hin-
sichtlich der Ausbildung der Nischenkachel gebührt, obwohl Tirol
und Salzburg sie um 1500 plastisch und koloristisch zur höchsten
Blüte gebracht haben. Die meisten Spuren führen nach Ravens-
burg, woher u. a. der prächtige Ofen im Stuttgarter Schloßmuseum
stammt. Wichtig ist ferner, daß in Ulm bis tief ins 15. Jahrhundert
hinein die frühsten deutschen Fayencen hergestellt wurden. Im
16. Jahrhundert sind württembergische Hafner in Frankfurt, in und
um Bozen und in Salzburg tätig. Georg Grebner aus Kirchheim
wurde sogar als Hoftöpfer an den Kaiserhof nach Prag berufen
und erhielt 1615 das Bürgerrecht. Im Verlauf des 17. und 18. Jahr-
hunderts ist die württembergische Hafnerkunst mehr und mehr
zurückgegangen. Die Reihe der alten württembergischen Hafner
beschließt der Dichter Eduard Mörike, von dem Krüge mit Versen
in verschiedenen Museen erhalten sind.
Ernst Zimmermann schreibt in Heft 5 über Johann
Gottlob Kirchner, den Vorlifhfer Kändlers an der Meißner
Manufaktur. Im ersten Teil gibt er neben der Schilderung seines
Lebens eine Zusammenstellung seiner Meißner Arbeiten, soweit sie
auf Grund der Manufakturakten ermittelt werden können. Im
zweiten Teil sucht er festzustellen, welcher Porzellanwerke Kirch-
ners sich nach den Angaben der Akten noch nachweisen lassen.
Zweifellos ist es schwer, Kirchner als Porzellanplastiker vollauf
gerecht zu werden. Neben vielem Unzulänglichen und Abstrusen
finden wir einzelne Werke von wahrhaft genialer Eingebung und
hinreichendem Schwung. Die Schwierigkeiten der Porzellantechmk
hat er, der zum Großplastiker geradezu prädestiniert war, nie über-
winden können. So kam es, daß Kandier, der gewissenhafte und
fleißige Akademiker, ihn immer mehr verdrängte und schließlich
das Feld behauptete. Die Wahl der Abbildungen beschränkt sich
auf unbekannte oder wenig bekannte Werke Kirchners. Aber viel-
leicht wäre es besser gewesen, an Stelle der vier Uhrgehäuse
Fritzsches einige der gelungensten Porzellanwerke Kirchners zu
bringen, um die Persönlichkeit dieses merkwürdigen Künstlers auch
dem Fernerstehenden näher zu bringen.
Schnorr von Carolsfeld.
*
Die Kunst des Rokoko von Max Osborn. Propy-
läen-Verlag, Berlin.
Die Darstellung des bekannten Berliner Kunstkritikers gipfelt
in geistreichen Auseinandersetzungen über Wert und Wesen des
Rokoko, das zu gleicher Zeit die Kennzeichen eines glänzenden
Abschlusses, wie eines bedeutungsvollen Anfangs trägt. Mit der
Auflösung der sichtbaren Form geht, wie Osborn die Dinge sieht,
eine Erneuerung des Lebensgefühls Hand in Hand, ein Freiheits-
gefühl, das schließlich in dier 'großen Revolution seine Auslösung
findet. Aus vielen kleinen, gut beobachteten Zügen setzt sich das
Bild des Rokoko zusammen. Ein leichtes und freies Spiel mit den
überkommenen Formen des Barock bringt die bewegliche, leichte
Anmut, das Zierliche, Tändelnde, Galante hervor, und die heitere
Freude am Genuß des Daseins, vereint mit der Sehnsucht nach
Freiheit ein Zurückgehen zur Natur, das sich in den Schäferspielen
äußert. Durch 491) Abbildungen, darunter zahlreiche farbige, wer-
den die Ausführungen Osborns vertieft und ausgedeutet.
W. B.
ORIGINAL-GRAPHIK
ALTER UND MODERNER MEISTER
Aldegrever, Altdorfer, Amman, Backhuizen, Bega, Beham, della
Bella, Belotto, Berghem, Bink, Bol, Breenberg, Breugbel, Callot,
Canale, Claude, Cranach, Drevet, Dürer, v. Dyck, Edelinck,
Gellie, Goltzius, Goya, Hollar, Lautensack, Leyden, Masson, Nan-
teuil, Ostade, Rembrandt, Ruisdael, Schongauer, Waterloo, Zeeman
-H «5 ■ W «5 rf i
Appian, Besnard, Bone, Bracquemond
Daubigny, Daumter, Forain, Haden,
Meryon, Millet, Whistle:
Reich illustrierter Gesamt-Katalog Nr. 27 /
Graphik. Preis frs. 5.— / Erscheint
« ca
Buhot, Cameron,
Legros, Lep*re,
Zorn
Corot,
Manet,
Alte und moderne
Mitte April
GUTEKUNST & KLIPSTEIN
Aug. Klipstein Nachf.
BERN (Schweiz) Hotelgasse 811
Robert Eigenberger, De Gemäldegalerie der Akademie der
Bildenden Künste ln Wien. Manz- Verlag, Wien-
Leipzig 1927. Textband XX und 5€8 Seiten, Tafel-
band mit 2C9 Tafeln.
Der Begründer dieser hervorragenden Gemäldegalerie war
Graf Anton Lamberg-Sprinzenstein (1740—1822), der seine weit
über 700 Gemälde umfassende Sammlung der Akademie vermacht
hat, zu deren Präsidenten er 1818 ernannt worden war. Der Graf
war ein Sammler großen Stils, der mit feinem Geschmack vor allem
niederländische und italienische Meister erwarb. Zu diesem Haupt-
und Kernstück der Galerie kam ein seit etwa 1732 allmählich an-
wachsender Bestand von Bildern, die von ihren Urhebern zur Er-
langung der Mitgliedschaft oder zur Bewerbung um Akademiepreise
eingesandt worden waren. Dann erfuhr die Sammlung noch im
Jahre 1838 einen bedeutenden Zuwachs durch eine Schenkung Kai-
ser Ferdinands von 88 meist großen italienischen Bildern, die in
den Museen zu Venedig und Verona keinen Platz hatten finden
können. Allerdings mußte dieser Teil der Sammlung 1918 auf
Grund des Friedensvertrag’es an Italien ausgeliefert werden, wo-
durch der Bilderbestand eine schwer fühlbare Minderung erlitt.
Neben Schenkungen und Erwerbungen aus staatlichen Mitteln er-
folgten ferner bedeutende Zuwendungen des Fürsten Johann von
Liechtenstein. Durch die Uebersiedlung in das neue Akademie-
Kaufe
Schwedisches Silber
Schwedische Möbel
des 18. Jahrhunderts
Peri-Ming
Berlin W 9 Lennestr. 4
LUDWIGS GALERIE / OTTO H. NATHAN
Ludwigstr. 6 MÜNCHEN Telefon 20970
GEMÄLDE ERSTEN RANGES
insbesondere des 19.Jahrhunde*ts
Katalog auf Wunsch kostenfrei
ANKAUF VERKAUF
R. WAGNER/CHINA
Berlin W 9 / Potsdamer Str. 134
Ausstellungvoa Kunstgegenständen
aus persönlichen Einkäufen
39
kurze Ueberblick, den Josten über die Geschichte und die figür-
liche Produktion des Fuldaer Unternehmens gibt, wird allen will-
kommen sein, die sich mit den dürftigen, und recht unzuverlässigen
Angaben der bisherigen Literatur begnügen mußten.
G. E. Pazaurek behandet in Heft 4 die „W ü r 11 e m -
gische Hafnerkeramik“, ein Gebiet, über das kaum einige
Einzelforschungen, geschweige denn zusammenfassende Darstellun-
gen existieren, obwohl zahllose keramische Denkmäler aus vor-
römischer, römischer, alemanischer, fränkischer und späterer Zeit
in den württembergischen Museen erhalten sind. Die Boden-
beschaffenheit der wüttembergischen Lande mit ihren gewaltigen
Tonlagern hat die Entwicklung der Hafnerkeramik besonders be-
günstigt. Bemerkenswert erscheint die Feststellung, daß Württem-
berg, und zwar hauptsächlich der Bodenseegegend, der Vortritt hin-
sichtlich der Ausbildung der Nischenkachel gebührt, obwohl Tirol
und Salzburg sie um 1500 plastisch und koloristisch zur höchsten
Blüte gebracht haben. Die meisten Spuren führen nach Ravens-
burg, woher u. a. der prächtige Ofen im Stuttgarter Schloßmuseum
stammt. Wichtig ist ferner, daß in Ulm bis tief ins 15. Jahrhundert
hinein die frühsten deutschen Fayencen hergestellt wurden. Im
16. Jahrhundert sind württembergische Hafner in Frankfurt, in und
um Bozen und in Salzburg tätig. Georg Grebner aus Kirchheim
wurde sogar als Hoftöpfer an den Kaiserhof nach Prag berufen
und erhielt 1615 das Bürgerrecht. Im Verlauf des 17. und 18. Jahr-
hunderts ist die württembergische Hafnerkunst mehr und mehr
zurückgegangen. Die Reihe der alten württembergischen Hafner
beschließt der Dichter Eduard Mörike, von dem Krüge mit Versen
in verschiedenen Museen erhalten sind.
Ernst Zimmermann schreibt in Heft 5 über Johann
Gottlob Kirchner, den Vorlifhfer Kändlers an der Meißner
Manufaktur. Im ersten Teil gibt er neben der Schilderung seines
Lebens eine Zusammenstellung seiner Meißner Arbeiten, soweit sie
auf Grund der Manufakturakten ermittelt werden können. Im
zweiten Teil sucht er festzustellen, welcher Porzellanwerke Kirch-
ners sich nach den Angaben der Akten noch nachweisen lassen.
Zweifellos ist es schwer, Kirchner als Porzellanplastiker vollauf
gerecht zu werden. Neben vielem Unzulänglichen und Abstrusen
finden wir einzelne Werke von wahrhaft genialer Eingebung und
hinreichendem Schwung. Die Schwierigkeiten der Porzellantechmk
hat er, der zum Großplastiker geradezu prädestiniert war, nie über-
winden können. So kam es, daß Kandier, der gewissenhafte und
fleißige Akademiker, ihn immer mehr verdrängte und schließlich
das Feld behauptete. Die Wahl der Abbildungen beschränkt sich
auf unbekannte oder wenig bekannte Werke Kirchners. Aber viel-
leicht wäre es besser gewesen, an Stelle der vier Uhrgehäuse
Fritzsches einige der gelungensten Porzellanwerke Kirchners zu
bringen, um die Persönlichkeit dieses merkwürdigen Künstlers auch
dem Fernerstehenden näher zu bringen.
Schnorr von Carolsfeld.
*
Die Kunst des Rokoko von Max Osborn. Propy-
läen-Verlag, Berlin.
Die Darstellung des bekannten Berliner Kunstkritikers gipfelt
in geistreichen Auseinandersetzungen über Wert und Wesen des
Rokoko, das zu gleicher Zeit die Kennzeichen eines glänzenden
Abschlusses, wie eines bedeutungsvollen Anfangs trägt. Mit der
Auflösung der sichtbaren Form geht, wie Osborn die Dinge sieht,
eine Erneuerung des Lebensgefühls Hand in Hand, ein Freiheits-
gefühl, das schließlich in dier 'großen Revolution seine Auslösung
findet. Aus vielen kleinen, gut beobachteten Zügen setzt sich das
Bild des Rokoko zusammen. Ein leichtes und freies Spiel mit den
überkommenen Formen des Barock bringt die bewegliche, leichte
Anmut, das Zierliche, Tändelnde, Galante hervor, und die heitere
Freude am Genuß des Daseins, vereint mit der Sehnsucht nach
Freiheit ein Zurückgehen zur Natur, das sich in den Schäferspielen
äußert. Durch 491) Abbildungen, darunter zahlreiche farbige, wer-
den die Ausführungen Osborns vertieft und ausgedeutet.
W. B.
ORIGINAL-GRAPHIK
ALTER UND MODERNER MEISTER
Aldegrever, Altdorfer, Amman, Backhuizen, Bega, Beham, della
Bella, Belotto, Berghem, Bink, Bol, Breenberg, Breugbel, Callot,
Canale, Claude, Cranach, Drevet, Dürer, v. Dyck, Edelinck,
Gellie, Goltzius, Goya, Hollar, Lautensack, Leyden, Masson, Nan-
teuil, Ostade, Rembrandt, Ruisdael, Schongauer, Waterloo, Zeeman
-H «5 ■ W «5 rf i
Appian, Besnard, Bone, Bracquemond
Daubigny, Daumter, Forain, Haden,
Meryon, Millet, Whistle:
Reich illustrierter Gesamt-Katalog Nr. 27 /
Graphik. Preis frs. 5.— / Erscheint
« ca
Buhot, Cameron,
Legros, Lep*re,
Zorn
Corot,
Manet,
Alte und moderne
Mitte April
GUTEKUNST & KLIPSTEIN
Aug. Klipstein Nachf.
BERN (Schweiz) Hotelgasse 811
Robert Eigenberger, De Gemäldegalerie der Akademie der
Bildenden Künste ln Wien. Manz- Verlag, Wien-
Leipzig 1927. Textband XX und 5€8 Seiten, Tafel-
band mit 2C9 Tafeln.
Der Begründer dieser hervorragenden Gemäldegalerie war
Graf Anton Lamberg-Sprinzenstein (1740—1822), der seine weit
über 700 Gemälde umfassende Sammlung der Akademie vermacht
hat, zu deren Präsidenten er 1818 ernannt worden war. Der Graf
war ein Sammler großen Stils, der mit feinem Geschmack vor allem
niederländische und italienische Meister erwarb. Zu diesem Haupt-
und Kernstück der Galerie kam ein seit etwa 1732 allmählich an-
wachsender Bestand von Bildern, die von ihren Urhebern zur Er-
langung der Mitgliedschaft oder zur Bewerbung um Akademiepreise
eingesandt worden waren. Dann erfuhr die Sammlung noch im
Jahre 1838 einen bedeutenden Zuwachs durch eine Schenkung Kai-
ser Ferdinands von 88 meist großen italienischen Bildern, die in
den Museen zu Venedig und Verona keinen Platz hatten finden
können. Allerdings mußte dieser Teil der Sammlung 1918 auf
Grund des Friedensvertrag’es an Italien ausgeliefert werden, wo-
durch der Bilderbestand eine schwer fühlbare Minderung erlitt.
Neben Schenkungen und Erwerbungen aus staatlichen Mitteln er-
folgten ferner bedeutende Zuwendungen des Fürsten Johann von
Liechtenstein. Durch die Uebersiedlung in das neue Akademie-
Kaufe
Schwedisches Silber
Schwedische Möbel
des 18. Jahrhunderts
Peri-Ming
Berlin W 9 Lennestr. 4
LUDWIGS GALERIE / OTTO H. NATHAN
Ludwigstr. 6 MÜNCHEN Telefon 20970
GEMÄLDE ERSTEN RANGES
insbesondere des 19.Jahrhunde*ts
Katalog auf Wunsch kostenfrei
ANKAUF VERKAUF
R. WAGNER/CHINA
Berlin W 9 / Potsdamer Str. 134
Ausstellungvoa Kunstgegenständen
aus persönlichen Einkäufen
39