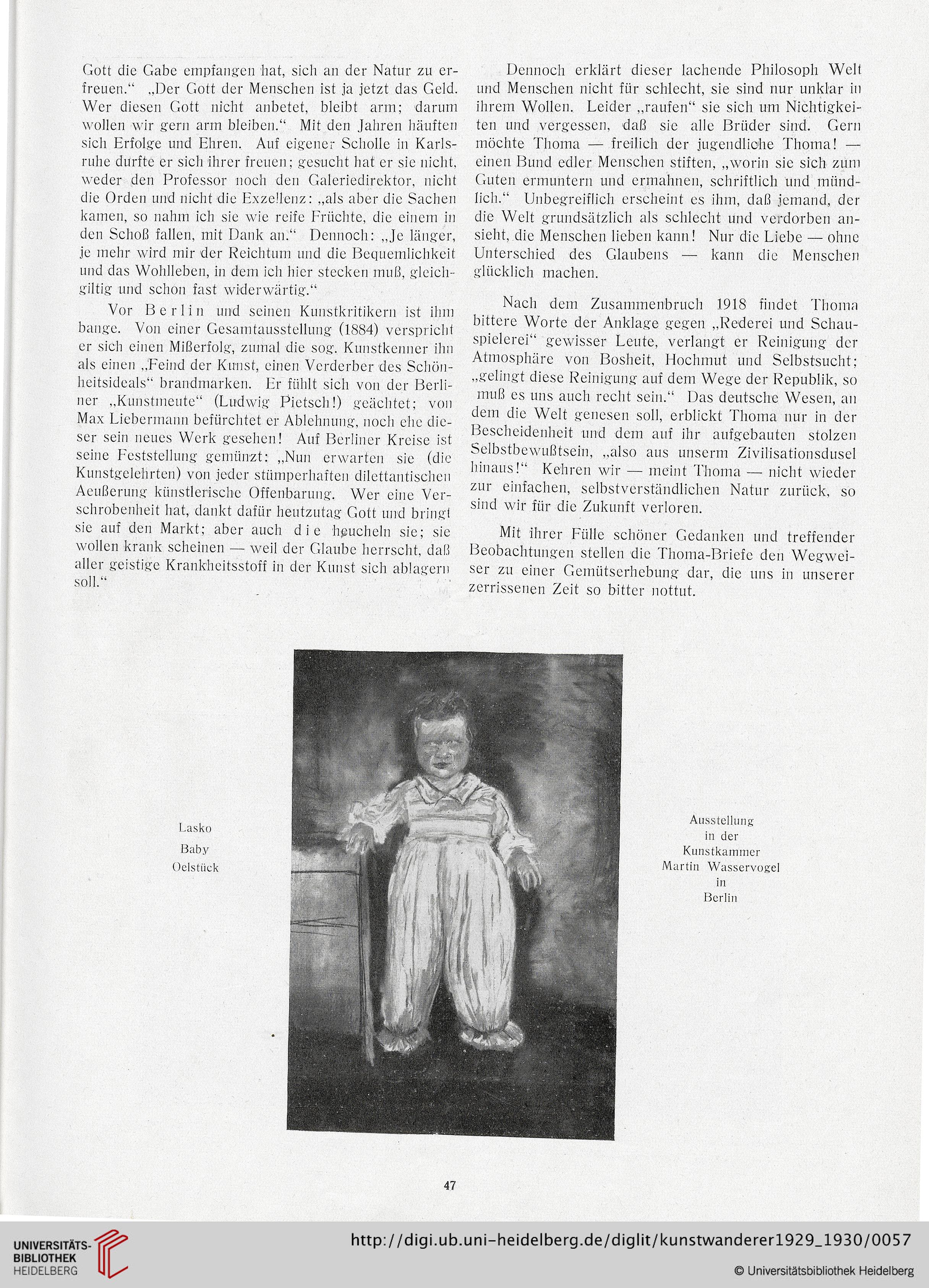Gott die Gabe empfangen hat, sich an der Natur zu er-
freuen.“ „Der Gott der Menschen ist ja jetzt das Geld.
Wer diesen Gott nicht anbetet, bleibt arm; darum
wollen wir gern arm bleiben.“ Mit den Jahren häuften
sich Erfolge und Ehren. Auf eigener Scholle in Karls-
ruhe durfte er sich ihrer freuen; gesucht hat er sie nicht,
weder den Professor noch den Galeriedirektor, nicht
die Orden und nicht die Exzellenz: „als aber die Sachen
kamen, so nahm ich sie wie reife Früchte, die einem in
den Schoß fallen, mit Dank an.“ Dennoch: „Je länger,
je mehr wird mir der Reichtum und die Bequemlichkeit
und das Wohlleben, in dem ich hier stecken muß, gleicli-
giltig und schon fast widerwärtig.“
Vor Berlin und seinen Kunstkritikern ist ihm
bange. Von einer Gesamtausstellung (1884) verspricht
er sich einen Mißerfolg, zumal die sog. Kunstkenner ihn
als einen „Feind der Kunst, einen Verderber des Schön-
heitsideals“ brandmarken. Er fühlt sich von der Berli-
ner „Kunstmeute“ (Ludwig Pietsch!) geächtet; von
Max Liebermann befürchtet er Ablehnung, noch ehe die-
ser sein neues Werk gesehen! Auf Berliner Kreise ist
seine Feststellung gemünzt; „Nun erwarten sie (die
Kunstgelehrten) von jeder stümperhaften dilettantischen
Aeußerung künstlerische Offenbarung. Wer eine Ver-
schrobenheit hat, dankt dafür heutzutag Gott und bringt
sie auf den Markt; aber auch die heucheln sie; sie
wollen krank scheinen — weil der Glaube herrscht, daß
aller geistige Krankheitsstoff in der Kunst sich ablagern
soll.“
Dennoch erklärt dieser lachende Philosoph Welt
und Menschen nicht für schlecht, sie sind nur unklar in
ihrem Wollen. Leider „raufen“ sie sich um Nichtigkei-
ten und vergessen, daß sie alle Brüder sind. Gern
möchte J'homa — freilich der jugendliche Thoma! —
einen Bund edler Menschen stiften, „worin sie sich zum
Guten ermuntern und ermahnen, schriftlich und münd-
lich.“ Unbegreiflich erscheint es ihm, daß jemand, der
die Welt grundsätzlich als schlecht und verdorben an-
sieht, die Menschen lieben kann! Nur die Liebe — ohne
Unterschied des Glaubens — kann die Menschen
glücklich machen.
Nach dem Zusammenbruch 1918 findet Thoma
bittere Worte der Anklage gegen „Rederei und Schau-
spielerei“ gewisser Leute, verlangt er Reinigung der
Atmosphäre von Bosheit, Hochmut und Selbstsucht;
„gelingt diese Reinigung auf dem Wege der Republik, so
muß es uns auch recht sein.“ Das deutsche Wesen, an
dem die Welt genesen soll, erblickt Thoma nur in der
Bescheidenheit und dem auf ihr aufgebauten stolzen
Selbstbewußtsein, „also aus unserm Zivilisationsdusel
hinaus!“ Kehren wir — meint Thoma — nicht wieder
zur einfachen, selbstverständlichen Natur zurück, so
sind wir für die Zukunft verloren.
Mit ihrer Fülle schöner Gedanken und treffender
Beobachtungen stellen die Thoma-Briefe den Wegwei-
ser zu einer Gemütserhebung dar, die uns in unserer
zerrissenen Zeit so bitter nottut.
Lasko
Baby
Oelstück
Ausstellung
in der
Kunstkammer
Martin Wasservogel
in
Berlin
47
freuen.“ „Der Gott der Menschen ist ja jetzt das Geld.
Wer diesen Gott nicht anbetet, bleibt arm; darum
wollen wir gern arm bleiben.“ Mit den Jahren häuften
sich Erfolge und Ehren. Auf eigener Scholle in Karls-
ruhe durfte er sich ihrer freuen; gesucht hat er sie nicht,
weder den Professor noch den Galeriedirektor, nicht
die Orden und nicht die Exzellenz: „als aber die Sachen
kamen, so nahm ich sie wie reife Früchte, die einem in
den Schoß fallen, mit Dank an.“ Dennoch: „Je länger,
je mehr wird mir der Reichtum und die Bequemlichkeit
und das Wohlleben, in dem ich hier stecken muß, gleicli-
giltig und schon fast widerwärtig.“
Vor Berlin und seinen Kunstkritikern ist ihm
bange. Von einer Gesamtausstellung (1884) verspricht
er sich einen Mißerfolg, zumal die sog. Kunstkenner ihn
als einen „Feind der Kunst, einen Verderber des Schön-
heitsideals“ brandmarken. Er fühlt sich von der Berli-
ner „Kunstmeute“ (Ludwig Pietsch!) geächtet; von
Max Liebermann befürchtet er Ablehnung, noch ehe die-
ser sein neues Werk gesehen! Auf Berliner Kreise ist
seine Feststellung gemünzt; „Nun erwarten sie (die
Kunstgelehrten) von jeder stümperhaften dilettantischen
Aeußerung künstlerische Offenbarung. Wer eine Ver-
schrobenheit hat, dankt dafür heutzutag Gott und bringt
sie auf den Markt; aber auch die heucheln sie; sie
wollen krank scheinen — weil der Glaube herrscht, daß
aller geistige Krankheitsstoff in der Kunst sich ablagern
soll.“
Dennoch erklärt dieser lachende Philosoph Welt
und Menschen nicht für schlecht, sie sind nur unklar in
ihrem Wollen. Leider „raufen“ sie sich um Nichtigkei-
ten und vergessen, daß sie alle Brüder sind. Gern
möchte J'homa — freilich der jugendliche Thoma! —
einen Bund edler Menschen stiften, „worin sie sich zum
Guten ermuntern und ermahnen, schriftlich und münd-
lich.“ Unbegreiflich erscheint es ihm, daß jemand, der
die Welt grundsätzlich als schlecht und verdorben an-
sieht, die Menschen lieben kann! Nur die Liebe — ohne
Unterschied des Glaubens — kann die Menschen
glücklich machen.
Nach dem Zusammenbruch 1918 findet Thoma
bittere Worte der Anklage gegen „Rederei und Schau-
spielerei“ gewisser Leute, verlangt er Reinigung der
Atmosphäre von Bosheit, Hochmut und Selbstsucht;
„gelingt diese Reinigung auf dem Wege der Republik, so
muß es uns auch recht sein.“ Das deutsche Wesen, an
dem die Welt genesen soll, erblickt Thoma nur in der
Bescheidenheit und dem auf ihr aufgebauten stolzen
Selbstbewußtsein, „also aus unserm Zivilisationsdusel
hinaus!“ Kehren wir — meint Thoma — nicht wieder
zur einfachen, selbstverständlichen Natur zurück, so
sind wir für die Zukunft verloren.
Mit ihrer Fülle schöner Gedanken und treffender
Beobachtungen stellen die Thoma-Briefe den Wegwei-
ser zu einer Gemütserhebung dar, die uns in unserer
zerrissenen Zeit so bitter nottut.
Lasko
Baby
Oelstück
Ausstellung
in der
Kunstkammer
Martin Wasservogel
in
Berlin
47