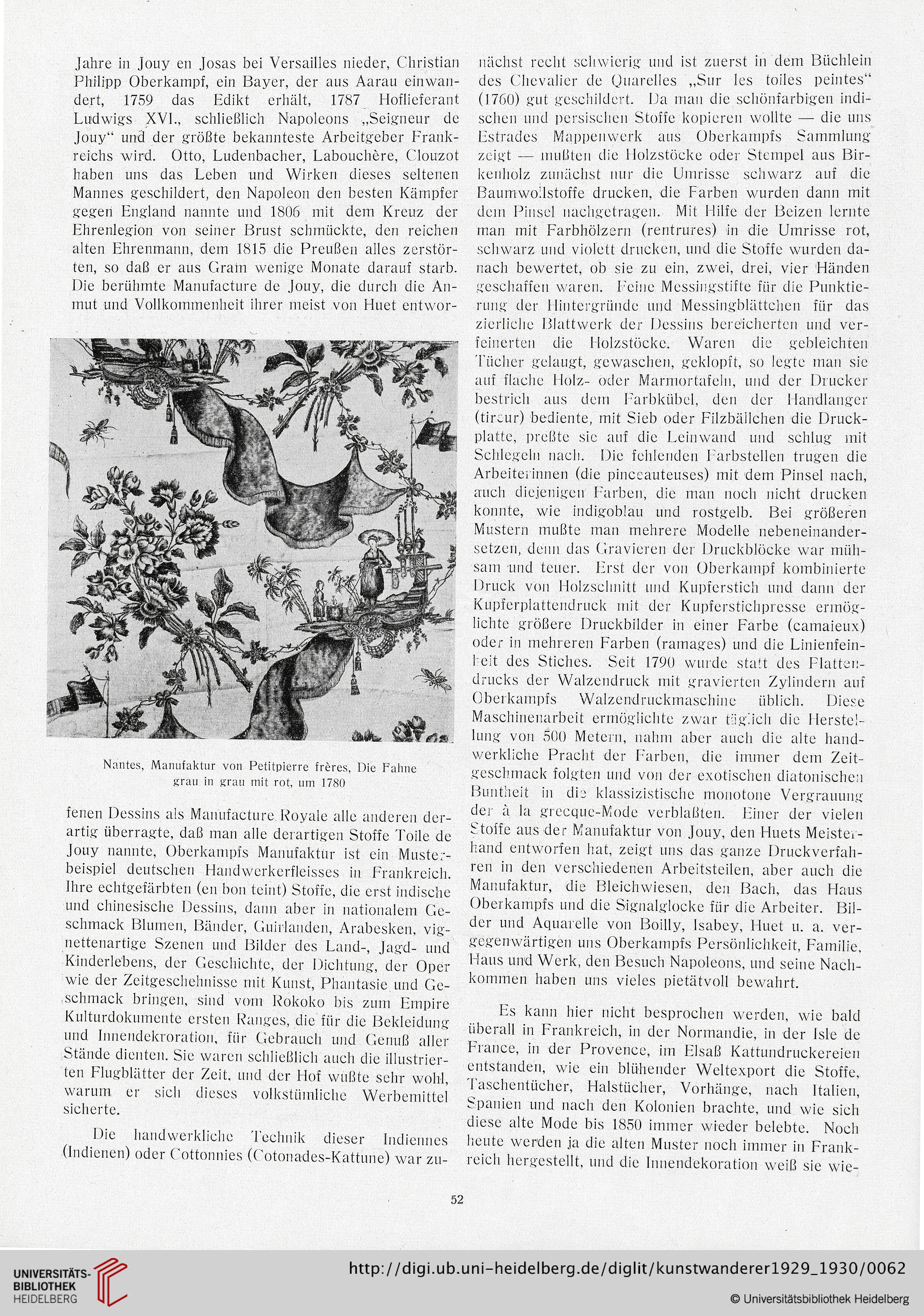Jahre in Jouy en Josas bei Versailles nieder, Christian
Philipp Oberkampf, ein Bayer, der ans Aarau einwan-
dert, 1759 das Edikt erhält, 1787 Hoflieferant
Ludwigs XVI.. schließlich Napoleons „Seigneur de
Jouy“ und der größte bekannteste Arbeitgeber Frank-
reichs wird. Otto, Ludenbacher, Labouchere, Clouzot
haben uns das Leben und Wirken dieses seltenen
Mannes geschildert, den Napoleon den besten Kämpfer
gegen England nannte und 1806 mit dem Kreuz der
Ehrenlegion von seiner Brust schmückte, den reichen
alten Ehrenmann, dem 1815 die Preußen alles zerstör-
ten, so daß er aus Grain wenige Monate darauf starb.
Die berühmte Manufacture de Jouy, die durch die An-
mut und Vollkommenheit ihrer meist von Huet entwor-
Nantes, Manufaktur von Petitpierre freres, Die Fahne
grau in grau mit rot, um 1780
fenen Dessins als Manufacture Royale alle anderen der-
artig überragte, daß man alle derartigen Stoffe Tode de
Jouy nannte, Oberkampfs Manufaktur ist ein Muster-
beispiel deutschen Handwerkerfleisses in Frankreich.
Ihre echtgefärbten (en hon leint) Stoffe, die erst indische
und chinesische Dessins, dann aber in nationalem Ge-
schmack Blumen, Bänder, Guirlauden, Arabesken, vig-
nettenartige Szenen und Bilder des Land-, Jagd- und
Kinderlebens, der Geschichte, der Dichtung, der Oper
wie der Zeitgeschehnisse mit Kunst, Phantasie und Ge-
schmack bringen, sind vorn Rokoko bis zum Empire
Kulturdokumente ersten Ranges, die für die Bekleidung
und Innendekroration, für Gebrauch und Genuß aller
Stände dienten. Sie waren schließlich auch die illustrier-
ten Flugblätter der Zeit, und der Hof wußte sehr wohl,
warum er sich dieses volkstümliche Werbemittel
sicherte.
Die handwerkliche I eclinik dieser Indicnnes
(Indienen) oder Cottonnies (Cotonades-Kattune) war zu-
nächst recht schwierig und ist zuerst in dem Büchlein
des Chevalier de Quarelles „Sur les toiles peintes“
(1760) gut geschildert. Da man die schönfarbigen indi-
schen und persischen Stoffe kopieren wollte — die uns
Estrades Mappenwerk aus Oberkampfs Sammlung
zeigt — mußten die Holzstöcke oder Stempel aus Bir-
kenholz zunächst nur die Umrisse schwarz auf die
Baumwollstoffe drucken, die Farben wurden dann mit
dem Pinsel nachgetragen. Mit Hilfe der Beizen lernte
man mit Farbhölzern (rentrures) in die Umrisse rot,
schwarz und violett drucken, und die Stoffe wurden da-
nach bewertet, ob sie zu ein, zwei, drei, vier Händen
geschaffen waren. Feine Messingstifte für die Punktie-
rung der Hintergründe und Messingblättchen für das
zierliche Blattwerk der Dessins bereicherten und ver-
feinerten die Holzstöcke. Waren die gebleichten
Tücher gelaugt, gewaschen, geklopft, so legte man sie
auf flache Holz- oder Marmortafeln, und der Drucker
bestrich aus dem Farbkübel, den der Handlanger
(tircur) bediente, mit Sieb oder Filzbällchen die Druck-
platte, preßte sie auf die Leinwand und schlug mit
Schlegeln nach. Die fehlenden 1 arbstellcn trugen die
Arbeiterinnen (die pinceauteuses) mit dem Pinsel nach,
auch diejenigen Farben, die man noch nicht drucken
konnte, wie indigoblau und rostgelb. Bei größeren
Mustern mußte man mehrere Modelle nebeneinander-
setzen, denn das Gravieren der Druckblöcke war müh-
sam und teuer. Erst der von Oberkampf kombinierte
Druck von Holzschnitt und Kupferstich und dann der
Kupferplattendruck mit der Kupferstichpresse ermög-
lichte größere Druckbilder in einer Farbe (camaieux)
oder in mehreren Farben (ramages) und die Linienfein-
1 eit des Stiches. Seit 1790 wurde statt des Platten-
drucks der Walzendruck mit gravierten Zylindern auf
Oberkampfs Walzendruckmaschine üblich. Diese
Maschinenarbeit ermöglichte zwar täglich die Herstel-
lung von 500 Metern, nahm aber auch die alte hand-
werkliche Pracht der Farben, die immer dem Zeit-
geschmack folgten und von der exotischen diatonischen
Buntheit in die klassizistische monotone Vergrauung
der a la grecque-Mode verblaßten. Einer der vielen
Stoffe aus der Manufaktur von Jouy, den Huets Meister-
hand entworfen hat, zeigt uns das ganze Druckverfah-
ren in den verschiedenen Arbeitsteilen, aber auch die
Manufaktur, die Bleichwiesen, den Bach, das Haus
Oberkampfs und die Signalglocke für die Arbeiter. Bil-
der und Aquarelle von Boilly, Isabey, Huet u. a. ver-
gegenwärtigen uns Oberkampfs Persönlichkeit, Familie,
Haus und Werk, den Besuch Napoleons, und seine Nach-
kommen haben uns vieles pietätvoll bewahrt.
Es kann hier nicht besprochen werden, wie bald
überall in Frankreich, in der Normandie, in der lsle de
France, in der Provence, im Elsaß Kattundruckereien
entstanden, wie ein blühender Weltexport die Stoffe,
1 aschentücher, Halstücher, Vorhänge, nach Italien,
Spanien und nach den Kolonien brachte, und wie sich
diese alte Mode bis 1850 immer wieder belebte. Noch
heute werden ja die alten Muster noch immer in Frank-
reich hergestellt, und die Innendekoration weiß sie wie-
52
Philipp Oberkampf, ein Bayer, der ans Aarau einwan-
dert, 1759 das Edikt erhält, 1787 Hoflieferant
Ludwigs XVI.. schließlich Napoleons „Seigneur de
Jouy“ und der größte bekannteste Arbeitgeber Frank-
reichs wird. Otto, Ludenbacher, Labouchere, Clouzot
haben uns das Leben und Wirken dieses seltenen
Mannes geschildert, den Napoleon den besten Kämpfer
gegen England nannte und 1806 mit dem Kreuz der
Ehrenlegion von seiner Brust schmückte, den reichen
alten Ehrenmann, dem 1815 die Preußen alles zerstör-
ten, so daß er aus Grain wenige Monate darauf starb.
Die berühmte Manufacture de Jouy, die durch die An-
mut und Vollkommenheit ihrer meist von Huet entwor-
Nantes, Manufaktur von Petitpierre freres, Die Fahne
grau in grau mit rot, um 1780
fenen Dessins als Manufacture Royale alle anderen der-
artig überragte, daß man alle derartigen Stoffe Tode de
Jouy nannte, Oberkampfs Manufaktur ist ein Muster-
beispiel deutschen Handwerkerfleisses in Frankreich.
Ihre echtgefärbten (en hon leint) Stoffe, die erst indische
und chinesische Dessins, dann aber in nationalem Ge-
schmack Blumen, Bänder, Guirlauden, Arabesken, vig-
nettenartige Szenen und Bilder des Land-, Jagd- und
Kinderlebens, der Geschichte, der Dichtung, der Oper
wie der Zeitgeschehnisse mit Kunst, Phantasie und Ge-
schmack bringen, sind vorn Rokoko bis zum Empire
Kulturdokumente ersten Ranges, die für die Bekleidung
und Innendekroration, für Gebrauch und Genuß aller
Stände dienten. Sie waren schließlich auch die illustrier-
ten Flugblätter der Zeit, und der Hof wußte sehr wohl,
warum er sich dieses volkstümliche Werbemittel
sicherte.
Die handwerkliche I eclinik dieser Indicnnes
(Indienen) oder Cottonnies (Cotonades-Kattune) war zu-
nächst recht schwierig und ist zuerst in dem Büchlein
des Chevalier de Quarelles „Sur les toiles peintes“
(1760) gut geschildert. Da man die schönfarbigen indi-
schen und persischen Stoffe kopieren wollte — die uns
Estrades Mappenwerk aus Oberkampfs Sammlung
zeigt — mußten die Holzstöcke oder Stempel aus Bir-
kenholz zunächst nur die Umrisse schwarz auf die
Baumwollstoffe drucken, die Farben wurden dann mit
dem Pinsel nachgetragen. Mit Hilfe der Beizen lernte
man mit Farbhölzern (rentrures) in die Umrisse rot,
schwarz und violett drucken, und die Stoffe wurden da-
nach bewertet, ob sie zu ein, zwei, drei, vier Händen
geschaffen waren. Feine Messingstifte für die Punktie-
rung der Hintergründe und Messingblättchen für das
zierliche Blattwerk der Dessins bereicherten und ver-
feinerten die Holzstöcke. Waren die gebleichten
Tücher gelaugt, gewaschen, geklopft, so legte man sie
auf flache Holz- oder Marmortafeln, und der Drucker
bestrich aus dem Farbkübel, den der Handlanger
(tircur) bediente, mit Sieb oder Filzbällchen die Druck-
platte, preßte sie auf die Leinwand und schlug mit
Schlegeln nach. Die fehlenden 1 arbstellcn trugen die
Arbeiterinnen (die pinceauteuses) mit dem Pinsel nach,
auch diejenigen Farben, die man noch nicht drucken
konnte, wie indigoblau und rostgelb. Bei größeren
Mustern mußte man mehrere Modelle nebeneinander-
setzen, denn das Gravieren der Druckblöcke war müh-
sam und teuer. Erst der von Oberkampf kombinierte
Druck von Holzschnitt und Kupferstich und dann der
Kupferplattendruck mit der Kupferstichpresse ermög-
lichte größere Druckbilder in einer Farbe (camaieux)
oder in mehreren Farben (ramages) und die Linienfein-
1 eit des Stiches. Seit 1790 wurde statt des Platten-
drucks der Walzendruck mit gravierten Zylindern auf
Oberkampfs Walzendruckmaschine üblich. Diese
Maschinenarbeit ermöglichte zwar täglich die Herstel-
lung von 500 Metern, nahm aber auch die alte hand-
werkliche Pracht der Farben, die immer dem Zeit-
geschmack folgten und von der exotischen diatonischen
Buntheit in die klassizistische monotone Vergrauung
der a la grecque-Mode verblaßten. Einer der vielen
Stoffe aus der Manufaktur von Jouy, den Huets Meister-
hand entworfen hat, zeigt uns das ganze Druckverfah-
ren in den verschiedenen Arbeitsteilen, aber auch die
Manufaktur, die Bleichwiesen, den Bach, das Haus
Oberkampfs und die Signalglocke für die Arbeiter. Bil-
der und Aquarelle von Boilly, Isabey, Huet u. a. ver-
gegenwärtigen uns Oberkampfs Persönlichkeit, Familie,
Haus und Werk, den Besuch Napoleons, und seine Nach-
kommen haben uns vieles pietätvoll bewahrt.
Es kann hier nicht besprochen werden, wie bald
überall in Frankreich, in der Normandie, in der lsle de
France, in der Provence, im Elsaß Kattundruckereien
entstanden, wie ein blühender Weltexport die Stoffe,
1 aschentücher, Halstücher, Vorhänge, nach Italien,
Spanien und nach den Kolonien brachte, und wie sich
diese alte Mode bis 1850 immer wieder belebte. Noch
heute werden ja die alten Muster noch immer in Frank-
reich hergestellt, und die Innendekoration weiß sie wie-
52