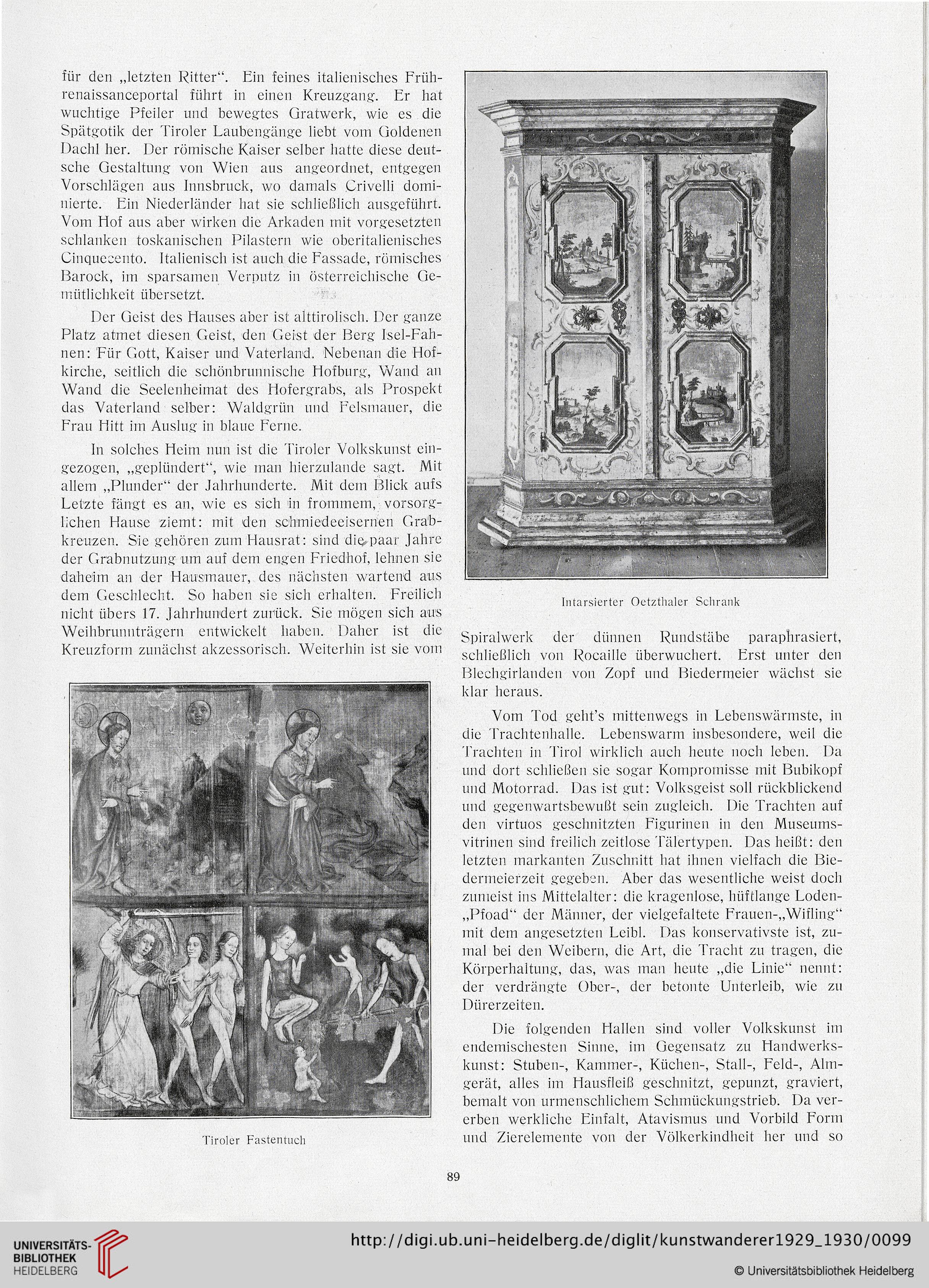für den „letzten Ritter“. Ein feines italienisches Früh-
renaissanceportal führt in einen Kreuzgang. Er hat
wuchtige Pfeiler und bewegtes Gratwerk, wie es die
Spätgotik der Tiroler Laubengänge lieht vom Goldenen
Dachl her. Der römische Kaiser selber hatte diese deut-
sche Gestaltung von Wien aus angeordnet, entgegen
Vorschlägen aus Innsbruck, wo damals Crivelli domi-
nierte. Ein Niederländer hat sie schließlich ausgeführt.
Vom Hof aus aber wirken die Arkaden mit Vorgesetzten
schlanken toskanischen Pilastern wie oberitalienisches
Cinquecento. Italienisch ist auch die Fassade, römisches
Barock, im sparsamen Verputz in österreichische Ge-
mütlichkeit übersetzt.
Der Geist des Hauses aber ist alttirolisch. Der ganze
Platz atmet diesen Geist, den Geist der Berg Isel-Fah-
nen: Für Gott, Kaiser und Vaterland. Nebenan die Hof-
kirche, seitlich die schönbrunnische Hofburg, Wand an
Wand die Seelenheimat des Hofergrabs, als Prospekt
das Vaterland selber: Waldgrün und Felsmauer, die
Frau Hitt im Auslug in blaue Ferne.
In solches Heim nun ist die Tiroler Volkskunst ein-
gezogen, „geplündert“, wie man hierzulande sagt. Mit
allem „Plunder“ der Jahrhunderte. Mit dem Blick aufs
Letzte fängt es an, wie es sich in frommem, vorsorg-
lichen Hause ziemt: mit den schmiedeeisernen Grab-
kreuzen. Sie gehören zum Hausrat: sind diq.paar Jahre
der Grabnutzung um auf dem engen Friedhof, lehnen sie
daheim an der Hausmauer, des nächsten wartend aus
dem Geschlecht. So haben sie sich erhalten. Freilich
nicht übers 17. Jahrhundert zurück. Sie mögen sich aus
Weihbrunnträgern entwickelt haben. Daher ist die
Kreuzform zunächst akzessorisch. Weiterhin ist sie vom
Tiroler Fastentuch
Intarsierter Oetzthaler Schrank
Spiralwerk der dünnen Rundstäbe paraphrasiert,
schließlich von Rocaille überwuchert. Erst unter den
Blechgirlanden von Zopf und Biedermeier wächst sie
klar heraus.
Vom Tod geht’s mittenwegs in Lebenswärmste, in
die Trachtenhallc. Lebenswarm insbesondere, weil die
Trachten in Tirol wirklich auch heute noch leben. Da
und dort schließen sie sogar Kompromisse mit Bubikopf
und Motorrad. Das ist gut: Volksgeist soll rückblickend
und gegenwartsbewußt sein zugleich. Die Trachten auf
den virtuos geschnitzten Figurinen in den Museums-
vitrinen sind freilich zeitlose Tälertypen. Das heißt: den
letzten markanten Zuschnitt hat ihnen vielfach die Bie-
dermeierzeit gegeben. Aber das wesentliche weist doch
zumeist ins Mittelalter: die kragenlose, hüftlange Loden-
„Pfoad“ der Männer, der vielgefaltete Frauen-„Wifling“
mit dem angesetzten Leibi. Das konservativste ist, zu-
mal bei den Weibern, die Art, die Tracht zu tragen, die
Körperhaltung, das, was man heute „die Linie“ nennt:
der verdrängte Ober-, der betonte Unterleib, wie zu
Dürerzeiten.
Die folgenden Hallen sind voller Volkskunst im
endemischesten Sinne, im Gegensatz zu Handwerks-
kunst: Stuben-, Kammer-, Küchen-, Stall-, Feld-, Alm-
gerät, alles im Hausfleiß geschnitzt, gepunzt, graviert,
bemalt von urmenschlichem Schmückungstrieb. Da ver-
erben wirkliche Einfalt, Atavismus und Vorbild Form
und Zierelemente von der Völkerkindheit her und so
89
renaissanceportal führt in einen Kreuzgang. Er hat
wuchtige Pfeiler und bewegtes Gratwerk, wie es die
Spätgotik der Tiroler Laubengänge lieht vom Goldenen
Dachl her. Der römische Kaiser selber hatte diese deut-
sche Gestaltung von Wien aus angeordnet, entgegen
Vorschlägen aus Innsbruck, wo damals Crivelli domi-
nierte. Ein Niederländer hat sie schließlich ausgeführt.
Vom Hof aus aber wirken die Arkaden mit Vorgesetzten
schlanken toskanischen Pilastern wie oberitalienisches
Cinquecento. Italienisch ist auch die Fassade, römisches
Barock, im sparsamen Verputz in österreichische Ge-
mütlichkeit übersetzt.
Der Geist des Hauses aber ist alttirolisch. Der ganze
Platz atmet diesen Geist, den Geist der Berg Isel-Fah-
nen: Für Gott, Kaiser und Vaterland. Nebenan die Hof-
kirche, seitlich die schönbrunnische Hofburg, Wand an
Wand die Seelenheimat des Hofergrabs, als Prospekt
das Vaterland selber: Waldgrün und Felsmauer, die
Frau Hitt im Auslug in blaue Ferne.
In solches Heim nun ist die Tiroler Volkskunst ein-
gezogen, „geplündert“, wie man hierzulande sagt. Mit
allem „Plunder“ der Jahrhunderte. Mit dem Blick aufs
Letzte fängt es an, wie es sich in frommem, vorsorg-
lichen Hause ziemt: mit den schmiedeeisernen Grab-
kreuzen. Sie gehören zum Hausrat: sind diq.paar Jahre
der Grabnutzung um auf dem engen Friedhof, lehnen sie
daheim an der Hausmauer, des nächsten wartend aus
dem Geschlecht. So haben sie sich erhalten. Freilich
nicht übers 17. Jahrhundert zurück. Sie mögen sich aus
Weihbrunnträgern entwickelt haben. Daher ist die
Kreuzform zunächst akzessorisch. Weiterhin ist sie vom
Tiroler Fastentuch
Intarsierter Oetzthaler Schrank
Spiralwerk der dünnen Rundstäbe paraphrasiert,
schließlich von Rocaille überwuchert. Erst unter den
Blechgirlanden von Zopf und Biedermeier wächst sie
klar heraus.
Vom Tod geht’s mittenwegs in Lebenswärmste, in
die Trachtenhallc. Lebenswarm insbesondere, weil die
Trachten in Tirol wirklich auch heute noch leben. Da
und dort schließen sie sogar Kompromisse mit Bubikopf
und Motorrad. Das ist gut: Volksgeist soll rückblickend
und gegenwartsbewußt sein zugleich. Die Trachten auf
den virtuos geschnitzten Figurinen in den Museums-
vitrinen sind freilich zeitlose Tälertypen. Das heißt: den
letzten markanten Zuschnitt hat ihnen vielfach die Bie-
dermeierzeit gegeben. Aber das wesentliche weist doch
zumeist ins Mittelalter: die kragenlose, hüftlange Loden-
„Pfoad“ der Männer, der vielgefaltete Frauen-„Wifling“
mit dem angesetzten Leibi. Das konservativste ist, zu-
mal bei den Weibern, die Art, die Tracht zu tragen, die
Körperhaltung, das, was man heute „die Linie“ nennt:
der verdrängte Ober-, der betonte Unterleib, wie zu
Dürerzeiten.
Die folgenden Hallen sind voller Volkskunst im
endemischesten Sinne, im Gegensatz zu Handwerks-
kunst: Stuben-, Kammer-, Küchen-, Stall-, Feld-, Alm-
gerät, alles im Hausfleiß geschnitzt, gepunzt, graviert,
bemalt von urmenschlichem Schmückungstrieb. Da ver-
erben wirkliche Einfalt, Atavismus und Vorbild Form
und Zierelemente von der Völkerkindheit her und so
89