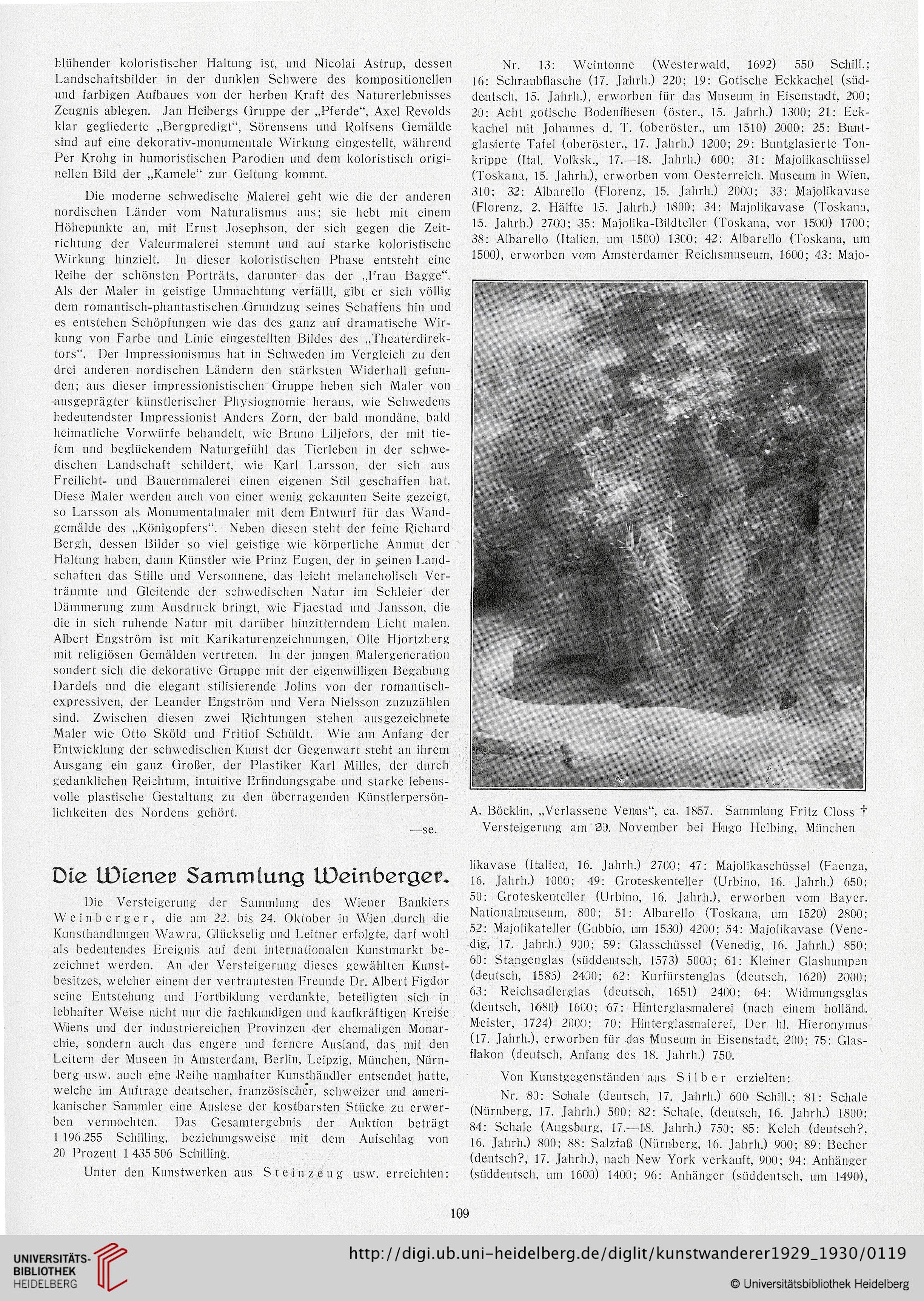blühender koloristischer Haltung ist, und Nicolai Astrup, dessen
Landschaftsbilder in der dunklen Schwere des kompositioneilen
und farbigen Aufbaues von der herben Kraft des Naturerlebnisses
Zeugnis ablegen. Jan Heibergs Gruppe der „Pferde“, Axel Revolds
klar gegliederte „Bergpredigt“, Sörensens und Rolfsens Gemälde
sind auf eine dekorativ-monumentale Wirkung eingestellt, während
Per Krohg in humoristischen Parodien und dem koloristisch origi-
nellen Bild der „Kamele“ zur Geltung kommt.
Die moderne schwedische Malerei geht wie die der anderen
nordischen L.änder vom Naturalismus aus; sie hebt mit einem
Höhepunkte an, mit Ernst Josephson, der sich gegen die Zeit-
richtung der Valeurmalerei stemmt und auf starke koloristische
Wirkung hinzielt. In dieser koloristischen Phase entsteht eine
Reihe der schönsten Porträts, darunter das der „Frau Bagge“.
Als der Maler in geistige Umnachtung verfällt, gibt er sich völlig
dem romantisch-phantastischen «Grundzug seines Schaffens hin und
es entstehen Schöpfungen wie das des ganz auf dramatische Wir-
kung von Farbe und Linie eingestellten Bildes des „Theaterdirek-
tors“. Der Impressionismus hat in Schweden im Vergleich zu den
drei anderen nordischen Ländern den stärksten Widerhall gefun-
den; aus dieser impressionistischen Gruppe heben sich Maler von
ausgeprägter künstlerischer Physiognomie heraus, wie Schwedens
bedeutendster Impressionist Anders Zorn, der bald mondäne, bald
heimatliche Vorwürfe behandelt, wie Bruno Liljefors, der mit tie-
fem und beglückendem Naturgefühl das Tierleben in der schwe-
dischen Landschaft schildert, wie Karl Larsson, der sich aus
Freilicht- und Bauernmalerei einen eigenen Stil geschaffen hat.
Diese Maler werden auch von einer wenig gekannten Seite gezeigt,
so Larsson als Monumentalmaler mit dem Entwurf für das Wand-
gemälde des „Königopfers“. Neben diesen steht der feine Richard
Bergh, dessen Bilder so viel geistige wie körperliche Anmut der
Haltung haben, dann Künstler wie Prinz Eugen, der in feinen Land-
schaften das Stille und Versonnene, das leicht melancholisch Ver-
träumte und Gleitende der schwedischen Natur im Schleier der
Dämmerung zum Ausdruck bringt, wie Fjaestad und Jansson, die
die in sich ruhende Natur mit darüber hinzitterndem Licht malen.
Albert Engström ist mit Karikaturenzeichnungen, Olle Hjortzberg
mit religiösen Gemälden vertreten. In der jungen Malergeneration
sondert sich die dekorative Gruppe mit der eigenwilligen Begabung
Dardels und die elegant stilisierende Johns von der romantisch-
expressiven, der Leander Engström und Vera Niclsson zuzuzählen
sind. Zwischen diesen zwei Richtungen stehen ausgezeichnete
Maler wie Otto Sköld und Fritiof Schiildt. Wie am Anfang der
Entwicklung der schwedischen Kunst der Gegenwart steht an ihrem
Ausgang ein ganz Großer, der Plastiker Karl Milles, der durch
gedanklichen Reichtum, intuitive Erfindungsgabe und starke lebens-
volle plastische Gestaltung zu den überragenden Künstlerpersön-
lichkeiten des Nordens gehört.
—se.
Die IDienec Sammlung IDeinberger.
Die Versteigerung der Sammlung des Wiener Bankiers
Weinberger, die am 22. bis 24. Oktober in Wien durch die
Kunsthandlungen Wawra, Glückselig und Leitner erfolgte, darf wohl
als bedeutendes Ereignis auf dem internationalen Kunstmarkt be-
zeichnet werden. An der Versteigerung dieses gewählten Kunst-
besitzes, welcher einem der vertrautesten Freunde Dr. Albert Figdör
seine Entstehung und Fortbildung verdankte, beteiligten sich in
lebhafter Weise nicht nur die fachkundigen und kaufkräftigen Kreise
Wiens und der industriereichen Provinzen der ehemaligen Monar-
chie, sondern auch das engere und fernere Ausland, das mit den
Leitern der Museen in Amsterdam, Berlin, Leipzig, München, Nürn-
berg usw. auch eine Reihe namhafter Kunsthändler entsendet hatte,
welche im Aufträge deutscher, französischer, schweizer und ameri-
kanischer Sammler eine Auslese der kostbarsten Stücke zu erwer-
ben vermochten. Das Gesamtergebnis der Auktion beträgt
1 196 255 Schilling, beziehungsweise mit dem Aufschlag von
20 Prozent 1 435 506 Schilling.
Unter den Kunstwerken aus St ein zeug usw. erreichten:
Nr. 13: Weintonne (Westerwald, 1692) 5501 Schill.;
16: Schraubflasche (17. Jahrh.) 220; 19: Gotische Eckkachel (süd-
deutsch, 15. Jalirh.), erworben für das Museum in Eisenstadt, 200;
20: Acht gotische Bodenfliesen (öster., 15. Jalirh.) 1300; 21: Eck-
kachel mit Johannes d. T. (oberöster., um 1510) 2000; 25: Bunt-
glasierte Tafel (oberöster., 17. Jalirh.) 1200; 29: Buntglasierte Ton-
krippc (Ital. Volksk., 17.—18. Jalirh.) 600; 31: Majolikaschüssel
(Toskana, 15. Jahrh.), erworben vom, Oesterreich. Museum in Wien,
310: 32: Albarello (Florenz, 15. Jahrh.) 2000; 33: Majolikavase
(Florenz, 2. Hälfte 15. Jahrh.) 1800; 34: Majolikavase (Toskana,
15. Jahrh.) 2700; 35: Majolika-Bildteller (Toskana, vor 1500) 1700;
38: Albarello (Italien, um 1500) 1300; 42: Albarello (Toskana, um
1500), erworben vom Amsterdamer Reichsmuseum, 1600; 43: Majo-
A. Böcklin, „Verlassene Venus“, ca. 1857. Sammlung Fritz Closs t
Versteigerung am 20. November bei Hugo Helbing, München
likavase (Italien, 16. Jahrh.) 2700'; 47: Majolikaschüssel (Faenza,
16. Jalirh.) 1000 ; 49: Groteskenteller (Urbino, 16. Jahrh.) 650:
50: Groteskenteller (Urbino, 16. Jahrh.), erworben vom Bayer.
Nationalmuseum, 800; 51: Albarello (Toskana, um 1520) 2800:
52: Majolikateller (Gubbio, um 1530) 4200: 54: Majolikavase (Vene-
dig, 17. Jahrh.) 900: 59: Glasschüssel (Venedig, 16. Jahrh.) 850;
60: Stangenglas (süddeutsch, 1573) 5000; 61: Kleiner Glashumpen
(deutsch, 1586) 2400; 62: Kurfürstenglas (deutsch, 1620) 2000;
63: Reichsadlerglas (deutsch, 1651) 2400; 64: Widmungsglas
(deutsch, 1680) 1600; 67: Hinterglasmalerei (nach einem holländ.
Meister, 1724) 2000; 70: Hinterglasmalerei, Der hl. Hieronymus
(17. Jahrh.), erworben für das Museum in Eisenstadt, 200; 75: Glas-
flakon (deutsch, Anfang des 18. Jahrh.) 750.
Von Kunstgegenständen aus Silber erzielten:
Nr. 80: Schale (deutsch, 17. Jalirh.) 600 Schill.; 81: Schale
(Nürnberg, 17. Jahrh.) 500; 82: Schale, (deutsch, 16. Jahrh.) 1800:
84: Schale (Augsburg, 17.—18. Jahrh.) 750; 85: Kelch (deutsch?,
16. Jahrh.) 800; 88: Salzfaß (Nürnberg, 16. Jahrh.) 900: 89: Becher
(deutsch?, 17. Jahrh.), nach New York verkauft, 900; 94: Anhänger
(süddeutsch, um 1600) 1400; 96: Anhänger (süddeutsch, um 1490),
109
Landschaftsbilder in der dunklen Schwere des kompositioneilen
und farbigen Aufbaues von der herben Kraft des Naturerlebnisses
Zeugnis ablegen. Jan Heibergs Gruppe der „Pferde“, Axel Revolds
klar gegliederte „Bergpredigt“, Sörensens und Rolfsens Gemälde
sind auf eine dekorativ-monumentale Wirkung eingestellt, während
Per Krohg in humoristischen Parodien und dem koloristisch origi-
nellen Bild der „Kamele“ zur Geltung kommt.
Die moderne schwedische Malerei geht wie die der anderen
nordischen L.änder vom Naturalismus aus; sie hebt mit einem
Höhepunkte an, mit Ernst Josephson, der sich gegen die Zeit-
richtung der Valeurmalerei stemmt und auf starke koloristische
Wirkung hinzielt. In dieser koloristischen Phase entsteht eine
Reihe der schönsten Porträts, darunter das der „Frau Bagge“.
Als der Maler in geistige Umnachtung verfällt, gibt er sich völlig
dem romantisch-phantastischen «Grundzug seines Schaffens hin und
es entstehen Schöpfungen wie das des ganz auf dramatische Wir-
kung von Farbe und Linie eingestellten Bildes des „Theaterdirek-
tors“. Der Impressionismus hat in Schweden im Vergleich zu den
drei anderen nordischen Ländern den stärksten Widerhall gefun-
den; aus dieser impressionistischen Gruppe heben sich Maler von
ausgeprägter künstlerischer Physiognomie heraus, wie Schwedens
bedeutendster Impressionist Anders Zorn, der bald mondäne, bald
heimatliche Vorwürfe behandelt, wie Bruno Liljefors, der mit tie-
fem und beglückendem Naturgefühl das Tierleben in der schwe-
dischen Landschaft schildert, wie Karl Larsson, der sich aus
Freilicht- und Bauernmalerei einen eigenen Stil geschaffen hat.
Diese Maler werden auch von einer wenig gekannten Seite gezeigt,
so Larsson als Monumentalmaler mit dem Entwurf für das Wand-
gemälde des „Königopfers“. Neben diesen steht der feine Richard
Bergh, dessen Bilder so viel geistige wie körperliche Anmut der
Haltung haben, dann Künstler wie Prinz Eugen, der in feinen Land-
schaften das Stille und Versonnene, das leicht melancholisch Ver-
träumte und Gleitende der schwedischen Natur im Schleier der
Dämmerung zum Ausdruck bringt, wie Fjaestad und Jansson, die
die in sich ruhende Natur mit darüber hinzitterndem Licht malen.
Albert Engström ist mit Karikaturenzeichnungen, Olle Hjortzberg
mit religiösen Gemälden vertreten. In der jungen Malergeneration
sondert sich die dekorative Gruppe mit der eigenwilligen Begabung
Dardels und die elegant stilisierende Johns von der romantisch-
expressiven, der Leander Engström und Vera Niclsson zuzuzählen
sind. Zwischen diesen zwei Richtungen stehen ausgezeichnete
Maler wie Otto Sköld und Fritiof Schiildt. Wie am Anfang der
Entwicklung der schwedischen Kunst der Gegenwart steht an ihrem
Ausgang ein ganz Großer, der Plastiker Karl Milles, der durch
gedanklichen Reichtum, intuitive Erfindungsgabe und starke lebens-
volle plastische Gestaltung zu den überragenden Künstlerpersön-
lichkeiten des Nordens gehört.
—se.
Die IDienec Sammlung IDeinberger.
Die Versteigerung der Sammlung des Wiener Bankiers
Weinberger, die am 22. bis 24. Oktober in Wien durch die
Kunsthandlungen Wawra, Glückselig und Leitner erfolgte, darf wohl
als bedeutendes Ereignis auf dem internationalen Kunstmarkt be-
zeichnet werden. An der Versteigerung dieses gewählten Kunst-
besitzes, welcher einem der vertrautesten Freunde Dr. Albert Figdör
seine Entstehung und Fortbildung verdankte, beteiligten sich in
lebhafter Weise nicht nur die fachkundigen und kaufkräftigen Kreise
Wiens und der industriereichen Provinzen der ehemaligen Monar-
chie, sondern auch das engere und fernere Ausland, das mit den
Leitern der Museen in Amsterdam, Berlin, Leipzig, München, Nürn-
berg usw. auch eine Reihe namhafter Kunsthändler entsendet hatte,
welche im Aufträge deutscher, französischer, schweizer und ameri-
kanischer Sammler eine Auslese der kostbarsten Stücke zu erwer-
ben vermochten. Das Gesamtergebnis der Auktion beträgt
1 196 255 Schilling, beziehungsweise mit dem Aufschlag von
20 Prozent 1 435 506 Schilling.
Unter den Kunstwerken aus St ein zeug usw. erreichten:
Nr. 13: Weintonne (Westerwald, 1692) 5501 Schill.;
16: Schraubflasche (17. Jahrh.) 220; 19: Gotische Eckkachel (süd-
deutsch, 15. Jalirh.), erworben für das Museum in Eisenstadt, 200;
20: Acht gotische Bodenfliesen (öster., 15. Jalirh.) 1300; 21: Eck-
kachel mit Johannes d. T. (oberöster., um 1510) 2000; 25: Bunt-
glasierte Tafel (oberöster., 17. Jalirh.) 1200; 29: Buntglasierte Ton-
krippc (Ital. Volksk., 17.—18. Jalirh.) 600; 31: Majolikaschüssel
(Toskana, 15. Jahrh.), erworben vom, Oesterreich. Museum in Wien,
310: 32: Albarello (Florenz, 15. Jahrh.) 2000; 33: Majolikavase
(Florenz, 2. Hälfte 15. Jahrh.) 1800; 34: Majolikavase (Toskana,
15. Jahrh.) 2700; 35: Majolika-Bildteller (Toskana, vor 1500) 1700;
38: Albarello (Italien, um 1500) 1300; 42: Albarello (Toskana, um
1500), erworben vom Amsterdamer Reichsmuseum, 1600; 43: Majo-
A. Böcklin, „Verlassene Venus“, ca. 1857. Sammlung Fritz Closs t
Versteigerung am 20. November bei Hugo Helbing, München
likavase (Italien, 16. Jahrh.) 2700'; 47: Majolikaschüssel (Faenza,
16. Jalirh.) 1000 ; 49: Groteskenteller (Urbino, 16. Jahrh.) 650:
50: Groteskenteller (Urbino, 16. Jahrh.), erworben vom Bayer.
Nationalmuseum, 800; 51: Albarello (Toskana, um 1520) 2800:
52: Majolikateller (Gubbio, um 1530) 4200: 54: Majolikavase (Vene-
dig, 17. Jahrh.) 900: 59: Glasschüssel (Venedig, 16. Jahrh.) 850;
60: Stangenglas (süddeutsch, 1573) 5000; 61: Kleiner Glashumpen
(deutsch, 1586) 2400; 62: Kurfürstenglas (deutsch, 1620) 2000;
63: Reichsadlerglas (deutsch, 1651) 2400; 64: Widmungsglas
(deutsch, 1680) 1600; 67: Hinterglasmalerei (nach einem holländ.
Meister, 1724) 2000; 70: Hinterglasmalerei, Der hl. Hieronymus
(17. Jahrh.), erworben für das Museum in Eisenstadt, 200; 75: Glas-
flakon (deutsch, Anfang des 18. Jahrh.) 750.
Von Kunstgegenständen aus Silber erzielten:
Nr. 80: Schale (deutsch, 17. Jalirh.) 600 Schill.; 81: Schale
(Nürnberg, 17. Jahrh.) 500; 82: Schale, (deutsch, 16. Jahrh.) 1800:
84: Schale (Augsburg, 17.—18. Jahrh.) 750; 85: Kelch (deutsch?,
16. Jahrh.) 800; 88: Salzfaß (Nürnberg, 16. Jahrh.) 900: 89: Becher
(deutsch?, 17. Jahrh.), nach New York verkauft, 900; 94: Anhänger
(süddeutsch, um 1600) 1400; 96: Anhänger (süddeutsch, um 1490),
109