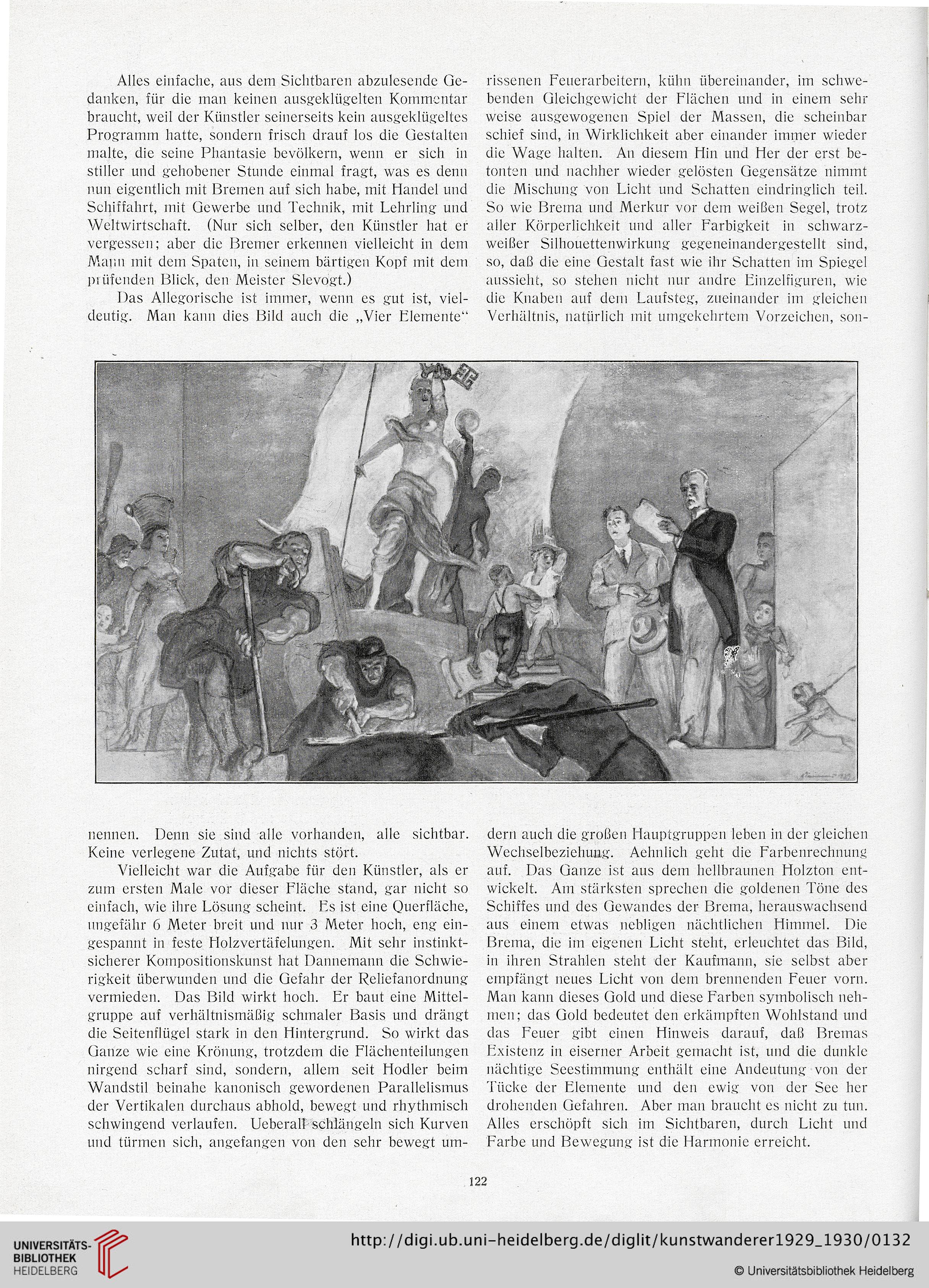Alles einfache, aus dem Sichtbaren abzulesende Ge-
danken, für die man keinen ausgeklügelten Kommentar
braucht, weil der Künstler seinerseits kein ausgeklügeltes
Programm hatte, sondern frisch drauf los die Gestalten
malte, die seine Phantasie bevölkern, wenn er sich in
stiller und gehobener Stunde einmal fragt, was es denn
nun eigentlich mit Bremen auf sich habe, mit Handel und
Schiffahrt, mit Gewerbe und Technik, mit Lehrling und
Weltwirtschaft. (Nur sich selber, den Künstler hat er
vergessen; aber die Bremer erkennen vielleicht in dem
Manu mit dem Spaten, in seinem bärtigen Kopf mit dem
piüfenden Blick, den Meister Slevogt.)
Das Allegorische ist immer, wenn es gut ist, viel-
deutig. Man kann dies Bild auch die „Vier Elemente“
rissenen Feuerarbeitern, kühn übereinander, im schwe-
benden Gleichgewicht der Flächen und in einem sein-
weise ausgewogenen Spiel der Massen, die scheinbar
schief sind, in Wirklichkeit aber einander immer wieder
die Wage halten. An diesem Hin und Her der erst be-
tonten und nachher wieder gelösten Gegensätze nimmt
die Mischung von Licht und Schatten eindringlich teil.
So wie Brerna und Merkur vor dem weißen Segel, trotz
aller Körperlichkeit und aller Farbigkeit in schwarz-
weißer Silhouettenwirkung gegeneinandergestellt sind,
so, daß die eine Gestalt fast wie ihr Schatten im Spiegel
aussieht, so stehen nicht nur andre Einzelfiguren, wie
die Knaben auf dem Laufsteg, zueinander im gleichen
Verhältnis, natürlich mit umgekehrtem Vorzeichen, son-
nennen. Denn sie sind alle vorhanden, alle sichtbar.
Keine verlegene Zutat, und nichts stört.
Vielleicht war die Aufgabe für den Künstler, als er
zum ersten Male vor dieser Fläche stand, gar nicht so
einfach, wie ihre Lösung scheint. Es ist eine Querfläche,
ungefähr 6 Meter breit und nur 3 Meter hoch, eng ein-
gespannt in feste Holzvertäfelungen. Mit sehr instinkt-
sicherer Kompositionskunst hat Dannemann die Schwie-
rigkeit überwunden und die Gefahr der Reliefanordnung
vermieden. Das Bild wirkt hoch. Er baut eine Mittel-
gruppe auf verhältnismäßig schmaler Basis und drängt
die Seitenflügel stark in den Hintergrund. So wirkt das
Ganze wie eine Krönung, trotzdem die Flächenteilungen
nirgend scharf sind, sondern, allem seit Hodler beim
Wandstil beinahe kanonisch gewordenen Parallelismus
der Vertikalen durchaus abhold, bewegt und rhythmisch
schwingend verlaufen. Ueberall schlängeln sich Kurven
und türmen sich, angefangen von den sehr bewegt um-
dern auch die großen Hauptgruppen leben in der gleichen
Wechselbeziehung. Aehnlich geht die Farbenrechnung
auf. Das Ganze ist aus dem hellbraunen Holzton ent-
wickelt. Am stärksten sprechen die goldenen Töne des
Schiffes und des Gewändes der Brema, herauswachsend
aus einem etwas nebligen nächtlichen Himmel. Die
Brema, die im eigenen Licht steht, erleuchtet das Bild,
in ihren Strahlen steht der Kaufmann, sie selbst aber
empfängt neues Licht von dem brennenden Feuer vorn.
Man kann dieses Gold und diese Farben symbolisch neh-
men; das Gold bedeutet den erkämpften Wohlstand und
das Feuer gibt einen Hinweis darauf, daß Bremas
Existenz in eiserner Arbeit gemacht ist, und die dunkle
nächtige Seestimmung enthält eine Andeutung von der
Tücke der Elemente und den ewig von der See her
drohenden Gefahren. Aber man braucht es nicht zu tun.
Alles erschöpft sich im Sichtbaren, durch Licht und
Farbe und Bewegung ist die Harmonie erreicht.
122
danken, für die man keinen ausgeklügelten Kommentar
braucht, weil der Künstler seinerseits kein ausgeklügeltes
Programm hatte, sondern frisch drauf los die Gestalten
malte, die seine Phantasie bevölkern, wenn er sich in
stiller und gehobener Stunde einmal fragt, was es denn
nun eigentlich mit Bremen auf sich habe, mit Handel und
Schiffahrt, mit Gewerbe und Technik, mit Lehrling und
Weltwirtschaft. (Nur sich selber, den Künstler hat er
vergessen; aber die Bremer erkennen vielleicht in dem
Manu mit dem Spaten, in seinem bärtigen Kopf mit dem
piüfenden Blick, den Meister Slevogt.)
Das Allegorische ist immer, wenn es gut ist, viel-
deutig. Man kann dies Bild auch die „Vier Elemente“
rissenen Feuerarbeitern, kühn übereinander, im schwe-
benden Gleichgewicht der Flächen und in einem sein-
weise ausgewogenen Spiel der Massen, die scheinbar
schief sind, in Wirklichkeit aber einander immer wieder
die Wage halten. An diesem Hin und Her der erst be-
tonten und nachher wieder gelösten Gegensätze nimmt
die Mischung von Licht und Schatten eindringlich teil.
So wie Brerna und Merkur vor dem weißen Segel, trotz
aller Körperlichkeit und aller Farbigkeit in schwarz-
weißer Silhouettenwirkung gegeneinandergestellt sind,
so, daß die eine Gestalt fast wie ihr Schatten im Spiegel
aussieht, so stehen nicht nur andre Einzelfiguren, wie
die Knaben auf dem Laufsteg, zueinander im gleichen
Verhältnis, natürlich mit umgekehrtem Vorzeichen, son-
nennen. Denn sie sind alle vorhanden, alle sichtbar.
Keine verlegene Zutat, und nichts stört.
Vielleicht war die Aufgabe für den Künstler, als er
zum ersten Male vor dieser Fläche stand, gar nicht so
einfach, wie ihre Lösung scheint. Es ist eine Querfläche,
ungefähr 6 Meter breit und nur 3 Meter hoch, eng ein-
gespannt in feste Holzvertäfelungen. Mit sehr instinkt-
sicherer Kompositionskunst hat Dannemann die Schwie-
rigkeit überwunden und die Gefahr der Reliefanordnung
vermieden. Das Bild wirkt hoch. Er baut eine Mittel-
gruppe auf verhältnismäßig schmaler Basis und drängt
die Seitenflügel stark in den Hintergrund. So wirkt das
Ganze wie eine Krönung, trotzdem die Flächenteilungen
nirgend scharf sind, sondern, allem seit Hodler beim
Wandstil beinahe kanonisch gewordenen Parallelismus
der Vertikalen durchaus abhold, bewegt und rhythmisch
schwingend verlaufen. Ueberall schlängeln sich Kurven
und türmen sich, angefangen von den sehr bewegt um-
dern auch die großen Hauptgruppen leben in der gleichen
Wechselbeziehung. Aehnlich geht die Farbenrechnung
auf. Das Ganze ist aus dem hellbraunen Holzton ent-
wickelt. Am stärksten sprechen die goldenen Töne des
Schiffes und des Gewändes der Brema, herauswachsend
aus einem etwas nebligen nächtlichen Himmel. Die
Brema, die im eigenen Licht steht, erleuchtet das Bild,
in ihren Strahlen steht der Kaufmann, sie selbst aber
empfängt neues Licht von dem brennenden Feuer vorn.
Man kann dieses Gold und diese Farben symbolisch neh-
men; das Gold bedeutet den erkämpften Wohlstand und
das Feuer gibt einen Hinweis darauf, daß Bremas
Existenz in eiserner Arbeit gemacht ist, und die dunkle
nächtige Seestimmung enthält eine Andeutung von der
Tücke der Elemente und den ewig von der See her
drohenden Gefahren. Aber man braucht es nicht zu tun.
Alles erschöpft sich im Sichtbaren, durch Licht und
Farbe und Bewegung ist die Harmonie erreicht.
122